MÄRCHEN AUS ÖSTERREICH ... Verzeichnis II
"Die Heugabel"
"Das fromme Kind"
"Der Klaubauf"
"Die Kröte"
"Der schlafende Riese"
"Die Furchtlerner"
"Fürchten lernen "..., II Märchen
"Der blinde Metzger"
"Von drei Deserteuren"
"Schwesterchen und Brüderchen"
"Der Aschentagger"
"Die seltsame Heirat"
"Die Bauernmagd"
"Der Bär"
"Die Wirtin"
"Stiefmutter"
"Die Kröte"
"Der Schmiedlerner"
"Der Blinde"
"Die zwei Beutelschneider"
"Der Wurm"
"Griseldele"
"Kugerl"
"Die verstorbene Gerechtigkeit"
"Die Schleifersöhne"
"Sauerkraut und Totengebeine"
"Die verwunschene Prinzessin"
"Der Bauernbursche"
"Die Drude"
"Eichhörnchen, Käfer, Maus"
"Das Kasermännlein"
"Der Esel"
"Der Fürpaß"
"Der Stinkkäfer"
"Die Schlange"
"Warum ist der Tod so dürr?"
"Die Wette"
"Beutel, Hütlein und Pfeiflein"
"Der Menschenfresser"
"Der Riese"
"Der Advokat"
"Der Bettler"
"Noch ein Märchen von der Krönlnatter"
"Die zwei Königskinder"
"Das Berggeistl"
"Löwe, Storch und Ameise"
"Das Bäuerlein"
"Warm und kalt aus einem Mund"
"Die rätselhaften Antworten"
"Die zwei Künstler"
"Wer bekommt das Haus?"
"Der Gang zur Apotheke"
"Die vier Tücher"
"Warum die Schweine Ringelschwänze haben"
"Von der Erschaffung des Mondes"
"Schneider Freudenreich"
"Hansl Gwagg-Gwagg"
"Das Birkenreis"
"Die drei Soldaten und der Doktor"
"Die zwei Hafner"
"Vom armen Bäuerlein"
"Die drei Holzhacker"
"Die Fanggen"
"Der Hirtenknabe"
"Der Ziegenhirt"
"Der Schafhirt"
"Der glückliche Schneider"
"Vom reichen Ritter und seinen Söhnen"
"Der Vogel Phönix das Wasser des Lebens und die Wunderblume"
"Die Drachenfedern"
DIE DRACHENFEDERN ...

Es war einmal vor langer Zeit ein reicher Wirt, der hatte eine wunderschöne Tochter. Neben dem Wirtshaus wohnte in einer gemieteten Hütte ein armer Holzhacker mit seinem Sohn. Dieser war ein lebensfroher, rüstiger Junge, der schönste Bursche im ganzen Dorf und dazu noch recht brav und arbeitsam.
Immer war er guter Dinge und zur Arbeit aufgelegt, nur wenn er die Liese, die Wirtstochter, sah, dann stand ihm der Gedanke still, und sein Blick verlor die frühere Fröhlichkeit.
Auch Liese war dem Jungen herzlich gut; nur schade, daß er so blutarm war, und ihr Vater, wenn sie ihn um seinen Segen gebeten hätten, ganz gewiß nicht ja gesagt hätte. Aber versuchen konnten sie's ja doch, und sie taten es auch.
Der Vater hieß die Tochter ein dummes Ding und wies ihr die Tür, dem Freier aber gab er lachend zur Antwort, wenn er sich seine Tochter verdienen wolle, müßte er dem Drachen im großen Wald, der einige Stunden vom Dorf entfernt lag, drei goldene Federn ausreißen und sie ihm herbringen, sonst sollte er sich gleich fortmachen.
Der Junge war ganz zufrieden mit dieser Bedingung, denn obwohl er wußte, wie grimmig der Drache über jeden herfiel und wie schreckenhaft er aussah, so hoffte er doch, durch List dem Ungetüm beikommen zu können. Er machte sich sogleich auf den Weg zum Schloß des Drachen, das in einem dunklen Wald lag.
Unterwegs kam er an einem Haus vorbei, vor dessen Tür ein alter Mann saß, der den Kopf in beide Hände stützte und sehr traurig schien. »Was bist du denn so traurig?« redete der Vorübergehende ihn an. »Ja, meine Tochter ist schon viele Jahre krank, und nur der Drache könnte ihr helfen - aber ...«
Da unterbrach ihn der Holzhacker: »Ich gehe jetzt eben zu ihm, vielleicht erfrage ich ein Mittel von ihm, und wenn ich wiederkomme, will ich's dir dann sagen.«
Der Holzhackersohn ging weiter und sah in einem grünen Anger eine große Menge Menschen um einen Apfelbaum versammelt.
»Gefällt euch denn der Baum so gut, ihr Leute, daß ihr so hinaufschaut?« fragte er im Vorbeigehen. »Ja, der Baum«, redete da einer von ihnen den Fragenden an, »der Baum gefiele mir freilich, wenn er wie früher goldene Äpfel trüge; aber leider treibt er jetzt nur schlechte Blätter. Wenn du aber zum Drachen gehen und ihn fragen willst, warum dies geschieht, so sollst du es mir nicht umsonst tun.« »Ja, ja«, sagte der Holzhackersohn, »das will ich auch«, und ging weiter.
Schon sah er den dunklen Wald vor sich, über den sich eine Nebeldecke ausbreitete, und beschleunigte seine Schritte. Da gelangte er an einen Fluß, wo ein alter Fischer ihn in einem kleinen Kahn hinüber führte und ihm klagte, daß er schon so lange dieses langweilige Geschäft versehe und nie abgelöst werden könne, wenn ihm nicht der Walddrache einen gute Rat gebe.
Der dienstfertige Holzknecht versprach ihm, auch sein Anliegen dem Drachen vorzutragen, nachdem er ihm erzählt hatte, warum er in den gefährlichen Wald gehe. Der gute Fischer fing fast zu weinen an, weil er sehr um das junge Leben des Burschen besorgt war. Aber er war doch froh in der Hoffnung, daß auch er noch erlöst werden könnte, und versprach ihm viel Geld zur Belohnung.
Bald fand der junge Brautwerber, weil eben jetzt die rechte Zeit war, das Schloß des Drachen. Er ging hinein und war ganz erstaunt über die große Pracht, die ihm überall entgegen strahlte; den gefürchteten Herrn aber wurde er nicht gewahr, denn zum Glück war er eben nicht zu Hause.
Der Drache hatte jedoch eine Frau, die keinem Menschen ein Leid, sondern nur Gutes tat. Als diese den Holzknecht sah, ging sie ihm entgegen, war sehr freundlich mit ihm, und als er ihr sein Anliegen klagte und ihm vom traurigen Mann, vom Apfelbaum und vom Fischer erzählte, versprach sie ihm sogar, selbst seine Sache zu übernehmen, und versteckte ihn unter der Bettstelle.
Spät in der Nacht erst kam der Hausherr zurück und war heute recht wild, noch viel wilder als sonst, und sobald er ins Gemach eintrat, rief er, voll Zorn um sich blickend: »Ich schmeck', ich schmeck' einen Christen!« »O nein«, entgegnete darauf die Frau, sich verstellend und schmeichelnd, »es ist ja niemand hier gewesen.«
Der Drache ließ es so gelten, und als die Frau ihm recht schön tat und ihn streichelte, wurde er viel zufriedener und war nicht mehr so wild und zornig. Nach einer Weile gingen sie zu Bett, und der Drache schnarchte bald und fiel in einen tiefen Schlaf. Schnell riß ihm die Frau nun eine goldene Feder aus und gab sie dem Holzhacker unter der Bettstelle.
Da wachte aber der Drache auf und schrie zornig: »Wer hat ein Recht, mich zu zupfen und zu rupfen?« »Sei nur nicht böse«, rief die Frau im Schrecken. »Ich habe es im Schlaf getan. Mir träumte, ein alter Mann habe eine kranke Tochter. Was soll sie etwa versuchen, damit sie wieder gesund wird?«
»Die muß die Hostie, die man unter ihrem Bett versteckt hat, wegschaffen, wenn sie noch gesund werden will«, antwortete der Drache und schlief wieder ein. Nun riß sie ihm die zweite Feder aus und gab sie schnell dem lauschenden Holzhacker.
»Wer hat ein Recht, mich zu zupfen und zu rupfen?« schnaubte wieder zornig der Drache. »Sei nur still«, sagte die Frau leise. »Ich habe einen Traum gehabt von einem Apfelbaum, der früher goldene Äpfel trug; jetzt aber trägt er keine mehr. Wenn ich doch wüßte, wie er wieder fruchtbar wird.«
»Die Schlange muß ausgegraben werden, die unter dem Baum liegt und die Wurzeln benagt«, murmelte der Drache schon halb schlafend. Jetzt ging's aufs Letzte, und die Frau riß ihm auch die
dritte Feder aus und machte es wie früher.
Aber da war die Wut des Untiers aufs höchste gestiegen: »Wer rupft und zupft mich?« schrie der Schreckliche und wollte aus dem Bett springen.
Die Frau aber hielt ihn und bat: »Sei doch nicht böse, ich habe geträumt von einem alten Fischer, der immer die Leute über den Fluß führen muß und nie frei wird.« »Er soll dem ersten, der zu ihm kommt, dieses Geschäft übergeben und davon laufen, der dumme Alte«, schnarchte der Drache. »Jetzt aber laß mich in Ruh', sonst zerreiß' ich dich!«
Darauf schlief er wieder ein, und der Holzhacker schlich sich ganz sachte fort und sagte auf dem Heimweg jedem den Rat, den ihm der Drache gegeben hatte, dem Fischer aber sagte er ihn erst, als er ausgestiegen war aus seinem durchlöcherten Fahrzeug. Alle gaben ihm Gold und Silber in Menge, denn sie waren voll Freude, daß er ihnen geholfen hatte.
Am meisten aber freute sich daheim die Liese, als sie den lieben Holzhacker wiedersah. Sie konnte kein Auge von ihm abwenden und hielt ihn immer bei der Hand, bis der Vater kam und nun recht gerne ja sagte, weil der arme Nachbar jetzt viel reicher war als er selbst.
Die jungen Brautleute luden alle Verwandten und Freunde zur Hochzeit. Da waren alle voll Fröhlichkeit, sie selbst aber die Fröhlichsten und Glücklichsten von allen.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus dem Zillertal
DER VOGEL PHÖNIX, DAS WASSER DES LEBENS UND DIE WUNDERBLUME ...
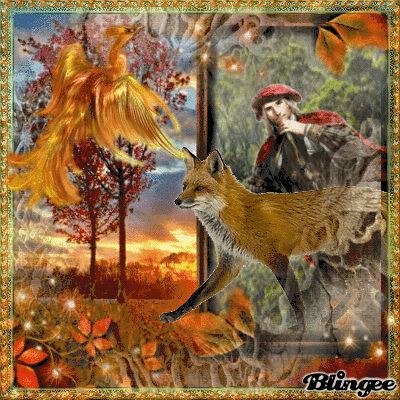
Es verirrte sich einmal ein junger Ritter auf der Jagd dergestalt, daß er um alles in der Welt den Rückweg nimmer finden konnte. Von allen Seiten umstanden ihn alte Tannen, moosige Lärchen und riesige Fichten, und kein Weg und kein Steig zeigte ihm den Heimweg. Da war er gar traurig und suchte von neuem einen Ausweg, doch es war umsonst.
Es begann schon Abend zu werden, und die letzten Strahlen der Sonne zitterten und schossen durch die Äste der Bäume, daß es ein lustiges Spiel war, dann verschwanden sie. Es wurde nun im dichten Wald noch dunkler und unheimlicher. Da dachte sich der Ritter, im Wald hausen gar viele wilde Tiere, und diese werden mich zerreißen und auffressen, wenn sie mich hier finden. Er besann sich hin und her, was in seiner Lage zu tun sei.
Wie er so eine Zeit lang nachgedacht hatte, fiel ihm ein, auf einen Baum zu steigen, um dort zu übernachten. Er hoffte, daß er dort sicher sein werde. Gesagt, getan. Er kletterte die zunächst stehende Tanne empor und immer höher und höher, bis er auf einem der höchsten Äste droben saß wie ein Eichhörnchen. Wie er so auf dem hohen Baum droben war, konnte er den Wald nach allen Seiten hin übersehen.
Er hatte sich noch nicht lange umgeschaut, als er plötzlich ein Licht nicht gar ferne schimmern sah. Er merkte sich die Gegend genau, von der der Schein kam, stieg dann behend vom hohen Baum herunter und wanderte dem Licht zu. Mit seinem Schwert haute er sich einen Weg durch das Gestrüpp und durch die Dornen, bis er endlich müde vor einer ärmlichen Bauernhütte, in der das Licht brannte, ankam.
Er klopfte an die Tür und bat um eine Nachtherberge. Kaum hatte er dies getan, öffnete sich die Tür, und ein altes Bäuerlein hieß ihn willkommen. Er wurde in die Stube geführt und dort von den Töchtern des Bauern gar freundlich aufgenommen. Eine davon ging alsogleich in die Küche, machte dort Feuer an und sott ihm einige Eier.
Der Ritter erzählte, wie er sich verirrt habe und dann andere Jagdabenteuer, die er früher bestanden hatte. Als er das schmale Nachtessen zu sich genommen hatte, legte er sich, weil er so müde war, auf die Ofenbank, auf der er übernachten sollte. Er lag nicht lange, als der Schlaf sich einstellte und er gar süß zu schlummern begann.
Wie die drei Töchter des Bauern merkten, daß der schöne Ritter eingeschlafen war, fingen sie an von ihm zu reden. Da sagte unter anderem die älteste: »Wenn ich einen so schönen Mann bekommen würde, müßten meine Kinder werden wie Milch und Blut.«
Die zweite meinte, wenn sie einen so stattlichen Burschen hätte, müßten ihre Kinder lieblicher als Schnee und Wein aussehen. Da nahm die jüngste das Wort und sprach: »Bleibt mit euren Wünschen zu Hause! Wenn ich einen so prächtigen Mann bekommen würde, müßte ich Kinder kriegen so schön wie weiße und rote Rosen, und ihre Haare müßten sein wie von purem Gold!«
Als sie dies sprach, war der Ritter gerade erwacht und hörte ihre Rede. Und weil das Mädchen so schön war, entschloß er sich, es zur Frau zu nehmen. Er hielt sich aber ruhig und still und ließ von seinem Vorhaben nichts merken. Am anderen Tag, als die jüngste zuerst in die Stube gekommen war, eröffnete ihr der Ritter seinen Entschluß.
Das Mädchen wußte nicht, wie ihr geschah. Es blickte bald fragend den Ritter an, bald schlug es die Augen zu Boden. Als aber der schöne Herr auf seiner Rede bestand, hatte sie eine übergroße Freude und wußte nicht, was sie vor Lust tun sollte. Der Ritter teilte sein Anliegen ihrem Vater mit, und da dieser nichts dagegen einzuwenden hatte, war die Heirat beschlossen, es mochte die beiden älteren Schwestern ärgern wie es wollte.
Der Ritter nahm noch am selben Tag von der Bauernhütte Abschied und kehrte mit seiner Braut auf sein Schloß zurück. Da ging es nun lustig und laut her, als die Hochzeit gefeiert wurde, daß der Traurigste hätte froh werden müssen. Der Ritter und seine schöne Frau lebten nun ein glückliches Leben, und sie meinte oft, es könnte im Himmel nicht feiner sein, als sie es hier auf Erden hatte.
Es dauerte aber nicht lange, und das Glück wurde gestört. Der Ritter mußte nämlich in den Krieg ziehen, um das Land zu verteidigen, und da hatte die Frau gar trübe, traurige Zeiten. Sie verging fast vor Sehnsucht nach ihrem lieben Gemahl und konnte vor Leid beinahe weder essen noch schlafen.
Während der Ritter noch im Felde stand, erfüllte sich die Zeit der Frau, und sie gebar zwei Kinder, ein Söhnlein und ein Töchterlein. Die Kinderlein waren aber so schön wie rote und weiße Rosen, und ihre Haare waren von purem Gold. Da hatte die Frau eine unaussprechliche Freude, daß ihr Wunsch so in Erfüllung gegangen war, und wollte ihrem Herrn gleich davon Nachricht geben.
Sie bat deshalb eine Schwester, die aufs Schloß gekommen war, um die Kinder zu betreuen, dem Ritter vom glücklichen Ereignis zu schreiben. Diese ließ es sich nicht zweimal sagen und schrieb einen Brief. Weil sie aber schon lange Zeit die jüngste Schwester um ihr Glück beneidet hatte, meldete sie dem Ritter im Brief, seine Gemahlin habe zwei Kinder bekommen, sie hätten aber Hundsköpfe und seien so häßlich, daß sie ihm raten müsse, diese ins Wasser werfen zu lassen.
Mit diesem Brief sandte sie einen Boten an den Ritter. Der wollte anfangs, als er das Schreiben las, seinen Augen nicht trauen. Als er aber den Brief wieder gelesen hatte und sah, daß es wirklich so heiße, war er zuerst innigst betrübt, doch bald verwandelte sich sein Schmerz in wütenden Zorn, und er gab Befehl, man sollte die Kinder in das Wasser, seine Gemahlin aber ins Gefängnis werfen.
Die grausame Anordnung des Ritters wurde vollführt. Die Rabenschwester ließ die zwei schönen Kinder in einen Mühlbach und die Frau Ritterin in den Kerker werfen. Der Schmerz über diese schnöde Behandlung und die Trennung von ihren Kindern betrübten aber die gute Frau so sehr, daß sie erkrankte und in kurzer Zeit wie tot im Kerker gefunden wurde.
Die armen Kinder wurden vom kalten Wasser weg getragen, bis sie von einem Rechen, der sich bei einer einsamen Mühle befand, aufgehalten wurden. Als der Müller, der ein seelenguter Mann war, die armen, nassen Kinderlein sah, hatte er das größte Mitleid mit ihnen, nahm sie aus dem Wasser und trug sie in die Stube.
Da sah er erst recht, wie schön sie waren, und konnte sich nicht satt an ihnen schauen. Wie er merkte, daß die Kinderlein noch am Leben waren, empfand er die größte Freude, legte sie in sein Bett und gab ihnen, als sie sich erholt hatten, zu essen und zu trinken. Er entschloß sich, die Kleinen, weil sie gar so schön waren, bei sich zu behalten und groß zu ziehen.
So lebten nun Brüderchen und Schwesterchen in der Mühle, wuchsen und wurden von Tag zu Tag schöner und lieber. Der Müller hatte seine Freude an ihnen und liebte sie so, als ob es seine eigenen Kinder wären, und sie hielten ihn für ihren wahren Vater und taten alles, was sie ihm an den Augen ansehen konnten.
So ging es viele Jahre. Als die zwei Findlinge eines Abends wieder in der Stube bei dem Müller saßen, das Mädchen spann und der Knabe schnitzte, da eröffnete ihnen der Müller, daß er nicht ihr rechter Vater, sondern nur ihr Nährvater sei. Die Kinder machten, als sie dies hörten, große Augen und wollten den Worten ihres vermeinten Vaters nicht glauben.
Wie der Müller dies sah, erzählte er ihnen haargenau, wie er sie gefunden habe und daß er trotz aller Bemühungen ihre Eltern nicht habe auffinden können. Die guten Kinder wurden über diese Nachricht tief betrübt. So lieb der alte Müller gegen sie war und so gut es ihnen in der Mühle ergangen war, so kam ihnen nun doch alles fremd vor, und sie empfanden eine große Sehnsucht nach ihrer wahren Heimat.
Sooft sie allein waren, sprachen sie darüber, wo wohl ihr Vaterhaus sein könnte, und nachts träumten sie davon. Diese Sehnsucht wurde nach und nach so stark, daß sie beschlossen, die Mühle und ihren Pflegevater zu verlassen und in die weite Welt zu wandern, um die Heimat aufzusuchen.
Der Müller riet ihnen anfangs von ihrem Beginnen ab, als er aber sah, daß sie sich von ihrem Vorhaben nicht abwendig machen ließen, gab er ihnen seinen Segen, gute Lehren und ein Säcklein mit Lebensmitteln mit auf die Wanderung. Sie zogen nun aus und gingen, weil ihnen der Müller erzählt hatte, daß er sie im Mühlbach gefunden habe, Bach aufwärts.
So waren sie schon lange gegangen und hatten von ihrer Heimat und ihren Eltern keine Spur entdeckt. Da kamen sie eines Abends müde und matt zu einer großen, großen Stadt, und vor dieser stand ein prächtiges Schloß mit einem schönen Tor und hohen Türmen.
»Schau, es will schon Nacht werden«, sprach das Mädchen, »und ich bin so müde, daß ich fast keinen Fuß mehr aufheben kann!« Das Bübchen antwortete: »Ich bin auch müde und dazu hungrig. Geh, schauen wir, daß wir im Schloß hier über Nacht bleiben können.«
Sie gingen nun zum Burgtor und baten dort um eine Herberge. Dem Torwart, der sonst ein mürrischer, griesgrämiger Kauz war, gefielen die bildschönen Kinder so, daß er sie einließ und ihnen freundlich Bescheid gab. Der Ritter hatte an den Kindern sein Wohlgefallen und fühlte sich, ohne zu wissen warum, zu den Kleinen hingezogen.
Er sprach lange und viel mit ihnen, ließ sie gut bewirten und wünschte ihnen eine gute Nacht. Da waren Brüderchen und Schwesterchen seelenvergnügt und suchten, nachdem sie sich satt gegessen hatten, ein warmes Nestchen, worin sie gar gut schliefen und allerlei zusammen träumten.
Als der Tag schon vorgeschritten war, erwachten die Zwillinge, nahmen ihr Frühstück und wollten dann weiter gehen, ihre Heimat aufzusuchen. Bevor sie jedoch weiter wanderten, gingen sie zum Ritter, um ihm für die Nachtherberge zu danken. Dieser empfing sie sehr freundlich und fand die Kinder so lieb, daß er sie nicht weiter ziehen ließ. »Bleibt nur noch eine Zeitlang bei mir, sprach er, und es soll euch nichts fehlen.«
Den Kindern gefiel dieser Antrag, und sie entschlossen sich bald, in dem Schloß zu bleiben. So freundlich aber der Ritter war, so ungünstig war seine Wirtschafterin. Diese hatte gegen die fremden Bälge, wie sie die zwei Kinder nannte, die größte Abneigung und wollte sie selbst durch Gewalt aus dem Weg räumen.
Sie gab ihnen nur böse Worte, stieß sie hin und her, so oft der Ritter es nicht sah, und begegnete ihnen auf die liebloseste Weise. Als sie sah, daß die Kinder trotzdem im Schloß blieben und keine Miene machten sich zu entfernen, versuchte sie durch List den Knaben, der ihr am meisten zuwider war, zu verderben.
Sie tat ihm nun schön, gab ihm gute Worte und schmeichelte sich bei ihm ganz und gar ein. Der gute Knabe ahnte nichts Böses, nahm alle ihre Liebkosungen für bare Münze und war ihr in allem willfährig.
Da sprach sie eines Morgens zu ihm: »Du könntest mir eine große Freude machen, wenn du mich wirklich gern hast.« Der Knabe fragte sie, was er tun sollte, und sie antwortete: »Wenn du in den Wald hinaus gingest, den Vogel Phönix zu holen, wärst du der bravste Bursche auf der Welt.«
Dies sagte sie, weil sie wohl wußte, daß es dem Burschen unmöglich sein werde, und weil sie hoffte, der Knabe werde im Wald, der von wilden Tieren wimmelte, zerrissen und aufgefressen werden.
Der Knabe nahm seine Joppe und seinen Strohhut und ging guter Dinge in den finsteren Forst hinaus. Er war voll Freude und sah auf jeden Baum hinauf, in der Meinung, es könnte darauf der Phönix nisten. So war er schon eine gute Strecke gewandert, und der Wald wurde immer dichter. Uralte Bäume standen so dicht, daß ihre bemoosten Äste ineinander griffen und undurchdringliche Gehege bildeten.
Da war guter Rat teuer, und dem Knaben fiel das Herz in die Hosen. Er fing an sich zu fürchten und wußte nicht mehr wo ein und wo aus. Wie er so ratlos da stand, kam ein Fuchs daher geschlichen, der einen ellenlangen Schweif nachzog und gar pfiffig drein schaute.
Als er ganz in die Nähe des Knaben gekommen war, fing er an zu reden und sprach: »Ich weiß wohl, du willst den Vogel Phönix. Wenn du aber mir nicht folgst, so wirst du den Wundervogel nie bekommen.«
Der Knabe konnte sich über den redenden Fuchs nicht genug wundern, und ihm kam die ganze Sache nicht geheuer vor; doch folgte er dem Fuchs, der sich oft nach ihm umsah. Als sie so eine Strecke schweigend fort gewandert waren, kamen sie zu einem ungeheuren Strom, der hoch und wild einherging.
»Da drüben hat der Phönix sein Nest«, sprach der Fuchs, als sie am Ufer standen. »Da hinüber mußt du, obwohl keine Brücke ist. Doch das macht nichts, wenn du nur Mut hast. Hänge du dich nur an meinen Schweif und halte dich an ihm fest, dann sollst du glücklich hinüber kommen. Läßt du aber den Schweif los, wirst du unrettbar verloren sein.«
Der Knabe hängte sich nun an den Schweif des Fuchses, und dieser sprang in den Fluß hinein und schwamm lustig durch das Wasser. Ehe man's erwartet hätte, standen beide, freilich durchnäßt wie eine getaufte Maus, am jenseitigen Ufer. Da ragte ein steiler Felsen empor und daran hing, wie hinauf geklebt, das Nest, aus dem drei junge Phönixe herausguckten.
»Siehst du«, sprach der Fuchs, »das Nest dort oben? Da mußt du nun hinauf und von den drei Jungen dasjenige holen, das in der Mitte ist. Würdest du aber ein anderes erwischen, müßtest du sterben.«
Der Knabe kletterte nun hinauf wie eine Spinne, packte den bezeichneten Phönix und brachte ihn glücklich herunter. Nun ging es an die Rückfahrt. Der Knabe hängte sich wieder an den Schweif des Fuchses, und dieser schwamm wieder durch das wilde Gewässer ans Ufer. Dann geleitete er den Knaben durch den wilden Wald bis zum Feld, und erst hier verließ er ihn.
Dem Burschen war jetzt Katzen wohl, weil er das Schloß wieder sah, und er eilte mit der größten Freude darauf zu. Dort angekommen, lief er jubelnd zur Wirtschafterin und gab ihr den Phönix. Diese nahm den Vogel an, lächelte und lobte den Burschen, obwohl ihr Herz vor Gift und Galle schwoll.
Nachdem ihr der erste Versuch, den Knaben zu verderben, mißlungen war, sann sie einen neuen Plan aus, ihn los zu werden. Dazu bot sich bald eine Gelegenheit. Der Graf wurde krank, so schwer, daß der herbeigerufene Doktor die Sache sehr bedenklich fand. Er zuckte die Achseln, räusperte sich und sprach sich endlich dahin aus, dem Kranken könne nur durch das Wasser des Lebens geholfen werden.
Die böse Wirtschafterin ging nun zum Knaben und trug ihm auf, das Wasser des Lebens zu holen. Sie wußte wohl, mit wie vielen Gefahren und Beschwerden dies verbunden sei, und hoffte deshalb, daß der Knabe darob zugrunde gehen werde.
Der Knabe war guter Dinge und machte sich gleich auf die Füße, um in der Ferne das Wasser des Lebens aufzusuchen. Er ging wieder in den Wald und dort immer weiter gegen Sonnenaufgang. Als er schon eine gute Strecke gegangen war, begegnete ihm wieder der Fuchs und fragte ihn: »Wohin gehst du?«
»Ich muß das Wasser des Lebens holen«, erwiderte der Knabe, »denn der Graf ist sterbenskrank.« »Da hast du eine halsbrecherische Arbeit«, versetzte der Fuchs. »Doch sei getrost; wenn du mir folgst, soll es gut enden.« Der Fuchs ging nun voraus, und der Knabe folgte.
Drei lange Tage wanderten sie ohne ein Wörtchen zu reden durch den stockfinsteren Wald. Da begann sich endlich das Dickicht zu lichten, und sie sahen vor sich einen Teich. Da sprach der Fuchs: »Dies ist der Teich des Lebenswassers, daraus mußt du schöpfen.
Ein Drache bewacht aber das Wasser, und diesen müssen wir täuschen. Ich werde ihn necken, bis er mich verfolgen wird, und dann mußt du, sobald er mir nacheilt, zur Stelle sein, das Wasser schöpfen und flüchten; denn würde er dich erreichen, so wärst du ein Kind des Todes.«
Der Fuchs ging nun wie verabredet voraus und näherte sich dem Drachen, der sich am Gestade sonnte. Sobald die wilde Bestie den Fuchs sah, fuhr sie auf ihn los und verfolgte ihn voll Zorn. Der Knabe schlich sich indessen zum Teich, füllte sich den Krug schnell mit Wasser und eilte über Stock und Stein auf der anderen Seite davon.
Er war noch nicht lange gelaufen, da kam ihm der Fuchs nach und führte ihn aus dem finsteren Wald. Wie sie am Ende des Forstes waren, nahm der Fuchs Abschied, sagte jedoch, daß sie sich bald wiedersehen würden. Der Knabe eilte nun auf das Schloß, wo der todkranke Graf schon in den letzten Zügen lag.
Er röchelte schon, und seine Augen waren fast gebrochen. Man gab ihm nun vom Lebenswasser ein - und siehe! Kaum hatte er einen Tropfen davon auf die Zunge gebracht, so sprang er gesund aus dem Bett und fühlte sich stärker und besser als jemals zuvor.
Der Graf hatte seit dem den Knaben noch lieber und hütete ihn wie seinen Augapfel. Das ärgerte die Schwester der verstorbenen Gräfin noch mehr, und sie beschloß aufs neue, den Knaben zu verderben. Sie schmeichelte ihm mehr als je, liebkoste ihn und gewann ihn ganz für sich.
Da sprach sie eines Tages zu ihm: »Wenn du mir die schönste Blume der Welt holtest, würdest du mir die größte Freude machen, und ich würde dich noch lieber haben als jetzt.« Sie dachte sich aber, wenn ich ihn um die schönste Blume der Welt schicke, dann weiß Gott, wie weit er gehen wird, und sicherlich wird er nicht mehr zurückkehren.
Der Knabe nahm die Rede der Frau für bare Münze, griff zu seinem Stock und machte sich auf, die schönste Blume der Welt zu suchen. Er ging wieder in den dunklen Wald hinaus, wo der Fuchs schon auf ihn wartete. »Wohin geht heute dein Weg?« fragte er den Knaben.
Dieser antwortete: »Ich soll die schönste Blume auf der Welt holen und weiß nicht, wo sie zu finden ist.« »Da hast du keine leichte Aufgabe«, versetzte der Fuchs, »denn sie ist weit weg von hier. Wenn du sie erreichen willst, so mußt du dich auf mich setzen, denn sonst würdest du vor Mattigkeit erliegen, ehe du zur Blume kommst.«
Der Knabe ließ sich den Rat nicht zweimal geben, schwang sich auf den Fuchs und ritt so schnell dahin wie auf dem besten Reitpferd. In Eile ging es über Stock und Stein, Distel und Dorn, und alle Bäume schienen rückwärts zu laufen.
Nachdem er lange, lange Zeit im Saus fort geritten war, kamen sie zu einem großmächtigen Fluß. Da stieg der Knabe ab, hängte sich wieder dem Fuchs an den Schwanz und schwamm so an das jenseitige Ufer wie früher. Dann ging es wieder querfeldein, bis man zu einem zweiten Fluß kam. Da stieg der Knabe wieder ab, hängte sich dem Fuchs an den Schwanz und schwamm an das jenseitige Ufer.
Als sie dort angekommen waren, ging es wieder querfeldein, bis sie zu einem dritten Fluß kamen, der viel breiter und tiefer als die zwei früheren war. Er stieg wieder ab und übersetzte das Wasser wie früher. Als sie wieder das jenseitige Ufer erreicht hatten, kamen sie zu einem Baum, der gar hoch und schön war. An ihm hingen drei Blumen, die in schönster Blüte standen und so schön waren, daß man sich nichts Schöneres denken kann.
Wie der Knabe ganz geblendet von der Pracht der Blumen da stand und sie in einem fort angaffte, sprach der Fuchs: »Siehst du, wir sind nun an der Stelle. An diesem Baum sind die schönsten Blumen der Welt. Steig nun hinauf und hol dir eine herunter. Nimm aber nicht die größte und schönste, denn ihre Blätter würden bald abfallen; nimm auch nicht die kleinste, denn diese würde bald verwelken.«
Der Knabe kletterte nun rasch den Baum empor und pflückte die Blume, die ihm bezeichnet war. Froh stieg er dann vom Baum und trat den Rückweg an. Das war ein saures Stück Arbeit. Es mußten wieder die drei großen, breiten Flüsse durchschwommen und der lange beschwerliche Ritt über Stock und Stein gemacht werden.
Der Knabe war aber des ungeachtet guter Laune, denn er brauchte nur die prächtigste Blume anzublicken, und es lachte ihm das Herz im Leibe. Nachdem er sieben Tage geschwommen und geritten war, kamen sie endlich an das Ende des Waldes zurück. Da stieg der Knabe ab, dankte dem guten Tier und nahm von ihm Abschied. Der Fuchs sprach auch ein Lebewohl, sagte, daß sie sich in kurzer Zeit wiedersehen würden, und verschwand im Wald.
Der Knabe machte nun hurtige Füße und eilte auf das Schloß, daß ihm der Schweiß über die Wangen rann. Jubelnd sprang er zur Frau und brachte ihr die schönste Blume der Welt. Diese hatte aber keinen kleinen Schrecken, als der Bub heil und gesund zurückkam.
Eine desto größere Freude hatte aber der Graf, als er den so herzlich geliebten, guten Knaben, den er schon verloren glaubte, wiedersah. Er herzte und küßte ihn und ließ ihm zu essen und zu trinken bringen, was der Tisch nur zu tragen vermochte.
Als der Knabe sich gestärkt und ausgeruht hatte, da führte ihn der Graf mit sich auf sein Zimmer, nahm ihn dann bei der Hand und sprach zu ihm: »Du bist mein größter Wohltäter, denn du hast mir das Leben gerettet. Ich will nicht undankbar sein und dir deine Tat gräflich belohnen. Wenn du mir noch ein Rätsel, das ich dir geben werde, lösen kannst, so werde ich dich zu meinem Erben einsetzen und deine Schwester zu meiner Frau machen.«
Wie der Phönix, der sich in einem prächtigen Vogelhaus im Zimmer befand, dies hörte, fing er zu singen an:
»Gib nur dem Sohn das Gut,
Doch heirat nicht dein eignes Blut!«
Der Gesang des Phönix wurde aber nicht beachtet, und der Knabe verlangte die Aufgabe zu hören. Als der Junge auf seinem Begehren bestand, sprach der Graf: »Binnen drei Tagen sollst du mir sagen, warum ich so traurig bin.« Die Frage kam zu unerwartet, und der Knabe wußte sich keinen Rat. Zwei Tage lang sann er umsonst auf die Lösung dieser Frage und konnte keine Antwort finden.
Als er keinen Rat wußte, erinnerte er sich an den Fuchs und lief als bald in den Wald hinaus. Er war noch nicht weit gegangen, als ihm der Fuchs begegnete. Er grüßte ihn und legte ihm das Rätsel,
das ihm der Graf aufgegeben hatte, vor.
Darauf antwortete der Fuchs: »Sag dem Grafen, ihn mache die Sorge, daß er seine Frau zu voreilig verurteilt habe, so schwermütig.«
Dann nahm er von dem Knaben Abschied, legte die Vorderfüße auf dessen Schultern, leckte ihm den Mund und bat ihn, recht bald wiederzukommen. Der Knabe versprach ihm dies hoch und teuer, und dann trabte das Tier in den Wald zurück.
Der Knabe eilte auch auf das Schloß zurück und lief stracks zum Grafen. »Kannst du nun dein Rätsel lösen?« forschte der Graf. »Ja«, antwortete der Knabe. »Die Sorge, daß Ihr Eure Frau zu voreilig verurteilt habt, macht Euch so trüb und schwermütig.«
Als der Graf dies gehört hatte, fühlte er tief, daß der Knabe die reinste Wahrheit sagte, und sprach zu ihm: »Du hast recht und bist ein so kluges Kind, daß man niemand deinesgleichen finden kann. Du sollst deshalb mein Erbe sein, und deine Schwester will ich als meine Braut zum Altar führen.«
Der Phönix war wieder im Zimmer und hörte diese Worte. Da begann er wieder zu singen:
»Gib nur dem Sohn das Gut,
Doch heirat nicht dein eignes Blut!«
Wie der Graf dies hörte, war er nicht wenig überrascht, denn es schien ihm gar absonderlich, daß ein Vogel sprechen könnte. Er staunte noch lange und fragte endlich den Knaben, wie er zu diesem Wundervogel gekommen war. Dieser erzählte ihm, wie er auf Befehl der Schloßfrau den Vogel holen mußte und welche Abenteuer er auf dieser Fahrt bestanden habe.
Da kam dem Grafen dies alles und die Rede des Vogels so wunderlich vor, daß er auf der Stelle seine Schwägerin zu sich kommen ließ und ihr den Vorgang mit dem Vogel erzählte. Als sie die Reime, die der Phönix gesungen hatte, hörte, war sie sehr betroffen und wurde bald rot wie Glut, bald bleich wie Wachs.
Sie glaubte, ihre Frevel seien verraten, fiel vor dem Grafen auf die Knie und bekannte ihm alles, was sie verschuldet hatte. Es schien nun sonnenklar, daß der Knabe und das Mädchen die Kinder des Grafen waren. Er umarmte seine wieder gefundenen Lieben, drückte sie an die Brust, küßte und liebkoste sie. Dabei weinte er so vor Freude, daß eine Träne der anderen folgte.
Nachdem die erste Freude des Wiedersehens vorüber war, ging der Graf ernst und feierlich auf seine Schwägerin zu und sprach das Todesurteil über sie aus, das auch als bald vollstreckt wurde.
Der Graf und seine Kinder lebten nun glücklich beisammen. Da dachte eines Tages der junge Graf wieder an den Fuchs, dem er all sein Glück zu verdanken hatte. Er nahm nun Hut und Waffen und ging in den Wald, um dort seinen Wohltäter aufzusuchen.
Er war noch nicht lange gegangen, als ihm der Fuchs schon entgegen kam, ihm die Hände leckte und recht freundlich tat. Der Fuchs ging wieder als Wegweiser voraus, und der junge Graf folgte ihm. Es ging weit, weit in den Wald hinein, bis sie zu einer schönen Wiese kamen.
Da machte der Fuchs plötzlich halt und sprach mit bittender Stimme: »Ich habe dir schon viel Gutes erwiesen, nun tue auch mir etwas zum Dank.« Wie der junge Graf dies hörte, war er gleich bereit, alles, sei es auch noch so schwer, für seinen Wohltäter zu tun, und fragte ihn, was er wolle.
Da antwortete der Fuchs: »Ich bitte dich bei allem, was dir heilig ist, schlage mich tot!« Der Graf war über diese unerwartete Rede betroffen und sprach: »Wie sollte ich das tun und dich, dem ich alles verdanke, töten können?«
Der Fuchs ließ aber von seinem Begehren nicht ab und bat inständig, er möchte ihn doch erschlagen. Da konnte der Grafensohn nicht länger den Bitten widerstehen, nahm sich ein Herz, ergriff in Gottes Namen einen Prügel und versetzte mit abgewandtem Gesicht dem Tier einen Schlag auf den Kopf.
Kaum hatte er dies getan, so hörte er einen Freudenschrei, und als er sich umsah, erblickte er eine bildschöne Frau vor sich. Sie eilte mit offenen Armen auf ihn zu, umarmte, küßte und herzte ihn. Wie er da stand und nicht wußte, wie ihm geschah und er große Augen darob machte, öffnete sie den Mund und sprach:
»Lieber Sohn, wie sollte ich dir genug meinen Dank und meine Freude ausdrücken können! Du bist es ja, der mich von der Verwünschung meiner bösen Schwester befreit hat.«
Dem Grafen war nun alles klar, und als er seine erlöste Mutter vor sich sah, kannte er kein Maß des Glückes mehr, er weinte vor Freude, und in seinem Herzen schlug und pochte es wie in einer Schmiede. Nachdem die erste Freude vorüber war, dachten sie erst an die Ihrigen.
Froh eilten sie dann dem Schloß zu, wo sie den Grafen und die Grafentochter im Garten fanden. Da hättest du die Freude sehen sollen, als der edle Herr seine tot geglaubte schöne Frau wiedersah und in seine Arme schloß!
Da gab es nun ein Fest, wie seit Menschengedenken keines gefeiert worden ist.
Seitdem lebte die Grafenfamilie glücklich beisammen, teilte Freude und Wohl, bis sie der Tod nach langer, langer Zeit schied.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Obermiemingen
VOM REICHEN RITTER UND SEINEN SÖHNEN ...
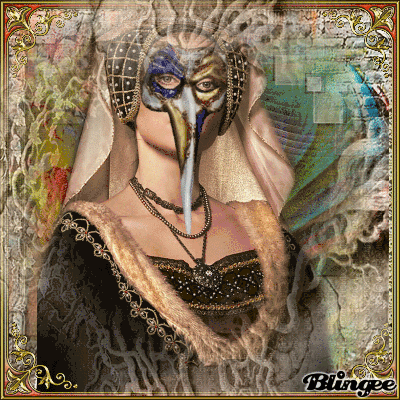
In alter Zeit, als die Männer noch eiserne Hemden und lange Schwerter trugen, lebte ein starker Ritter, der hieß Sehrreich, weil er im ganzen Land als der Reichste galt. Er wohnte mit seinen drei Söhnen Veit, Jörg und Hans oben auf seinem Schloß, und wenn auch sonst niemand bei ihnen war als nur wenige Diener, so waren doch alle voll Frohsinn.
Wollte aber manches Mal die Langeweile als unwillkommener Gast sich einschleichen, da war das rechte Mittel gleich zur Hand, und es wurden Rehe und Hirsche im weiten Forst so lange gejagt und gehetzt, bis sie verschwand. Denn Reh und Hirsch und Pfeil und Bogen, das waren des Ritters Lieblingsworte, und das Jagen gab ihm immer gute Laune.
Da war es einmal an einem schönen Sommermorgen, daß der Ritter und mit ihm seine Söhne mit allen Dienern fröhlich zum Schloßtor hinaus in den Wald ritten, um sich einen Abendschmaus zu erjagen. Das war den ganzen Tag über ein Jauchzen und ein Schmettern der Jagdhörner, ein Kläffen und Bellen der Hunde, daß es schien, es sei für die armen Rehlein der letzte Tag gekommen.
Als aber die Sonne hinter den grünen Tannen hinab gesunken war, da verstummte auch plötzlich das Gejaid, und wie am Himmel die ersten bleichen Sterne flimmerten, da trug man den Ritter ohnmächtig und blutend durch das Schloßtor; sein scheues Roß hatte ihn abgeworfen, und dieser Sturz war für ihn die Ursache des Todes. Schon am anderen Tag war er nicht mehr.
Nun standen die drei Junker ganz allein in der Welt und wußten vor Traurigkeit nicht, was anfangen. Die Mutter war schon früh, als sie noch Kinder waren, gestorben. Jetzt war auch der Vater tot, von dem sie glaubten, daß er ihnen großen Reichtum hinterlassen habe.
Doch gern hätten sie alles her gegeben, wenn nur der Vater noch lebte. Sie wollten und mußten nun in die weite Welt hinaus. Daher beschlossen sie, die Burg dem treuen Wartel zu übergeben und dann fortzuziehen. Ehe sie jedoch den Sitz ihrer Väter verließen, gedachten sie einen Teil der väterlichen Schätze unter sich zu teilen.
Aber wie groß war ihr Erstaunen und ihr Schrecken, als sie nirgends im ganzen Schloß die gesuchten Schätze fanden, obwohl sie Kisten und Kästen von oben bis unten durchsucht und jeden Winkel durchstöbert hatten und wußten, daß ihr Vater seines Goldes wegen Sehrreich hieß. Nur eine alte, wurmstichige Kiste hatten sie unbeachtet gelassen.
Was war nun zu beginnen? Noch einmal durchsuchten sie alles, und diesmal fiel ihnen auch die alte, wurmstichige Truhe auf. Sie öffneten sie und fanden in ihr drei Abteilungen. In der ersten lag ein kleines Pfeifchen, in der zweiten ein grünes Hütlein und in der dritten ein kleiner Ring. Sonst war fast ganz und gar nichts zu finden.
Diese drei Stücke wollten sie als Andenken an ihren Vater und ihre Heimat mit sich auf die Fahrt nehmen. So nahm denn der jüngste das Pfeifchen, der andere das Hütlein und der dritte den kleinen Ring. Die wenigen Taler, die sie fanden, steckten sie zu sich, jeder ließ sich ein Pferd satteln, und dann ritten sie fort.
Am zweiten Tag gegen Abend kamen sie zu einem großen Wald, in dessen Nähe am Weg eine ärmliche Schenke stand. Hier beschlossen sie einzukehren und zu übernachten. Als sie so am Tisch saßen, fiel dem jüngsten Bruder ein, seinen zwei Brüdern, weil sie gar so traurig waren, ein Stückchen vorzublasen.
»He«, meinte er, »ich muß doch versuchen, was mein Pfeifchen für einen Ton gibt?« Er zog es aus der Tasche und blies. Urplötzlich stand ein alter, grauer Ritter, ganz in Eisen gehüllt, vor ihm und fragte lächelnd: »Was will der Herr, was schafft der Herr?«
Die Frage klang freilich unter allem am schönsten für den jungen Ritterssohn. »Ja, wenn's nur aufs Schaffen ankommt«, sagte er lachend, »so schaff' ich fürs allererste einen Säckel voll Geld, so groß wie ein Roßkopf.« Der alte Ritter brachte augenblicklich das Verlangte und war dann so schnell, wie er erschienen war, auch wieder verschwunden.
Jetzt versuchten die anderen das selbe, schwenkten das Hütlein und drehten den Ring, und es zeigte sich der gleiche Erfolg. Nun war es ihnen klar, woher der Vater sein Geld genommen hatte, aber nach Hause wollten sie nicht zurückkehren, sondern zogen nun wohlgemut weiter.
Als sie nach einigen Stunden den Wald im Rücken hatten, teilte sich die Straße nach drei verschiedenen Richtungen hin. Sie hielten still und besprachen sich, was sie tun sollten, sich trennen oder noch mitsammen weiter reiten. Das erste schien ihnen das beste, und so gaben sie sich einander das Wort, übers Jahr sich in der Waldschenke wieder einzufinden, und nahmen voneinander Abschied.
Junker Hans, so hieß der jüngste, spornte sein Rößlein, sah noch einige Male nach den Brüdern zurück, bis sie ihm aus dem Auge verschwanden, und trabte dann in Gedanken vertieft fort. Sein Weg führte ihn über Hügel und Halden, durch Feld und Wald, durch Flecken und Dörfer bis zu einer prachtvollen Hauptstadt, der Residenz des Königs.
Staunend über die Pracht der Gebäude ritt er durch das hohe, fest gemauerte Stadttor ein und begab sich in ein großes, schönes Gebäude, über dessen Tor eine mächtige, goldene Flasche hing, denn er dachte, weil der Herr des Hauses goldene Flaschen heraushängen könne, werde er auch Weinflaschen und Wein vorrätig haben.
Er hatte richtig gedacht, und der treffliche Rote machte ihn gar lustig und munter. Da hörte er unten auf der Straße ein Hochrufen und ein Rasseln von Wägen. Er sprang ans Fenster und sah einen prachtvollen Wagen mit vier Schimmeln bespannt, umgeben von schmucken Reitern, durch die Straße fahren.
»So einen Wagen und solche Schimmel muß ich auch haben«, rief er, blies in sein Pfeifchen, und sogleich stand der graue Ritter wieder da und fragte ihn: »Was will der Herr, was schafft der Herr?«
»Einen solchen Wagen und solche Schimmel«, war die Antwort, »wie der König hat, der eben vorüber fuhr.« Darauf sprang er die Stiege hinab vor das Einfahrtstor der Herberge Zur Goldenen Flasche und fand alles schon bereit. Das freute ihn ungemein; aber aus Furcht vor dem König ließ er für heute die Rosse abspannen und fuhr erst am anderen Tag aus.
Da nun alles Volk meinte, er sei der königliche Prinz, rief es: »Hoch!« und drängte sich rings um den Wagen, was dem jungen Ritter ungemein gefiel. Als der König erfuhr, daß ein anderer auch königlich geehrt werde, war es ihm zuviel, und er fuhr demnächst mit sechs Schimmeln und in einem noch prächtigeren Wagen aus.
Hans tat es ihm auch diesmal nach und ließ sogar Geld unter das Volk werfen. Neugierig, woher denn der Fremde so viel Geld nehme, so vornehm zu tun, und zornig zugleich über dessen Keckheit, ließ der König ihn zu sich in den Palast rufen, verbarg seinen Ärger, nannte ihn einen Fürstensohn und sagte ihm allerhand Schmeicheleien. Endlich lud er ihn zur Tafel, zu der auch die Großen des Reiches und die Königstochter geladen wurden.
Die Königstochter war zwar sehr schön, jedoch auch sehr schlau, um den Unerfahrenen nur desto leichter in ihr Netz zu ziehen. Man setzte sich zu Tisch. Auch die Königstochter erschien in goldstrahlendem Schmuck - und um den jungen Ritter war's geschehen. Einige flüchtige Worte nach Tisch und süße Schmeichelreden der Königstochter und die Äußerung des Königs, er würde sich glücklich schätzen, ihn seinen Eidam nennen zu können, reichten hin, den Verblendeten ins Garn zu locken und den Vogel einzufangen.
Man wies ihm prächtige Zimmer im königlichen Palast an, ehrte ihn wie einen Fürsten und schien alle Aufmerksamkeit nur ihm allein zu schenken. Und die Königstochter verstand es erst gar, ihn zu berücken! Das zweite Wort, wenn sie mit ihm sprach, war immer: »Mein goldener Bräutigam!« Ihr schien er alles in allem zu sein.
Schon waren so drei Vierteljahre vorüber gegangen, und Hans befand sich sehr wohl bei seiner Braut in seinen schönen Träumen. Trotz aller Fragen hatte er sich jedoch immer sehr sorgfältig gehütet, die Quelle seines Goldflusses zu verraten, bis ihn eines Tages die Königstochter, als beide im Garten lustwandelten, fast traurig und schüchtern fragte:
»Mein lieber Bräutigam, was hat dir wohl deine Braut getan, daß du ihr noch immer etwas verheimlichst, was sie gar so gerne wissen möchte, und so gleichgültig bist bei ihrer Trauer?« Das war zuviel für ihn. »Nein, du darfst nicht traurig sein«, rief er, »wenn ich dich froh machen kann!«
Nun erzählte er ihr alles von seinem Vater und seinen Brüdern und was es für eine Bewandtnis mit dem Pfeifchen habe. Zuletzt ließ er die feine Braut sogar selbst versuchen, wie gehorsam der alte, graue Ritter auf den Ruf des Pfeifchens da stehe. Die aber hatte kaum ihren Zweck erreicht, als sie ganz anders zu reden anfing, nach Dienern und ihrem Vater rief und dem verdutzten Hans allerhand Grobheiten ins Gesicht sagte.
Die herbeigeeilten Höflinge spöttelten und lachten über den reichen Fürstensohn, die Königstochter blies fleißig auf dem Pfeifchen und ließ den Eigentümer durch Schergen fort schaffen. Fast ohne zu wissen, wie es zugegangen war, stand der Betrogene am Stadttor, durch das er einst eingeritten war. Es schien ihm, als sei er vom Himmel in die Hölle gefallen, und er ärgerte sich blau und blaß über seinen schlecht abgelaufenen Handel.
Nur eine Hoffnung blieb ihm noch: das Jahr war bald zu Ende, und er konnte zu den Brüdern nach der Waldschenke zurückkehren. Wenn er sich auch vor ihren Vorwürfen fürchtete, machte er sich doch auf, bald zu ihnen zu gelangen und vielleicht mit ihrer Hilfe das verlorene Pfeifchen wieder zu erhalten.
Nach wenigen Tagen kam er ganz ermüdet bei der alten Schenke an und fand da selbst wirklich seinen Bruder Jörg lustig und guter Dinge, der älteste Bruder Veit war noch nicht da, und er kam auch nicht, noch konnte man von ihm Nachricht erhalten.
Wie nun Hans staubbedeckt und traurig eintrat und alles erzählte, da schimpfte Jörg gewaltig auf ihn los. »Dacht' ich's mir ja«, schmähte er, »du würdest Narr genug sein, in jede Falle einzugehen und an jedem Köder anzubeißen! Du weißt auch gar nicht, wie du die Sache anfangen mußt. Unsereiner läßt es sich wohl sein wie ein König und kümmert sich dafür wenig um Königstöchter, so kann aber unsereiner auch jetzt das Wünschhütlein schwingen. Daß du ins Garn liefst, wundert mich wenig; aber wo nur etwa Veit bleiben mag? Er ist gewiß auch in die Falle gegangen.«
Hans versicherte, nachdem er zu Atem gekommen war, sein Pfeifchen gewiß wieder zu erhalten, wenn der Bruder ihm sein Hütlein nur leihen wollte, und bat so lange, bis Jörg, den das Bitten sehr verdrießlich machte, endlich nachgab und ihm wie wohl ungern das Hütlein lieh, jedoch mit der Drohung, sofern er es nicht wiederbringe, dürfe er ihm nicht mehr unter die Augen kommen.
Einen Tag lang hielt Hans Rast, dann wanderte er wieder durch Fluren und Felder, über Höhen und Halden zur fernen Königsstadt hin und überbot den König weit bei jedem öffentlichen Aufzug. Der aber hatte kaum gemerkt, daß der Fremde wieder hier sei und vielleicht wieder ein Pfeifchen oder sonst etwas habe, sein Geld zu vermehren, als er ihn rufen ließ und zur Tafel lud.
Hans kam aber diesmal nicht, sondern ließ dem König sagen, er werde den Weg zur Stadt hinaus schon selbst finden; man brauche ihn nicht wieder zu foppen und nachher hinauszujagen. Da bemühte sich die Königstochter selbst zum neu angekommenen Ritter und tat so schön und bat um Vergebung, daß Hans, wie verzaubert, sie nicht mehr verlassen konnte.
Alle seine guten Vorsätze waren zu Wasser geworden, und es ging ihm, wie es ihm schon früher ergangen war. Einige Wochen waren verflossen, und er stand wieder traurig am Stadttor und hatte weder Pfeifchen noch Hütlein. Was war nun zu tun? Seine Goldquelle war versiegt, und zu seinem Bruder durfte er nimmer zurück.
Das beste schien ihm, sich an einen Baum zu knüpfen, denn sein Schwert hatte man ihm genommen. Gerade sah er nicht weit vor sich auf einem Hügel zwei Bäume, und es war ihm recht, daß er nicht lange zu suchen brauchte. Er ging, bestieg den Hügel, und als er oben war, sah er sich die Bäume erst recht an und bemerkte, daß beide voll der schönsten Birnen hingen. An einem hingen schöne und ungewöhnlich große und am anderen kleine.
»Zum Sterben ist's noch immer Zeit, ich will einmal versuchen, wie die Birnen schmecken.« Mit diesen Worten stieg Hans auf den Baum, der voll der schönsten Birnen hing, und aß davon ein halbes Dutzend, weil sie außergewöhnlich süß waren. Als er wieder herabstieg, merkte er, daß seine Nase um sechs Spannen länger geworden war, und erschrak gewaltig.
Nun versuchte er, was die kleinen Birnen für eine Wirkung haben würden. Nachdem er auch von ihnen ein halbes Dutzend verkostet hatte, war seine lange Nase verschwunden. Jetzt fiel Hans etwas ein. Er dachte: Wie stände etwa der Königstochter eine sechs Spannen lange Nase an? Wart, die schöne Hexe will ich dran kriegen.
Das Aufknüpfen war für jetzt aufgeschoben. Er ging in die Stadt, tauschte mit einem Bettler sein Gewand, nahm ein Körblein und füllte es mit großen Birnen von seinem Birnbaum. Darauf setzte er sich auf den Marktplatz und rief immer: »Kauft Birnen!« Wenn aber jemand welche kaufen wollte, verlangte er für je sechs eine ungeheure Summe.
Das war sehr auffallend, und als der König durch einen seiner Diener den ungeheuren Preis erfuhr, kaufte er auch sechs, besonders weil seine Tochter es verlangt hatte. Hans aber lachte und machte sich mit gefülltem Beutel aus dem Staube.
Der Königstochter mundeten die Birnen so ausgezeichnet, daß sie alle nur allein aß und erst zuletzt die unliebsame Veränderung merkte, die an ihr vorgegangen war. Vor Schrecken fiel sie in Ohnmacht, und in der ganzen Stadt und im ganzen Land wurde schnell die Nachricht laut vom sonderbaren Unglück der Königstochter.
Jeder Heilkundige und wer nur immer einen Rat geben konnte oder ein heilsames Kräutlein wußte, wurde befragt und hatte freien Zutritt beim König zu jeder Stunde; aber alle zuckten die Achseln und sagten, die Prinzessin müsse ihre Nase wohl zeitlebens behalten. Das war ein Weinen und Klagen im Königspalast, als ob das ganze Reich ein übergroßes Unglück getroffen hätte.
Auch Hans hatte gehört, daß jeder Zutritt beim König habe. Er kleidete sich wie ein reicher Doktor und ließ sich, sobald er sechs große und sechs kleine Birnen verbrannt und zu Pulver gestoßen hatte, bei der Königstochter melden. Er wurde freudig empfangen, tat sehr gelehrt und machte der Königstochter gute Hoffnung.
Wirklich wurde ihre Nase auf ein Pülverchen aus den kleinen Birnen um eine Spanne kürzer, und die Freude darüber war ganz unbeschreiblich. Am anderen Tag gab er ein Pülverchen von den großen Birnen, und die Nase wurde wieder so lang wie früher.
Der Doktor aber entschuldigte sich, er sei zu rasch zu Werke gegangen im Eifer, die Heilung zu beschleunigen, aber es würde schon wieder recht werden. Er gab ihr nun nach und nach immer täglich ein Pülverchen von den kleinen Birnen, und in einer Woche war sie vollkommen hergestellt.
In der ersten Freude über ihre Genesung gab sie dem Doktor das verlangte Pfeifchen und das Hütchen, denn sie hielt keine andere Belohnung für angemessener als diese.
Nun wollte der Herr Doktor als bald abreisen und gab der Königstochter unter dem Vorwand, die Nase auch von innen vollkommen zu heilen, die übrigen Pülverchen von den großen Birnen, die sie aber erst nach etwa drei Tagen nehmen dürfe.
Ehe der hochverehrte, kunsterfahrene Mann abreiste, durfte er sich eine Gnade ausbitten, und der schlaue Hans bat den König, ihm ein schnelles, sehr schönes Pferd zu geben, wovon er ein besonderer Liebhaber sei.
In einer Stunde war Hans fort - und nach drei Tagen hatte die Schöne wieder ihre sechs Spannen lange Nase. Der Herr Doktor aber saß schon bei seinem Bruder Jörg voll guter Laune in der Waldschenke.
Jetzt erst fiel es dem König ein, das könne wohl gar Hans selber gewesen sein, der diesen Streich gespielt hatte. Er ließ mit vielen Soldaten dem Doktor nachjagen, und wirklich erreichten sie ihn in der Schenke und wollten ihn festnehmen und mit sich fortführen.
Hans und Jörg hatten sie kommen gesehen und merkten bald, worauf es abgesehen sei. Da blies Hans in sein Pfeifchen, und schnell war der Ritter da mit seinem »Was will der Herr?« »Noch einmal soviel als diese! Ausjagen sollst du sie!« befahl Hans, und als bald geschah es, daß die Soldaten mit Schimpf abziehen mußten.
Bruder Veit kam nicht mehr zum Vorschein, Hans und Jörg aber zogen heim nach ihrem Schloß und lebten noch viele lange Jahre in Saus und Braus und erzählten ihren Kindern und Enkeln oft die Geschichte von dem Pfeifchen und der Königstochter und ihrem seligen Vater Sehrreich.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus dem Zillertal
DER GLÜCKLICHE SCHNEIDER ...
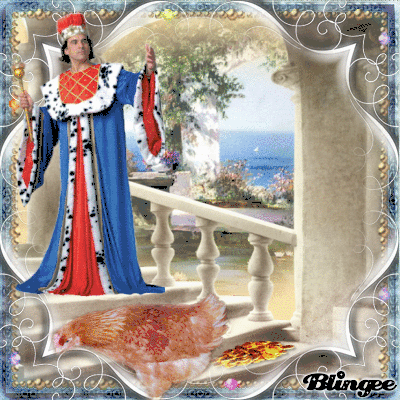
Es war einmal ein blutarmer Schneider, der kam auf den Gedanken, sein Schwein an den König zu verkaufen, um doch einen ehrlichen Preis dafür zu bekommen. Er fuhr also damit in die Hofburg, und da ihm gerade ein Bedienter in den Weg kam, erkundigte er sich, wieviel er etwa bei dem König für seine Ware verlangen dürfe.
»Verlange nur die gruselnde Henne«, antwortete ihm der Bediente. Der Schneider merkte sich das und ging zum König. Als ihn dieser fragte, was er denn wolle, sagte er ihm, daß er ein Schwein gebracht habe und es um die gruselnde Henne verkaufen möchte. Also gleich rief der König: »Gruselnde Henne! Zwig, zwig, zwig«, und es stand eine gelbgraue Henne vor ihm, die anfing zu legen und statt der Eier ein Häuflein Dukaten legte.
Dem Schneider gefiel das Tier ganz wohl, er ließ dem König das Schwein, nahm dafür die Henne und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs kehrte er in einem Wirtshaus ein und ließ sich recht wohl sein. Als es abends zum Zahlen kam, stellte der Schneider, weil er kein Geld in der Tasche hatte, die Henne auf den Tisch und sagte: »Zwig, zwig, zwig.« Als bald fing die Henne an zu legen und legte ein Häuflein Dukaten, womit der Schneider seine Zeche bezahlte.
Der Wirtin aber gefiel das Kunststück der Henne gar zu wohl, und während der Schneider schlief, nahm sie diese heimlich fort und stellte dafür eine andere hin, die der gruselnden ganz gleich sah.
Am anderen Morgen machte sich der Schneider wieder auf und wanderte rüstig der Heimat zu. Kaum hatte er den Fuß ins Haus gesetzt, da rief er nach seinem Weib: »Heute wohl, Alte, bring' ich etwas Schönes. Jetzt kann's uns nimmer fehlen! In etlichen Tagen haben wir Geld wie die Pallen.«
Das Weib zweifelte anfangs, ob ihr Mann recht bei Verstand sei, allein nach und nach wurde sie doch gläubig, und sie war neugierig zu sehen, was für eine Geldmühle der Mann mitgebracht habe.
Der Schneider machte nicht lange Worte, ging mit dem Weib in die Stube und stellte seine Henne auf den Tisch. »Zwig, zwig, zwig. Wirst sehn, Alte, jetzt kommt's.«
Die Schneiderin schaute fleißig auf die Henne, aber diese tat nichts anderes als gewöhnliche Hennen, reckte den Kragen nach allen Seiten hin und fing an zu gackern. Der Schneider meinte, das Goldlegen müsse bald angehen, doch alles Warten war umsonst. Da schämte er sich gewaltig vor seiner Frau und lief voll Unwillen auf und davon.
Er ging und ging, bis er wieder in den königlichen Palast kam. Hier begegnete ihm der Bediente, der ihm das vorige Mal den guten Rat gegeben hatte. Ihm erzählte er, wie es mit der Henne gegangen war, und fragte ihn, ob er denn beim König keinen Ersatz ansprechen könne.
»O ja«, antwortete der Bediente: »Geh du nur zum König und sag: 'Ich wünsche das Tuch, das hinter der Tür hängt.'« Der Schneider sagte sein Behüt' Gott und ging zu dem König. Diesem erzählte er wieder sein Mißgeschick mit der Henne und bat zum Ersatz um das Tuch, das hinter der Tür hing.
Der König rief sogleich: »Tafel deck dich!« Im Nu flog das Tuch hinter der Tür hervor, breitete sich über den Tisch und war voll der herrlichsten Speisen. Wie den Schneider der Braten so röselig anlachte und der feurigste Wein entgegen funkelte, da hatte er eine Freude, daß er darüber die Henne ganz vergaß.
Nachdem er genug getafelt hatte, räumte er das Übrige ab, legte das Tüchlein hübsch zusammen und steckte es zu sich. Dann nahm er vom König Abschied und ging wieder seiner Nase nach, bis er zu dem Wirtshaus kam, in dem man ihm die Henne gestohlen hatte. Als er in der Wirtsstube war, kommandierte er: »Tafel deck dich!«
Das Tüchlein flog aus dem Sack, breitete sich über den Tisch und stand voll der herrlichsten Speisen. Der Schneider setzte sich hin und aß nach Herzenslust. Die Wirtin hatte bei dieser Mahlzeit zugeschaut, und sie dachte daran, das kostbare Tüchlein in ihre Hände zu kriegen.
Als es Nacht war und der Schneider im tiefen Schlaf lag, ging sie in seine Kammer, suchte nach dem Tüchlein, steckte es schleunig zu sich und legte ein anderes an seine Stelle.
Des Morgens in aller Frühe machte sich der Schneider auf den Weg und marschierte aus Leibeskräften seiner Heimat zu. Kaum war er hinter der Haustür, so rief er schon seinem Weib: »Heda, schau, was ich heute mitgebracht habe! Wenn jetzt das Hausen nicht geht, dann ist der Kuckuck dran schuld!«
Das Weib lief ihm neugierig entgegen: »Was bringst du denn heut?« »Ein Tüchleindeckdich! Komm nur, wir wollen's gleich probieren.« Sie gingen beide in die Stube, und der Schneider rief: »Tafel deck dich!« Er wollte sich schon hinsetzen und nach dem Löffel greifen - aber der Tisch war Boden leer, und das Tüchlein steckte fein sauber im Sack.
Der Schneider schnitt ein Gesicht wie ein Essigpanzen, fing an zu fluchen und machte sich zur Tür hinaus. Schnurstracks lief er wieder in die königliche Burg, um von dem König Schadenersatz zu erlangen. Auf der Stiege begegnete ihm wieder der selbe Bediente, der ihm schon zweimal gut geraten hatte und auch diesmal auf seine Frage guten Bescheid gab. »Geh nur zum König«, sagte er, »und begehre den hölzernen Schlegel!«
Der Schneider bedankte sich und ging zu dem König. Er brachte seine Bitte vor, und der König rief: »Sack, öffne dich!« Augenblicklich sprang aus seiner Tasche ein hölzerner Schlegel und fing an, in der Luft herumzutanzen und herumzuschlagen, daß Schneider und König genug zu tun hatten, ihm auszuweichen.
Als der Tanz fertig war, steckte der Schneider den Schlegel in seine Tasche und nahm Abschied vom König. Auf dem Heimweg kehrte er wieder im nämlichen Wirtshaus ein, wo es ihm zweimal so übel ergangen war. Er setzte sich hinter einen Tisch, und die Frau Wirtin setzte sich zu ihm, um ein bißchen zu plaudern, denn bei den Weibsbildern muß das Maul eine Arbeit haben.
Der Schneider erzählte unter anderem, daß er heute etwas in der Tasche habe, was so gleich herausspringe, wenn er rufe: »Sack, öffne dich!« Die Wirtin faßte sogleich den Gedanken, dies sonderbare Ding in ihre Hände zu bekommen.
Als es Nacht war und der Schneider im Bett lag, schlich sie sich in seine Kammer und sagte: »Sack, öffne dich!« Kaum war das Wort aus ihrem Mund, so war auch der Schlegel aus dem Sack und trommelte so kräftig auf der Frau Wirtin herum, daß sie anfing zu schreien und zu jammern, als ob Feuer im Haus wäre.
Sie rief Mann und Knechte zu Hilfe und bat den Schneider inständig, er solle doch den Schlegel zurückkommandieren, sie werde ihm gerne die gruselnde Henne und das wunderbare Tüchlein zurückgeben.
Der Schneider gab ihren Bitten nach und bekam seine zwei Kostbarkeiten wieder. Lustig wanderte er dann nach Hause und erzählte seinem Weib, wie es ihm ergangen sei. Dann lud er alle, deren Schuldner er war, in sein Haus, bewirtete sie beim Tüchleindeckdich aufs herrlichste, ließ die Henne vor ihren Augen Dukaten legen und rief endlich den Schlegel aus dem Sack, der alle Gläubiger mauestot schlug.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DER SCHAFHIRT ...
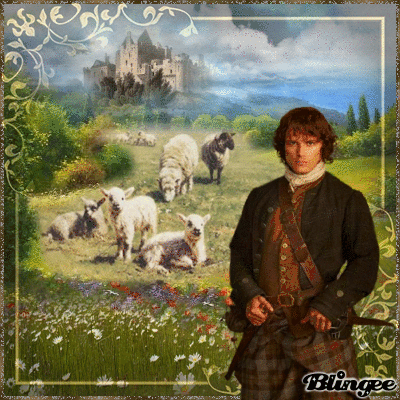
Ich weiß nicht, wie lange es etwa her ist, da lebten einmal ein Herr und eine Frau, die ein einziges Kind hatten. Dies war ein frischer Bursche, dem das Stillsitzen nicht taugen wollte. Schon in früher Jugend bat er seine Eltern, sie möchten ihm doch erlauben, in die Welt hinauszuziehen und sein Glück zu versuchen.
»Nein«, sprach der Vater, »bevor du nicht sechzehn Jahre alt bist, darfst du nicht fort, aber dann kannst du ziehen, wohin es dich gelüstet.« Der Sohn mußte sich fügen und wartete ungeduldig die Zeit ab, bis sein sechzehntes Lebensjahr verstrichen war. Er zählte die Tage und Stunden und richtete sich einstweilen alles zur Reise zurecht.
Als er das sechzehnte Jahr vollendet hatte, nahm er Abschied von den Eltern, setzte sich auf sein Pferd und ritt wohlgemut von dannen. Ohne Ziel und Plan ging es so fort in die weite Welt hinein, und je länger er ritt, desto besser wollte es ihm gefallen.
Eines Tages führte ihn der Weg durch einen stockfinsteren Wald. Wie er so gedankenlos dahin ritt, drang auf einmal der herrlichste Gesang an sein Ohr, so daß er still hielt und eine Zeit lang den lieblichen Tönen lauschte. Er beschloß den Sänger aufzusuchen und ritt dem Ort zu, von dem der Gesang zu kommen schien.
Er war nicht lange geritten, da öffnete sich der Wald, und vor ihm lag eine schöne, große Wiese, auf der ein Hirtenknabe seine Schafe hütete. Er nahte sich dem Knaben und redete ihn an: »Möchtest du nicht tauschen mit mir? Ich gebe dir mein Pferd, und du gibst mir dafür deine Schafe zu hüten!«
Der Hirt wußte nicht, wie ihm geschah. Er machte eine Zeit lang große Augen, aber als er merkte, daß es mit dem Handel Ernst sei, schlug er sogleich ein, hieß den Fremden vom Pferd steigen und
übergab ihm seinen Stab und seine Tasche.
»Siehst du«, sagte er, »wenn du ein rechter Hirt sein willst, so mußt du schon einen tüchtigen Stecken haben, und eine Schale mit ein paar Brocken ist auch ein gutes Zeug.
Aber jetzt laß dir sagen: Die Schafe, die du zu hüten hast, gehören dem Bauern da drüben auf dem Hügel. Wenn du abends Heim fährst, so werden die Schafe schon von selbst in den Stall gehen. Du aber gehst in die Küche und setzt dich auf den Hackstock. Wenn dich die Bäuerin fragt: 'Hansl, was magst denn?', so sagst du: 'Ein Butterbrot.'
Du mußt aber recht niedergeschlagen tun und ein saures Gesicht machen, dann wird die Bäuerin fragen: 'Hansl, was fehlt dir denn?' Darauf antwortest du: 'Mir fehlt sonst nichts.' Dann wird sie schon merken, daß nicht der Hansl Schafhirt ist, sondern ein anderer. Wenn du aber brav bist, wird sie schon zufrieden sein mit dir, und du wirst es gut haben.«
Nachdem er so geredet hatte, schwang er sich aufs Pferd und ritt auf und davon.
Der neue Schafhirt saß nun unter seinen Tieren, welche fleißig am Gras rupften und von Zeit zu Zeit während des Kauens zu ihm aufschauten, als wollten sie sich besinnen, ob das der Rechte sei. Er
ging zu den Schafen und Lämmlein herum und streichelte und kratzte sie unten am Hals, was sie recht gern zu leiden schienen.
Bald wurde er neugierig, wie es etwa in der Umgegend aussehe. Er stieg auf einen nahe gelegenen Hügel und beschaute sich von da aus die ganze Nachbarschaft. Da sah er nicht weit von sich auf einem Hügel ein großes und prächtiges Schloß. Es wunderte ihn, wem etwa das große Gebäude gehören möchte, aber weil er niemanden bei sich hatte, den er fragen konnte, gab er sich einstweilen zufrieden und stieg wieder zu seinen Schafen hinab.
Es dauerte nimmer lange, so begann es dunkel zu werden, und er trieb seine Herde dem großen Bauernhaus zu. Die Schafe liefen in ihren Stall, der Hirt aber ging in die Küche und setzte sich auf den Hackstock. Die Bäuerin schaute ihn zuerst nicht viel an und setzte gerade jene Fragen, die ihm der andere Hirte vorausgesagt hatte.
Sie erkannte ihn auch an seinem traurigen Wesen, allein er gefiel ihr sonst nicht übel, und sie ließ sich den Tausch gerne gefallen. Auch führte sie ihn zum Bauern und gab ihm allerlei Regeln, nach denen er sich im neuen Dienst zu verhalten habe.
»Vor allem gib acht«, sagte sie, »daß kein Schaf über den Grenzstein läuft und im Feld unserer Nachbarn grast. Denn dies sind drei Riesen, die da drüben im Schloß wohnen und den Leuten solchen Schrecken einjagen, daß unser König dem jenigen sogar seine Tochter versprochen hat, der den dreien den Garaus macht.«
Der Junge war froh, einmal zu wissen, wem dieses prächtige Schloß gehöre, und versprach auch, den Ermahnungen der Bäuerin treu zu gehorchen. Das Schaf hüten gefiel ihm gar nicht übel, und der beständige Aufenthalt unter Gottes freiem Himmel kam ihm lustiger vor als das ewige Stuben hocken. Er kaufte sich eine Zither und spielte und sang auf der Wiese, daß die Berge ringsum widerhallten.
Die Riesen im Schloß hörten sein Spiel und seinen Gesang, und es dauerte nicht lange, bis einer von ihnen aus Neugier zu ihm herüber kam. Der Kerl war so lang, daß er über alle Bäume hinausreichte, und der Hirt sah ihn schon von weitem daher kommen. Schnell stieg er auf den Wipfel eines hohen Baumes und schaute dem Riesen entgegen.
Als dieser nahe kam und ihn fragte, warum er auf dem hohen Baume sitze, sagte er: »Ich bin herauf gestiegen, damit ich dich anschauen kann.« Der Riese hatte große Freude an dieser Antwort und sagte: »Steig nur vom Baum herab; ich will jetzt Wein und Brot vom Schloß herüber holen, und dann werden wir miteinander essen und trinken, singen und spielen.«
Als er dies gesagt hatte, drehte er sich um und machte einige große Schritte gegen das Schloß hin. Der Hirtenknabe fing an, vom Baum herabzusteigen, allein bis er auf den Boden kam, war auch der Riese schon wieder zurückgekehrt. Er hatte eine ganze Menge Wein und Brot mitgebracht und hieß nun den Hirten lustig sein und sich gütlich tun.
Der Hirt hatte aber ein Fläschchen mit einem starken Schlaftrunk bei sich, und davon goß er unbemerkt einige Tropfen in das Trinkglas des Riesen. Sie hatten kaum zu trinken angefangen, da packte den Riesen ein gewaltiger Schlaf. Er legte sich seiner ganzen Länge nach auf das Gras und fing an zu schnarchen.
Der Hirt wartete nicht lange, nahm ihm sogleich sein Messer von der Seite, schnitt ihm den Kopf ab und schnitt auch die Zunge aus dem Kopf heraus. Dann begrub er den Leichnam und ließ sich gar nicht anmerken, daß etwas geschehen war. Er gab wieder auf seine Schafe acht und sang und spielte die Zither, daß man es weitum hören konnte.
Als bald kam der zweite Riese, tat freundlich mit dem Hirten, setzte sich zu ihm nieder, packte Brot und Wein aus und lud den Hirten dazu ein. Der Hirt brachte wieder ein paar Tropfen von seinem Schlaftrunk in das Glas des Riesen und wartete, bis er einschlief. Dann nahm er ihm das Messer von der Seite, schnitt ihm den Kopf ab und die Zunge heraus und grub den Leichnam ein.
Als er damit fertig war, schaute er wieder zu seinen Schafen und sang und spielte dazu auf der Zither. In kurzer Zeit kam der dritte Riese, trank, sang und spielte mit dem Hirten, bekam aber auch einen Schlaftrunk und verlor seinen Kopf. Der Hirt scharrte seinen Leichnam zu den anderen zwei ein, die drei Zungen aber steckte er zu sich, um sie einmal als Wahrheitsbeweis brauchen zu können.
Nicht lange Zeit darauf traf es sich, daß ein Förster, der seiner Arbeit nachging, an diesen Ort kam und die drei Riesen Leichname samt den abgeschnittenen Köpfen fand. Der Förster hatte eine übergroße Freude, nahm die drei Köpfe und ging als bald zu dem König. Er erzählte ihm, daß er den drei Riesen das Licht ausgeblasen habe, und forderte ihn auf, ihm seine Tochter dem Versprechen gemäß zur Gemahlin zu geben.
Der König wollte ihm aufs Wort hin nicht glauben, sondern forderte auch Beweise für seine Behauptung. Der Förster zeigte ihm die drei Köpfe, und als er diese sah, so war er zufrieden und führte
den Förster der Tochter als ihren Bräutigam vor.
Die Prinzessin aber wollte von dieser Heirat nichts wissen, denn sie konnte den Förster nicht lieb gewinnen, und behauptete steif und fest, ein anderer und nicht der Förster müsse die Riesen
getötet haben.
Inzwischen kam der Schafhirt an den Hof, zeigte dem König die Zungen der drei Riesen und erbat sich von ihm seine Tochter zur Frau. Weil er die Zungen brachte, erkannte man ihn als den eigentlichen Täter, und die Königstochter wurde mit der größten Freude seine Gemahlin.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Kramsach
DER ZIEGENHIRT ...
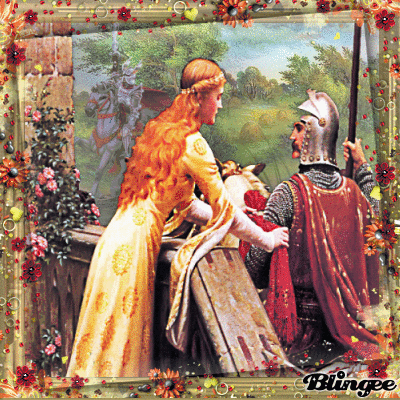
Es war einmal ein armer Holzhacker, der lebte sehr sparsam mit seinem Weib und seinem Kind, denn nur mit der größten Anstrengung konnte er sich und den Seinigen den nötigen Lebensunterhalt verschaffen. Als er aber starb, härmte sich das Weib so ab, daß sie ihm bald nachfolgte und Hiesl, so hieß das Kind, ganz einsam und verlassen da stand.
Nachdem er zwei Tage und zwei Nächte bei dem Grab seiner Eltern geweint hatte, machte er sich auf, um aus dem Wald zu kommen, den er früher noch nie verlassen hatte, und wollte durch Handarbeit
sich das Notwendigste verdienen.
Da kam Hiesl an eine breite Straße, auf der er getrost weiter ging, und gelangte nach langem Wandern in eine große, schön gebaute Königsstadt.
Hier fragte er fast in jedem Haus, ob er Arbeit bekommen könnte, er verlange nichts als die notwendige Nahrung; aber überall wies man den zerlumpten, furchtsamen Knaben ab, so daß er traurig und hungrig jede Hoffnung aufgab, sich in einem abgelegenen Winkel verbarg und nach Herzenslust weinte.
Nachdem er so die ganze Nacht mit Weinen zugebracht hatte, raffte er sich am Morgen auf, um zum letzten Male zu versuchen, ob er nicht Arbeit bekommen könnte. Er ging auf ein großes, schönes Haus zu, worin der König wohnte, und fragte nach Arbeit, »Ja«, sagte man zu ihm, »wenn du die Ziegen hüten willst, so kannst du schon bleiben, sonst braucht man dich nicht.« Hiesl ging freudig auf den Vorschlag ein.
Als der König erfuhr, daß sich ein Ziegenhirt gemeldet hatte, war er herzlich froh, denn er glaubte nicht, daß noch einer kommen würde, da schon so viele ihr Leben beim Hüten eingebüßt hatten. Er ließ deshalb den Knaben zu sich rufen und sprach zu ihm: »Wenn du fleißig dein Geschäft verrichtest, so bekommst du eine neue Kleidung, gute Nahrung und am Ende eines jeden Jahres einen großen Lohn.
Aber merke wohl, was ich dir sage. Die Ziege mußt du auf den Berg bei der Stadt treiben, wo das prächtige Schloß steht. Um das Schloß herum befinden sich schöne Gärten, Felder und Wiesen, die nur mit einem schwachen Zaun vom Wald getrennt sind, wo du die Ziegen hüten mußt. Diese darfst du aber nicht in die fetten Felder und Wiesen hinein- und darauf weiden lassen; wann dies geschehen sollte, wird der Herr des Schlosses, ein furchtbarer Riese, erscheinen und dich in viele Stücke zerreißen. Dieser beobachtet dich immer, nur eine kurze Zeit des Morgens ausgenommen, wenn er schläft.«
Nach diesen Worten entließ der König den Knaben. Dieser war froh, einen Dienst erhalten zu haben, sprang sogleich in den Ziegenstall, um sich mit seinen Pflegebefohlenen vertraut zu machen. Er blieb den ganzen Tag bei ihnen, ja er schlief sogar im Stall, eine solche Freude hatte er an diesen Tierlein und so gerne hörte er ihr Meckern.
Morgens stand er in aller Frühe auf und trieb seine Herde froh und munter den Berg hinan, die nötigen Lebensmittel trug er in der Tasche. Vor dem Riesen hatte er keine Furcht; denn er nahm sich vor, die Ziegen weit vom Schloß weg in den Wald hineinzutreiben. Als er aber oben ankam, liefen alle zum Schloß hin - denn sie kannten die fetten Wiesen zu gut -, so daß Hiesl den ganzen Tag in einem Atem laufen mußte, um sie abzuwehren. Den Riesen sah er aber nicht.
Als er seine Herde nach Hause getrieben hatte, lobte ihn der König sehr, daß er so brav war, und gab ihm einen großen Taler. Die ganze Nacht hindurch ging aber dem Hiesl das Schloß samt dem Riesen nicht mehr aus dem Kopf; er wollte, er mußte alles sehen. Deshalb trieb er am anderen Tag in aller Frühe seine Ziegen auf den Berg, überließ sie ihrem Schicksal und schlich sich ganz heimlich ins Schloß.
Aber wie erstaunte er über die Pracht und Herrlichkeit, die er im Schloß fand, wo Tür und Tor ihm offen standen. Sein Auge wurde geblendet vom Schimmer des Goldes, des Silbers und dem Glanz der Edelsteine, die haufenweise da lagen, sowie von den blanken Rüstungen, die an den Wänden herum hingen.
Er ging von einem Saal in den anderen und fand endlich in einem den Riesen, auf einem Bett hin gestreckt, im tiefen Schlaf; neben ihm befand sich seine herrliche Rüstung. Hiesl erschrak anfangs über das Ungeheuer mit seinem furchtbaren Gesicht; besann sich aber nicht lange, sondern ergriff mit beiden Händen das Schwert des Riesen und hieb ihm den Kopf ab.
Kaum hatte er diese Arbeit vollbracht, so stand ein kleines Männlein vor ihm, verneigte sich tief, begrüßte ihn als den Herrn des Schlosses samt allem, was darin und darum war, und fragte, was er befehle. »Jetzt will ich was Ordentliches zu essen und zu trinken«, war die Antwort.
Kaum hatte Hiesl das gesagt, so verschwand das Männlein, kehrte aber bald mit Speise und Trank zurück. »Während ich mich hier nun sättige«, sprach Hiesl, »siehst du dich um meine Ziegen um; treib sie in die Schloßfelder herein und gib auch wohl acht darauf.«
Aber nicht bloß während des Essens und Trinkens mußte das Männlein die Ziegen hüten, sondern auch noch so lange, als Hiesl das Schloß besichtigte. Spät Abends löste er erst das Männlein ab, das zu ihm sagte: »Wenn du meiner bedarfst, so stampfe nur in dem Zimmer, wo du den Riesen getötet hast, mit dem Fuß dreimal auf den Boden, und ich werde also gleich zu Diensten stehen.« Darauf verschwand es.
Lustig und munter trieb Hiesl seine Herde nach Hause; doch er war klug genug, von seinem Abenteuer nichts auszuschwätzen. Täglich trieb er seine Herde auf den Berg, ging in sein Schloß, stampfte mit dem Fuß dreimal auf den Boden, das Männlein mußte ihm dann Essen und Trinken bringen und während des Tages die Ziegen hüten.
Und so trieb er es längere Zeit fort; die Ziegen wurden fett, gaben sehr reichlich Milch, und der König war dem Hirten, der unterdessen bei guter Kost zu einem schönen, starken Jüngling herangewachsen war, wegen seines Diensteifers sehr gewogen.
Der König hatte eine wunderschöne Tochter, um deren Hand sich viele, aber immer umsonst beworben hatten; denn sie war sehr dem schönen Hirten in Liebe zugetan und hätte niemanden lieber geheiratet als ihn, wenn er nur von besserer Abkunft gewesen wäre. Weil sie deshalb keine Hoffnung hatte, ihren Wunsch je erfüllen zu können, verschmähte sie jeden Freier.
Da jedoch der König einen Nachfolger wünschte, schrieb er ein großes Turnier aus, und jener Ritter, der drei Tage nacheinander die übrigen Bewerber aus dem Sattel heben würde, der sollte mit der Hand der Tochter auch den Thron nach des Königs Tod erhalten. Alle Anstalten dazu wurden aufs beste getroffen, und mit Freude sah man allenthalben diesem Fest entgegen, nur die Königstochter war trauriger und in sich gekehrter als jemals zuvor.
Am Tag des Turniers, während der König mit seiner Tochter, den Rittern und Großen des Reiches nach dem Kampfplatz zog, trieb Hiesl, scheinbar ganz unbekümmert um alles, was vorging, seine Herde auf den Berg, trat aber schnell ins Schloß und forderte vom dienstbeflissenen Männlein, ihm also gleich einen Schimmel und eine stahlblaue, kostbare Rüstung zu bringen.
Wie befohlen, so geschah es. Das Männlein brachte die verlangte Rüstung samt Helm mit wallendem Federbusch, ein Schwert und eine große Turnierlanze; im Hof stand ein mutiger Schimmel, kostbar geschirrt.
Hiesl rüstete sich mit Hilfe des Männchens und schwang sich auf den Schimmel, jagte den Berg hinab und erschien zum Erstaunen aller, spät und ganz unerkannt auf dem Platz. Auf der entgegengesetzten Seite stand der bisherige Sieger, den der Hiesl zum Kampf forderte. Dann legte er die Lanze ein, sprengte gegen ihn, warf ihn aus dem Sattel weithin in den Sand und sprengte unter allgemeinem Beifall durch die Stadt dem Schloß zu.
Er war schon aller Augen entschwunden, bevor man vor Verwunderung imstande war, sich zu sammeln. Alles Nachforschen nach dem unbekannten Ritter war vergebens; denn dieser trieb spätabends in seiner gewöhnlichen Kleidung die Herde nach Hause.
Am zweiten Tag begann wieder das Turnier; Hiesl trieb wieder die Herde den Berg hinan und forderte eine silberne Rüstung samt einem Rappen, sprengte den Berg hinab in die Mitte des Kampfplatzes, warf den Sieger des Tages aus dem Sattel und jagte auf und davon, ohne von den Reitern eingeholt zu werden, die der König deshalb aufgestellt hatte. Auf Umwegen gelangte er ins Schloß.
Noch größer war an diesem Tag die Verwunderung des Königs, aber auch seine Betrübnis; die Tochter hingegen freute sich, weil sie dadurch die lästigen Freier loszuwerden hoffte. Am dritten und letzten Tag erschien Hiesl in einer goldenen Rüstung auf einem braunen Pferd. Auch diesmal stach er den Sieger des Tages aus dem Sattel, wurde aber von ihm an der Wade verwundet. Auch diesmal war das Verfolgen umsonst; er kam auf Umwegen und ungesehen ins Schloß.
Als er aber seine Herde nach Hause trieb, hinkte er wegen der Wunde. Der König erblickte ihn und ließ ihn zu sich rufen. »Was ist dir begegnet, daß du so hinkst?« fragte der König freundlich. Hiesl wollte mit der Sprache nicht heraus; aber durch die Bitten der Tochter wurde er endlich bewogen, daß er sein Abenteuer mit dem Riesen und die Vorfälle beim Turnier erzählte.
Voll Freude fiel ihm die Königstochter um den Hals, denn jetzt war ja ihr Bräutigam derjenige, nach dem sie sich so herzlich gesehnt hatte. Aber auch der König war voll Freude über einen so stattlichen Eidam. Unter frohen Festen, bei Musik und Tanz wurde die Hochzeit vollzogen. Lange noch lebte der König, und nach ihm herrschte viele Jahre der Ziegenhirt, geehrt von allen und bei seinem Tod tief betrauert.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
DER HIRTENKNABE ...

Es war einmal ein armer Bauernbub, der hatte für eine Gemeinde die Geißen zu hüten und bekam dafür nichts als die Kost. Wenn er mit seinen Tierlein den Berg hinaufzog und genug geschnellt und gejuchzt hatte, schaute er oft lange Zeit seine Hosen und seine Joppe an und fing an, die Löcher zu zählen, die täglich mehr wurden. Er hatte das tiefste Mitleid mit sich selbst, weil ein gar so armes G'wandl an seinem Leib hing, und dachte oft daran, wie er zu einer anständigen Kleidung kommen könnte.
Endlich fiel ihm ein, neben dem Geißhüten Körbe zu flechten, um sich so etliche Kreuzer zu verdienen. Er fing mit allem Ernst sein Handwerk an, und in wenigen Tagen stand das erste Körbchen fertig vor ihm. Er hatte eine große Freude darüber, kehrte es zehnmal um und schaute es von allen Seiten an. Muß doch schauen, ob es auch was Schweres trägt, dachte er sich, nahm einen tüchtigen Stein und legte ihn in das Körbchen. Patsch - da liegt der Stein samt dem Boden des Körbchens vor ihm auf der Erde.
Der Knabe verzog sein Gesicht zum Weinen, und Tränen auf Tränen kugelten über seine Wangen zur Erde hernieder. Er hätte aus der Welt gehen mögen, weil ihm auf einmal alle Freude und Hoffnung genommen war. Während er sich die Tränen aus den Augen wischte und bald die löcherigen Hosen, bald das zerrissene Körblein betrachtete, kam ein Jüngling auf ihn zu, der so schön und freundlich war wie ein Engel vom Himmel.
Er redete den Knaben mit liebreicher Stimme an und fragte ihn, warum er denn gar so bitterlich weine. Der Knabe fing aufs neue an zu schluchzen, zeigte auf das zerrissene Körbchen und stammelte mit harter Mühe etliche abgebrochene Worte hervor, in denen er sein Elend erzählte. Kaum war er mit der Erzählung zu Ende, begann das Weinen und Schluchzen aufs neue, so daß sich ein Stein hätte erbarmen mögen.
Der Jüngling nahm den Knaben freundlich bei der Hand, tröstete ihn und fragte, ob er nicht mit ihm gehen möchte. Der Knabe gewann ein Zutrauen gegen ihn und sagte: »Gern wollte ich mitgehen, aber die Geißen muß ich zuvor heimtreiben.« »Laß dir das nicht am Herzen liegen«, erwiderte der Jüngling, »die Geißen werden schon allein nach Hause finden, folge mir nur unbesorgt.«
Der Knabe traute diesen Worten und ging mit. Sie wanderten mitsammen fort und waren freundlich miteinander, als ob sie sich schon lange gekannt hätten.
Ein gutes Stück Weges hatten sie schon hinter sich, da begegnete ihnen ein schönes Weibsbild, das dem Knaben freundlich winkte und ihn vom Jüngling wegzulocken suchte.
Dieser aber sprach seinem Begleiter in einem fort zu, er solle sich nur nicht von ihm abwendig machen lassen. Der Knabe gehorchte und entfernte sich nicht von ihm. Als das Weibsbild vorbei war, schaute er noch einmal danach um und sah mit Entsetzen, daß es einen feurigen Schweif hinter sich herzog.
Es begann Abend zu werden, und der Weg wurde immer beschwerlicher. Sie mußten einen Berg hinan gehen, der so steil war, daß der Jüngling den Hirtenknaben oft nachschleppen mußte. Als sie nach saurer Mühe auf dem Gipfel des Berges ankamen, fanden sie da eine Herberge, in der sie vortrefflich bewirtet wurden.
Nachdem sie die Mühen des ersten Tages verschlafen hatten, machten sie sich des anderen Morgens wieder auf den Weg. Der Marsch war ebenso mühevoll wie am vorigen Tag. Es ging über Stock und Stein, durch Wald und Gestrüpp und manchmal so stark aufwärts, daß ihnen fast der Atem ausblieb. Zudem mußte der Knabe zwei harte Kämpfe bestehen mit einem großmächtigen Vogel und mit einem abscheulichen Wurm.
Nachdem das alles glücklich vorüber war und der Tag sich zu Ende neigte, hatten sie wieder einen hohen Berg vor sich, den sie nur mit der größten Mühe erklimmen konnten. Als sie oben ankamen, fanden sie eine Herberge, in der sie auf das vortrefflichste bewirtet wurden.
Am anderen Tag in aller Frühe traten sie neu gestärkt ihre Wanderung an. Sie waren eine gute Strecke gegangen, da begegnete ihnen der Knochenmann. Er grüßte sie aufs aller Freundlichste und lud den Knaben ein, mit ihm zu gehen. Der Knabe warf einen fragenden Blick auf das Gesicht des Jünglings, und dieser gab ihm die Erlaubnis, der Einladung zu folgen.
So ging denn der Knabe mit dem Knochenmann von dannen, und sie wanderten miteinander in die Ewigkeit.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Raunsertal
DIE FANGGEN ...

Ein Büblein verirrte sich tief in den Wald und konnte um alle Welt nimmer herausfinden. Wie es schon lange Zeit so herumgeirrt war und ihm immer bänger zumute wurde, kam ein uraltes Weib daher, welches recht schmutzig und zerlumpt aussah.
Die Alte ging auf das Büblein zu und lud es ein, ihr zu folgen. Das Büblein aber fürchtete sich sehr und hatte keine Lust mitzugehen. Es nahm allerlei Ausflüchte und versuchte, so bald als möglich die üble Gesellschaft loszuwerden. Da fing die Alte an, mit allerlei Versprechungen und Drohungen dem Büblein zuzureden, bis es endlich nachgab und sich mit ihr auf den Weg machte.
Die Alte humpelte voran, das Büblein ging hinterdrein, und so kamen sie durch allerlei wüste, abscheuliche Orte zu einem Felsen, der voller Höhlen und Löcher war. In eine solche Höhle gingen sie hinein, und hier bekam das Büblein prächtig zu essen, wie ihm die Alte versprochen hatte.
Aber was half dem armen Häuterlein das gute Essen? Es wurde in ein enges Ställchen gesperrt, wo es Tag und Nacht zubringen mußte. Es hatte immer Langeweile, und das Heimweh drückte ihm schier das Herz ab. Dabei hatte es die große Furcht vor der Zukunft, denn alle Tage kam ein altes Weib und befahl ihm, ein Fingerlein aus dem Stall zu strecken, damit sie greifen könne, ob es bald fett genug sei. Denn wenn es recht nudelfett wäre, so wollte sie es schlachten und braten.
Die bösen Weiber aber, die das Büblein in ihre Hände bekommen hatten, waren Fanggen. So oft nun die Fangge zum Ställchen kam und das Büblein seinen Finger herausstrecken sollte, so streckte es dafür einen Rechenzahn heraus, den es zu seinem Glück gefunden hatte. Die Alte meinte immer, das Büblein müsse bei der guten Kost fetter werden, allein tagtäglich kam der selbe zaundürre Finger heraus, und tagtäglich mußte die Fangge unwillig und murrend abziehen.
Einstmals aber hatte das Büblein den Rechenzahn verloren, und als die Alte wieder kam, mußte es sein eigenes Fingerlein, das in der langen Zeit sehr fett geworden war, aus dem Ställchen herausstrecken. Die Alte fühlte es an und wunderte sich, daß das Büblein, das sich früher nie länden wollte, auf einmal so fett geworden war.
Sie rief sogleich eine noch ältere Fangge, welche bei dem Stall Wacht halten mußte, während sie selbst zu den übrigen Fanggen herumlief, um sie zu dem Braten einzuladen. Dem Büblein war jetzt wohl recht übel zumute, aber alle Hoffnung ließ es doch nicht sinken.
Es fing an, die Alte, die vor dem Ställchen stand, recht inständig zu bitten, sie solle ihm doch vergönnen, ein wenig zu ihr hinauszugehen. Sie wollte anfangs nicht recht ja sagen, aber wie das Büblein ihr versprach, ihr zum Dank dafür Läuse zu suchen, so machte sie schnell die Tür auf.
Das Büblein kam heraus, setzte sich nieder und suchte der Alten, die ihm ihren grauen Kopf in den Schoß gelegt hatte, die Läuse ab. Es dauerte nicht lange, so schlief die Alte ein. Wie das Büblein dies merkte, gab es ihr einen tüchtigen Schlag auf den Kopf und lief zur Höhle hinaus.
Dann floh es in den Wald hinein und lief in einem Atem fort, bis es an einen Bach kam. Hier mußte es stehenbleiben, denn das Wasser war zu groß, als daß es hinüberkommen konnte. Jetzt wird das arme Bübchen halt warten müssen, bis die Fanggen nachkommen und es wieder zurückbringen, um es zu schlachten und zu braten, hast du gemeint.
Wenn das Büblein keinen Schutzengel gehabt hätte, so wäre es ihm wohl nicht anders ergangen. Allein es kam der heilige Schutzengel, nahm das Büblein unter den Arm und flog mit ihm über den Bach. Als er es auf dem anderen Ufer niedergestellt hatte, liefen schon die Fanggen heran, um das Büblein zu erwischen.
Sie wußten aber nicht, wie über den Bach zu kommen sei, und riefen daher zum Büblein hinüber: »Büblein, wie bist du hinüber gekommen?«
»Ich habe ein Brettlein genommen
Und bin herüber geschwommen.«
Da suchten alle Fanggen Brettlein zusammen, warfen sie ins Wasser und setzten sich darauf. Allein das Wasser nahm sie mit fort, und alle miteinander ertranken. Und seitdem gibt es keine Fanggen mehr, aber ihre Löcher, wenn es dich wundert, die kannst du noch sehen.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Oberinntal
DIE DREI HOLZHACKER ...

Drei Knechte waren einmal im Wald, um Holz zu fällen. Sie sahen, wie ein landfremder Mensch öfter an ihnen vorüber in den Wald zu einem gewissen Baum ging, der, nachdem er sich dort eine Zeit lang aufgehalten hatte, aus ihrem Blick bald verschwand.
Aus Vorwitz gingen sie endlich auch zu besagtem Baum hin, setzten die Axt an seinen Stamm und fällten ihn. Als der Baum mit großem Geräusch zu Boden fiel, siehe, da war er von innen hohl, und es rollten eine Menge Gold- und Silbermünzen aus ihm heraus, die der fremde Mann darin verborgen hatte. Die drei Knechte hatten darüber eine sehr große Freude, denn nun waren sie auf einmal reiche Leute und mußten sich nicht mehr mit harter Arbeit plagen, um ihren Unterhalt zu erwerben.
Das erste, was sie in ihrer übergroßen Freude taten, war, daß sie einen von ihnen um Wein in die nächste Ortschaft schickten; darnach wollten sie das Geld unter sich verteilen. Dieser ging nun fort, um Wein zu holen, während die anderen beiden beim Geld blieben. Auf dem Weg aber kamen ihm allerlei böse Gedanken, die er sich nicht ausschlug, in die er endlich sogar einwilligte.
Er dachte: Ich will Gift in den Wein mischen, und wenn meine zwei Kameraden davon trinken und sterben, dann gehört alles Geld mir. Er kaufte also nebst dem Wein auch Gift und kehrte zu seinen Gefährten in den Wald zurück.
Aber auch diese wurden während seiner Abwesenheit von verschiedenen schwarzen Einfällen versucht und wurden endlich darin eins, daß sie den dritten bei seiner Rückkehr ermorden und sie zwei allein das ganze Geld teilen wollten. Als ihnen dieser das Getränk vorsetzte, schlugen sie ihn mit ihren Äxten tot zu Boden. Dann tranken sie nach Herzenslust und fingen an, das Geld unter sich zu verteilen. Bald aber brannte der Wein wie Feuer in ihren Eingeweiden, und sie starben unter unsäglichen Qualen.
Es lagen drei Leichen um das Geld herum. Die drei Knechte waren bei ihrer harten Arbeit besser und glücklicher gewesen, als nachdem sie einen großen Schatz gefunden hatten, wodurch sie glücklich zu werden hofften.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Unterinntal
VOM ARMEN BÄUERLEIN ...

Es war einmal ein armes, armes Bäuerlein, das nichts hatte als eine halb verfallene Hütte für sich und seine Hausfrau zur Wohnung, eine magere Kuh im Stall und Hunger und Not als Tischgenossen.
Aber beide arbeiteten fleißig und bewahrten sich vor dem größten Mangel und sagten oft selber zueinander, es könnte doch noch schlechter sein. Endlich aber wollte auch die Arbeitsamkeit nicht mehr vor arger Not schützen, so daß sie gar nicht wußten, was nun anzufangen sei.
Die Hütte verkaufen war eine harte Sache, weil sich kein Käufer fand und sie wohl auch nicht gerne unter freiem Himmel schlafen wollten. Sonst aber meinten sie, wäre nichts, was sie verkaufen könnten, um Geld zu bekommen. Als sie so nachdachten, hörte die Bäuerin die Kuh im Stall muhen, auf die sie ganz vergessen hatten.
»Geh«, sagte sie, »treib die Kuh auf den Markt, sie muß ja sonst doch verhungern, schau doch, was du dafür bekommst.« Das Bäuerlein nahm einen Haselstecken und trieb die Kuh ins nächste Dorf, wo so eben Markt war, wenn er auch wenig Hoffnung auf einen hohen Kaufpreis hatte, weil das arme Tier gar so jämmerlich aussah.
Er war eben noch nicht gar lange fort gegangen, als ihm ein kleines, altes Männlein in grasgrüner Kleidung begegnete und ihm schon von weitem zurief: »He du! Ist die Kuh nicht feil?« »O ja«, entgegnete ihm der Bauer, »wenn du brav zahlst.« »Ich habe nicht viel Geld, mein Lieber«, antwortete das Männlein und sah ihm mit lächelnder Miene ins Angesicht, »aber da sieh her« - und hielt ihm eine Flasche hin -, »könnten wir nicht eben einen Tausch machen?
Gib du mir die magere Graue da, und ich gebe dir diese Flasche. Du wirst schon sehen, es reut dich nicht, wenn du mir glaubst, denn das Fläschchen hat gar gute Tugenden.« Das grüne Männchen schien so treuherzig, daß der Bauer ihm glauben mußte. »Nun, weil du es so lobst«, sagte er, »schlag ein, wir wollen tauschen.«
Der grüne Käufer führte die Kuh fort, und der Bauer ging wieder in seine Hütte zurück und stolperte oft unterwegs, denn er betrachtete immer die Flasche und sah nie auf die Steine, die auf dem Weg lagen. Als er nun nach Hause kam, wunderte sich die Bäuerin sehr, wie er sein Geschäft gemacht habe, ließ ihn kaum zu Wort kommen und fragte: »Was hast du denn für die Kuh bekommen?«
Als aber der Bauer die Flasche auf den Tisch setzte und ihr erzählte, was das grüne Männlein zu ihm gesagt hatte, da fing sie fast zu weinen an und machte ein langes Gesicht - weil er so dumm sei und jedem Narren glaube. Das machte den Bauern nun auch unruhig, er hob die Flasche vom Tisch auf, und indem er sie wieder hinstellte, murmelte er: »Hätt' ich nur Geld und etwas Ordentliches zum Essen!«
Allein kaum hatte er das gesagt, so klingelte und klapperte es, und ein großer Haufen Taler lag da auf dem Tisch neben den dampfenden Schüsseln, daß die zwei gar nicht wußten, wie das zuging und große Augen machten. »Das hilft uns wenig«, sagte nach einer Weile der Bauer, als er sich von seinem Erstaunen erholt hatte, »wenn wir da stehen und das Essen kalt werden lassen.
Das grüne Männlein hat gar wohl recht gehabt, daß die Flasche gute Tugenden besitze; nun wollen wir es aber auch von Herzen hochleben lassen.« Die Bäuerin hatte jedoch nichts Eiligeres zu tun, als die harten Taler zusammenzuklauben, erst dann setzte auch sie sich zu Tisch, und der Schmaus wollte gar kein Ende mehr nehmen.
So war das arme Bäuerlein reich geworden und lebte im Wohlstand froh und glücklich. Jedermann redete von der Wunderflasche und wünschte sich auch eine solche zu haben.
Da unternahm einmal der König eine Reise durch sein Land. Er kam auch in diese Gegend, wo das Bäuerlein wohnte, und beschloß, hier mit seinem Hofstaat eine Zeit lang zu bleiben. Da aber seine Großen Langeweile bekamen, wollte er ihnen, um sie fröhlich zu machen, eine große Tafel geben. Es wurde alles aufgeboten, um sie so prächtig wie möglich zu machen, aber dem König schien alles noch zu gering; denn alles, was er tat, sollte königlich sein.
Daher war er sehr froh, als er von der wunderbaren Flasche hörte, und dachte nach, wie er in ihren Besitz kommen könnte. Er ließ das Bäuerlein rufen und bot ihm einen großen Haufen Silber und Gold für die Flasche an. Ha, dachte der Bauer, wär' schon recht; aber was soll ich machen wenn ich meine Flasche verkaufe. Es ist doch eine gar zu seltene Sache.
Doch der König hörte nicht auf, Vorstellungen zu machen, und versprach ihm immer noch mehr Gold, bis jener einwilligte. Alsogleich wurde nun die Probe mit der Flasche gemacht, und da wunderten sich die Begleiter des Königs über die prachtvolle Tafel über alle Maßen, denn nicht einmal in der Residenz des Landesfürsten hatten sie so viele und schmackhafte Speisen bekommen, und selbst der Schatzmeister des Königs, der anfangs ein ziemlich saures Gesicht schnitt, als soviel Geld für ein eitles Glas hinweg getragen wurde, machte jetzt eine ganz heitere Miene.
Das Bäuerlein aber ließ es sich bei seinen Goldfüchsen wohl sein, lud seine Nachbarn zu Tisch und tafelte so wacker wie ein Graf oder wie der König selber. Wenn aber seine Nachbarn hie und da ein Wort fallen ließen, daß sich ein großer Graben ausschöpfen, aber schwer wieder ausfüllen lasse, dann gab er immer zur Antwort: »Ei, haben wir's doch - mir werden ja sonst die Taler grau.«
Inzwischen merkte aber der lustige Bruder nicht, wie sein Kasten immer leerer und leerer wurde, und als er es endlich sehen mußte, schlug er sich vor den Kopf und wünschte, daß er wieder zum grünen Männlein käme, um einen Tausch zu machen. Ja es war endlich so weit gekommen, daß er am Ende nichts mehr hatte als eine magere Kuh im Stall und die halb verfallene Hütte. Was war nun zu tun?
Die Flasche war verkauft, das Geld verschmaust. Das Männlein wußte er nicht zu finden. Zudem taugte es ihm gar nicht, daß die Nachbarn ihn immer Spottweise den reichen Bauern hießen und lachten. Geh, dachte er, verkauf wieder deine Kuh - vielleicht kommt das grüne Männlein doch noch einmal und bringt dir eine Flasche. Versuch's einmal.
Gesagt, getan - er geht in den Stall und fährt mit der Kuh auf den Markt. Noch war er nicht lange voll Unmut fort gegangen, als auf dem nämlichen Platz wie früher ihm das grüne Männlein begegnete und ihm ebenso bereitwillig, aber mit etwas schelmischem Lächeln den Tausch mit der Flasche antrug, den das Bäuerlein gerne annahm.
In der größten Freude sprang nun das Bäuerlein über Stock und Stein nach Hause und freute sich schon voraus auf den herrlichen Braten, den er sich nun anschaffen werde. Kaum war er zu Hause angekommen, wo die Bäuerin vor Freude fast nichts sagen konnte, so mußte nun die Flasche ihren Dienst leisten.
Allein wie staunten und erschraken sie, als statt der Speisen und der harten Taler zwei gewaltig große Riesen aus der Flasche hervor sprangen. Sie wollten davon laufen, aber die Riesen ließen sie nicht zur Tür hinaus, sondern fielen über die armen Bauersleute her und schlugen mit Fäusten auf sie ein, zur Strafe ihrer Verschwendung.
Das Gerücht von dieser wunderbaren Sache verbreitete sich weit und breit im ganzen Land und kam endlich auch dem König zu Ohren, der auch diese Flasche wieder kaufen wollte, um seinen Hofleuten einen Possen zu spielen. Er ließ das Bäuerlein zu sich kommen und kaufte ihm die Flasche um sehr viel Gold und Silber ab, wozu dieser sehr leicht zu bewegen war. Froh kehrte er in seine Hütte zurück, ließ diese nun aufbauen und fing eine bessere Wirtschaft an.
Der König aber ließ seine Großen nicht lange warten und zeigte ihnen die Eigentümlichkeit der neuen Flasche. Er lud sie alle zur Tafel, und nachdem sie der einen Flasche brav zugesprochen hatten, sollten sie auch der anderen ihre Ehre widerfahren lassen.
Die ganze Tafelgesellschaft war begierig, was da kommen würde; sie wurde es aber nur zu bald inne, denn die Riesen richteten eine schreckliche Geschichte an, so daß alle Gäste mit blauen Rücken auf und davon liefen und noch laufen, wenn sie nicht stehengeblieben sind.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
DIE ZWEI HAFNER ...
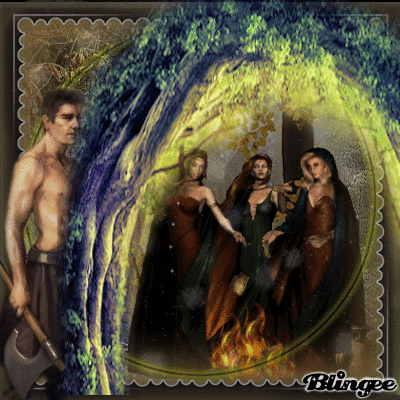
Zwei Hafner waren mitsammen auf der Wanderschaft. Da traf es sich einmal, daß sie beim Einbruch der Nacht noch im Wald waren und daran denken mußten, hier zu übernachten. Es ging aber die Rede von diesem Wald, daß darinnen Hexen hausten und auf einem hohlen Baum ihre nächtlichen Zusammenkünfte hielten.
An diesen hohlen Baum kamen die zwei Hafner, und der eine von ihnen sagte, darin wolle er über Nacht bleiben. »Sei doch klug«, sagte der andere, »weißt du denn nicht, daß die Hexen hier zusammen kommen und schon manchen, der sie in dem hohlen Baum belauschen wollte, herausgezogen und jämmerlich zerrissen haben.«
»Das weiß ich wohl«, sagte der erste, »aber das schreckt unsereinen nicht ab. Ich übernachte in dem hohlen Baum, und damit punktum.« Der andere redete ihm noch eine Weile zu, da aber alles nichts half, mußte er sich entschließen, allein weiterzugehen, und hieß seinen Kameraden wohl leben.
Dieser blieb bei dem Baum, suchte sich nassen Lehm und bildete daraus einen Mann. Als er damit fertig war, trug er ihn zu dem Baum. Dann kroch er in die Höhlung hinein, stellte den lehmernen Mann vor sich hin, er selbst aber hockte dahinter und wartete auf die Hexen.
Um Mitternacht hob ein heftiges Geräusch an und fuhr durch die Bäume hin und her. Das kam von den Hexen, die auf ihren Besen in der Luft umher ritten und sich endlich auf dem hohlen Baum nieder ließen. Hier machten sie eine Musik, die dem Hafner durch Mark und Bein ging, und als die Musik zu Ende war, fingen sie an, einander allerlei abenteuerliche Geschichten zu erzählen.
Als sie eine Weile geplaudert hatten, sagte eine: »Ich weiß etwas.« Sprach die zweite: »Ich versteh' etwas.« Sprach die dritte: »Ich spür' etwas.« »Was weißt du denn?« fragten sie die erste. »Ich weiß, daß in diesem Augenblick die Königstochter von einer Schlange gebissen worden ist und daß es nur ein Mittel gibt, das sie heilen kann.«
»Was verstehst du?« fragten sie die zweite. »Das Mittel, das sie heilen kann, verstehe ich. Wenn man ihr Pferdemist auf die Wunde legt, so wird sie genesen.«
»Und was spürst du?« fragten sie die dritte. »Ich spüre, in unserm Baum steckt ein Mensch.«
Daraufhin fuhren alle drei vom Baum herab, schossen in die Höhlung hinein und rissen den lehmernen Mann mit sich heraus. Im Nu hatten sie ihn in tausend Stücke zerrissen, und mit wüstem Jubelgeschrei fuhren sie durch die Lüfte davon. Der Hafner war froh, daß das Spektakel vorbei war, und kroch aus dem Baum hervor.
Er ging seines Weges weiter, bis er in die Königsstadt kam. Hier ließ er sich beim König melden und trug ihm seine ärztliche Hilfe an. Der König war froh über den Antrag des Fremden, und er versprach ihm die Prinzessin zur Frau zu geben, wenn sie durch ihn vom Biß der Schlange geheilt würde.
Der Hafner nahm Pferdemist, legte ihn auf die Wunde, und in wenigen Tagen war die Königstochter frisch und gesund. Dann wurde die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert, und nach dem Tod des Königs bekam der Hafner auch Krone und Zepter und die Macht über alle Lande, die der alte König regiert hatte.
Tag um Tag verging, und es trug sich zu, daß der andere Hafner zum König kam, um von ihm etwas zu erbetteln. Aber kaum hatten sich die zwei Kameraden gesehen, so erkannte einer den anderen. Der Arme war sehr neugierig zu erfahren, wie sein Reisegefährte zu solchem Reichtum und solchen Ehren gelangt sei.
Der König verheimlichte ihm nichts, sondern erzählte ihm treu und offen, was sich bei dem hohlen Baum begeben hatte und wie er des Königs Tochter zur Frau bekommen habe.
Der arme Teufel machte sich auf, ging zu dem hohlen Baum und machte es geradeso, wie es sein Kamerad angestellt hatte. Er stellte einen lehmernen Mann vor sich und wartete auf die Hexen. Diese aber waren gewitzt, und als sie zum Baum fuhren und merkten, daß jemand darinnen war, ließen sie den lehmernen Mann in Ruhe, über den Hafner aber fielen sie her und zerrissen ihn in tausend Stücke.
Hafner - Töpfer, Ofenbauer
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Rattenberg
DIE DREI SOLDATEN UND DER DOKTOR ...

The Dispute, watercolour, Herman Frederik Carel ten Kate, 1822 – 1891
Es kamen einmal in einem Wirtshaus drei abgedankte Soldaten zusammen und ein Doktor. Die Soldaten fragten den Doktor, ob er auch gut kurieren könne. Freilich kann ich das«, sagte der Doktor. »Ich will euch, während ihr schlaft, die Arme abnehmen und Herz und Augen herausreißen und das alles wieder hinein machen, ohne daß ihr es merkt.«
Soldaten sind ein leichtes Blut, daher besannen sich die drei gar nicht lang, sondern sagten frisch zum Doktor: »Wenn du das kannst, so sollst du deine Kunst an uns probieren.«
Als nun die Nacht heran kam und die drei Soldaten im Bett lagen und schliefen, da trat der Doktor in ihre Kammer und nahm dem ersten den Arm ab, schnitt dem zweiten das Herz aus dem Leib und riß dem dritten die Augen heraus. Die drei Stücke brachte er dem Wirt und sagte, er möge sie gut aufbewahren bis nach Mitternacht.
Der Wirt nahm die drei Stücke zu sich, tat sie aber an einen Ort, wo sie die Katze gewahrte und davon trug. Als er nun einmal schauen ging, ob die drei Stücke wohl noch an ihrem Platz seien, gewahrte er zu seinem großen Schrecken, daß alles weg gekommen war.
Als er eine Weile nachdachte, erinnerte er sich, gehört zu haben, daß ein Schwein und ein Mensch ein ähnliches Herz haben. Er stach also schnell ein Schwein ab und nahm das Herz heraus. Nun hatte er freilich wieder ein Herz, aber noch keine Augen und keinen Arm.
Ah was, dachte er sich, Menschenaugen und Katzenaugen gleichen sich ja, erwischte eine Katze und stach ihr die Augen aus. Dann lief er hinaus zu dem Galgen, schnitt einem Gerichteten einen Arm ab, ging heim und hob vor dem Schlafengehen die drei Stücke gut auf, damit sie ihm nicht wieder weg kämen.
Nach Mitternacht kam der Doktor zu dem Wirt und begehrte von ihm die drei Stücke. Der Wirt stand auf und gab ihm Herz, Augen und Arm. Der Doktor glaubte, daß diese Stücke keine anderen seien, als die er dem Wirt zur Aufbewahrung gegeben hatte.
Er ging also in die Kammer der drei Soldaten und heilte ihnen die drei Stücke an, dem ersten den Arm, dem zweiten das Herz und dem dritten die Augen. Als die drei aufwachten, fragten sie einander: »Spürst du etwas? Spürst du etwas?« Allein keiner wollte etwas spüren. Dann gingen sie in die Wirtsstube und lobten den Doktor, weil er gar so kunstreich kurieren könne.
Hierauf machten sie aus, alle vier in einem Jahr wieder in dieses Wirtshaus zu kommen und zu erzählen, was ihnen inzwischen begegnet sei. Somit ging jeder seiner Wege.
Nach einem Jahr trafen die drei Soldaten und der Doktor wieder in dem Wirtshaus zusammen. »Nun, nun, wie geht's, wie steht's?« fragte der Doktor den Soldaten, dem er den Arm kuriert hatte.
Es ginge ganz gut, antwortete er, »aber das ist ein spaßiges Ding seit einem Jahr. Wenn ich etwas zu Gesicht kriege, was einem anderen gehört, so will der Arm, den Ihr mir herein gemacht habt, immer darnach tappen.«
Dem Doktor kam das spanisch vor, und er fragte den zweiten, dem er das Herz hinein gemacht hatte: »Und wie geht's denn dir? Was hast du gemacht das ganze Jahr?« »Mir ginge es sonst schon gut«, antwortete er, »aber sooft ich einen Kot sehe, kommt mir gerad vor, ich müsse hinein springen und mich darin wälzen.«
»Sonderbar, sonderbar«, sagte der Doktor und frage den dritten: »Wie geht's denn dir mit deinen Augen?« »Oh, mir geht's nicht schlecht, aber ich weiß nicht, was das ist seit einem Jahr. Sooft ich eine Maus sehe, mein' ich immer, ich müßte darauf los springen wie eine hungrige Katze.«
Der Wirt war nebenan gestanden, während sie das erzählten, und die Geschichte fing an, ihm in den Magen zu gehen. Der Doktor, der wohl merkte, daß mit den drei Stücken etwas vor sich gegangen sein mußte, wandte sich zu ihm und wollte ihn fragen. Der Wirt aber ließ den Doktor gar nicht zu Wort kommen und bekannte alles ein, wie es ihm mit den drei Stücken ergangen war, denn er dachte sich, das Lügen hilft da doch nichts mehr, höchstens, daß es mir noch schlechter geht.
Die Soldaten verstanden jetzt wohl, warum sie seit einem Jahr so sonderbare Gelüste verspürten. Weil ihnen aber durch die Nachlässigkeit des Wirts nichts Ärgeres begegnet war, so verlangten sie von ihm nichts anderes zur Strafe, als daß er ihnen tüchtig Geld gebe.
Und wieviel haben sie denn verlangt?
Das weiß ich selbst nicht, mein Kind, und der es mir erzählt hat, hat's auch nicht gewußt.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DAS BIRKENREIS ...
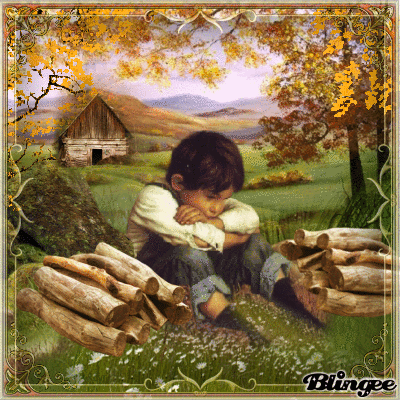
Es lebte einmal eine arme, arme Mutter; die hatte kein Brot, um sich und ihr Kind zu nähren. Sie und ihr Knabe lebten nur von fremder Leute Gnade, und wenn sie ihre Wassersuppe kochen wollten, so mußten sie selbst in den Wald gehen, um sich das Holz zu holen. Das war eine gar traurige Wirtschaft, wobei der Hunger der Koch und der Schmalhans der Hauser war.
Einmal hatte die Mutter wieder kein Scheitlein Holz und sprach zum Knaben: »Sepp, geh in den Wald hinaus, denn ich habe kein Scheitlein Holz mehr, um uns die Suppe zu wärmen. Mach dich aber vorwärts und bring heute mehr Reisig heim, denn morgen ist ein Feiertag.«
Der Knabe ließ sich das nicht zweimal sagen, steckte in seinen Schnappsack ein Stücklein schwarzes Brot, nahm das Seil, um das Holzwerk zusammen zu binden, und wanderte (obwohl er hungrig war) willig in den grünen Wald hinaus. Als er im Forst war, fing er an, Holz und Reisig zu sammeln, daß ihm der Schweiß von der Stirn nieder tropfte und er seinen Hunger vergaß.
Es dauerte nicht gar lange, und der brave Sohn hatte schon ein großes Holzbündel, das er nun zusammenband und auf dem Kopfe weiter trug. Es war ein warmer Tag, und die Sonnenstrahlen brannten gewaltig heiß nieder, als der Knabe so durch den Wald ging und unter der schweren Bürde einher keuchte.
Er glaubte, er könne das Holz nicht mehr weiter bringen, so matt und müde war er, und dazu kam noch der leere Magen, der sich auch mehr und mehr meldete. Er schnitt wohl ein saures Gesicht, und doch freute sich das brave Kind, wenn es an die Freude dachte, die seine Mutter beim Anblick des großen Bündels haben würde.
Wie er so hintrollte und an die Mutter dachte, stand plötzlich ein Weiblein vor ihm. Das war steinalt, ihr Gesicht war voll Runzeln, und ihre Augen funkelten wie zwei Feuer. Ein Bündel Holz lag zu ihren Füßen, und sie klagte, daß sie die Last nicht mehr weiter bringen könne.
»Geh, hilf du mir!« sprach das unheimliche Weibchen den daher kommenden Knaben an. »Ja«, meinte er, »ich habe selbst genug zu tragen und darf die Mutter nicht zu lange warten lassen.« »Ei, du hast junge Füße«, entgegnete die Alte lächelnd. »Du kommst noch früh genug heim, wenn du mir auch das Holz zur Hütte trägst; denn mein Häuschen ist nicht weit von hier, und wenn du mir folgst, soll es dich gewiß nicht reuen. Ich will dich dafür gut bezahlen.«
Der Knabe dachte sich: Das wird eine schöne Bezahlung sein; das Weiblein hat ja selbst nichts. Er ließ sich aber dennoch bewegen, legte sein Bündlein ab, nahm das andere auf und trottete der Alten, die ihm den Weg wies, nach. Sie waren eine nicht große Strecke gegangen, als die Alte vor einem Hüttchen still stand und zum Knaben sprach: »Nun kannst du das Bündlein ablegen, denn hier ist meine Behausung. Warte nur ein bißchen, und ich werde dich bezahlen.«
Der Knabe legte das Bündlein ab, und es wunderte ihn sehr, was das arme Waldweiblein, das ins Hüttchen gegangen war, ihm bringen werde. Es dauerte nicht lange, da trat das Weiblein wieder heraus und trug ein Birkenreis in der Hand. Das alte Mütterchen kam jetzt dem Knaben viel größer vor und es war so feierlich und ernst, daß er sich fast fürchtete.
»Du bist ein braves Kind, das mit armen und alten Leuten Mitleid hat, und dafür will ich dich belohnen. Nimm dieses Birkenreis und bewahre es gut, denn es wird dir goldene Früchte tragen.« Mit diesen Worten gab sie ihm das Reis und war ins Haus verschwunden.
Der Kleine mußte über das Geschenk beinahe lachen, doch behielt er den Zweig und eilte in den Wald zu seinem Holzbündel zurück. Er nahm es wieder auf den Kopf, trug die Gerte in der rechten Hand und wanderte durch den Wald. Da war er aber gar bald matt und müde, daß ihm die Augen zufielen und er sich dachte: Ich will ein wenig rasten und schlafen, denn so geht das Fuhrwerk nimmer weiter.
Gesagt, getan. Er legte das Bündlein ab, steckte das Birkenreis in die Erde, streckte sich dabei in das weiche Moos und fing an, süß und sanft zu schlummern. Als die Sonne sich neigte und die Abendluft durch den grünen Wald zog, erwachte der Junge erst aus seinen schönen Träumen und rieb sich den schweren Schlaf aus den blauen Augen.
Sein erster Blick wurde auf das Holzbündel, sein zweiter auf das kostbare Birkenreis geworfen; doch wie groß war sein Erstaunen, als er an der Stelle des Zweiges einen stolzen Baum sah, an dem goldene und silberne Blätter und Früchte um die Wette flimmerten und glänzten.
Ein Schrei der Freude entrang sich seiner Kehle, und jubelnd sprang er zum Wunderbaum und begann Blätter und Äpfel abzupflücken und sie in seinen Sack zu stecken. Als er gefüllt und so schwer war, daß er genug zu tragen hatte, nahm Sepp vom Wald und seinem Bündel Abschied und eilte der Heimat zu.
Die Mutter hatte indessen mit Bangen und Sehnen auf den lange weg bleibenden Knaben geharrt und befürchtete ein Unglück. Wie groß war ihre Freude nun, als sie ihren Sohn in die Hütte treten sah und ihn jubeln hörte.
Doch wie sie ihn ohne Holz und Reisig sah, wurde sie böse und sprach: »Wo hast du dich den ganzen Tag herumgetrieben? Ich habe dich am frühen Morgen um Holz in den Wald hinaus geschickt, jetzt ist es später Abend, und du kommst ohne ein Scheitlein zurück.«
»Sei nicht böse, liebes Mütterchen«, fiel nun beschwichtigend der Knabe ein, »ich habe wacker gearbeitet, und du sollst mit mir zufrieden sein.« Bei diesen Worten schüttete er die silbernen und goldenen Blätter und Früchte auf den runden Tisch heraus, und die Schätze funkelten und glänzten, daß der Mutter fast das Sehen verging.
»Woher hast du dieses goldene Zeug?« fragte besorgt die Mutter, denn sie fürchtete, der Schatz könne nicht auf rechtem Wege erworben sein. »Ich habe das alles im Wald verdient«, jubelte der Junge auf und blickte mit freudetrunkenen Augen die erstaunte, glückliche Mutter an.
Er erzählte ihr nun die Geschichte vom alten Weiblein und vom Gold tragenden Baum. Die Mutter war nun beruhigt und hoch erfreut, und seit diesem Tage litten beide keinen Mangel mehr, sondern waren reiche Leute.
Und wo ist das Bäumlein jetzt?
Es steht im dichten Wald draußen, eine Viertelstunde hinter der Kapelle, und nur brave Buben können es finden. Oft bringt auch der heilige Nikolaus, wenn die Kinder fleißig beten, ihnen ein
solches Bäumlein, und wenn du recht fromm bist, wird dir der heilige Mann auch eins bringen.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Innsbruck
HANSL GWAGG-GWAGG ...
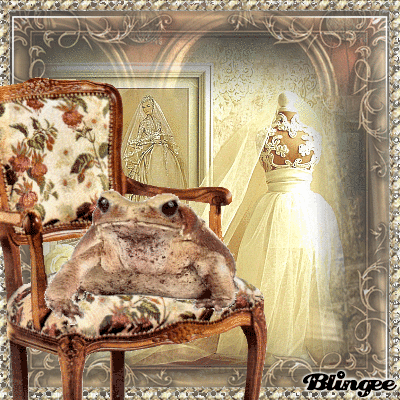
Es war einmal eine Mutter, die hatte drei Söhne, von denen der jüngste Hansl hieß und, wie wohl mehrere seines Namens, ein rechter Lappe war. Außer den drei Buben besaß die Mutter nur noch ein kleines Hüttlein, und das war zu klein, als daß alle drei darauf hin hätten heiraten können. Nachdem das Weib lange hin und her gedacht hatte, was denn da anzufangen sei, kam sie auf einen Gedanken, der allem Zweifel und Streit ein Ende machen sollte.
Sie stieg in die Dielenkammer hinauf, nahm drei Riedel Haar und ging damit in die Stube hinab, wo die drei Buben eben bei der Jause saßen. Sie setzte sich auch an den Tisch, legte die drei Riedel vor sich hin und begann: »Ihr wißt wohl, daß unser Anwesen klein ist und für drei Familien nicht ausreicht. Es hat mir schon viel Kummer gemacht, welchen von euch ich den anderen beiden vorziehen und als Erben einsetzen soll.
Da hat nun jeder von euch einen Riedel Haar, den mögt ihr zu euren Mädeln tragen, und wer seinen Riedel am schönsten gesponnen zurück bringt, dem gehört unser Höflein zu eigen, und er mag sich sein Mädel als Eheweib heimführen.« Sie verteilte nun die Riedel an die drei Buben und machte sich wieder zur Tür hinaus.
Die zwei älteren Brüder waren Pudel närrisch vor Freude und jeder dachte sich: Da kann es nicht fehlen. Die Meinige spinnt am schönsten im ganzen Revier, und in einigen Wochen geht es an die Hochzeit. Noch am selben Abend gingen sie zu ihren Mädeln in Heimgart und brachten ihnen die Riedel und erzählten, was die Mutter gesagt habe.
Dem Hansl aber kam die ganze Geschichte spanisch vor, und er wußte nicht recht, was er mit dem Riedel anfangen sollte. Abends machte er sich aufs Geratewohl mit seinem Riedel auf den Weg und
schlenderte ein Stück durch das Moos hin.
Er dachte nur daran, wo er etwa eine gute Spinnerin finden könnte, und schaute nicht rechts und nicht links. Auf einmal hörte er eine Stimme, die ihm in einem fort zurief:
»Hansl, wo gehst hin?
Gwagg, gwagg.
Hansl, wo gehst hin?
Gwagg, gwagg.«
Er schaute drein wie ein Narr, als er immerfort diese Worte hörte, und spähte nach allen Seiten hin, um zu erfahren, wer denn der müde Schreier sei. Er sah aber keinen Menschen weitum und bemerkte nur in der Nähe eine Pfütze, aus der die Stimme zu kommen schien. Er ging hin, und da sah er eine mächtige Kröte auf ihn zu patschen, die schaute ihn gar freundlich an und schrie noch in einem fort:
»Hansl, wo gehst hin?
Gwagg, gwagg.
Hansl, wo gehst hin?
Gwagg, gwagg.«
Hansl erzählte nun die ganze Geschichte, daß er sich um eine Spinnerin für den Riedel umsehen müsse, den er bei sich trage, und daß diese Spinnerin, wenn sie das Stück Arbeit recht gut vollendet hätte, sein Weib werden sollte.
Die Kröte hatte fleißig aufgemerkt, und wie die Erzählung zu Ende war, fing sie wieder an zu schreien und schrie in einem fort:
»Hansl, nimm mi!
Gwagg, gwagg.
Hansl, nimm mi!
Gwagg, gwagg.«
Wie er die Kröte so wehmütig bitten hörte, nahm Hansl den Riedel, warf ihn vor sie hin und blieb als dann noch eine geraume Weile auf dem gleichen Fleck stehen. Denn es wunderte ihn, was das plumpe Tier mit dem Haar wohl anfangen würde.
Rasch packte die Kröte den Riedel und fuhr damit um einige Stauden herum, so daß der Hansl gar nicht recht verstand, worauf denn das eigentlich hinaus wolle, und ärgerlich von dannen ging. Er riß sich fast die Haare aus, daß er dem dummen Tier seinen Riedel vorgeworfen habe, und mißmutig grübelte er vor sich hin: »Da hast du wieder den Gescheiten gespielt. Hättest du das Haar behalten, so hättest du doch etwas, jetzt aber hast du gar nichts mehr.«
Am anderen Tag ging ihm wieder die Geschichte vom vorigen Abend im Kopf herum, und es kam ihm in den Sinn, doch noch einmal nachzuschauen, wie die Kröte mit dem Riedel gehaust habe. Vielleicht, dachte er sich, geht die ganze Geschichte am Ende doch nicht übel aus.
Er ging nun hinaus zur Pfütze und war nicht wenig erstaunt, als er einen großmächtigen Strähn des feinsten Garns um die Stauden gezogen sah. Die Kröte kam auch wieder heran gepatscht, schaute mit ihren kugelrunden Augen zum Hansl auf und sagte: »Du wirst sehen, Hansl, daß das Haar deiner Brüder nicht so fein gesponnen ist wie das deinige und daß das Anwesen dir zufallen wird. Aber weißt du, Hansl, dann mußt du mich auch heiraten!«
Bei diesen Worten machte Hansl ein saures Gesicht, die Kröte aber schaute ihn schelmisch an, und nachdem sie eine Weile seine Grimassen betrachtet hatte, fuhr sie wieder fort: »Hast du das Hüttlein einmal in Händen, so mach nur einen kurzen Prozeß und laß unsere Hochzeit nach Schick und Brauch dreimal verkünden.
Dann laß in der Pfarrkirche ein feierliches Amt singen, und wenn ich auch noch nicht dabei bin, so soll dir deswegen kein graues Haar wachsen. Aber während des Amtes muß mein Brautkleid in der Sakristei bereit sein, und dann wird schon alles recht werden. So, behüt' dich Gott, Hansl!«
»Behüt' dich Gott, Krötl«, sagte Hansl, stand noch eine Zeit lang da, als wenn er angepappt wäre, nahm dann den Strähn und ging wieder nach Hause. Er zeigte der Mutter das Garn, und sie konnte fast nicht begreifen, wie denn ein so feines Gespinst zustande gebracht werden könne. Die Brüder brachten auch ihr Garn, aber das konnte mit dem Strähn des Hansl gar keinen Vergleich aushalten, und es war daher schnell ausgemacht, wem das Hüttlein gehöre.
Hansl erzählte nun auch die Geschichte von der Kröte und sagte, daß er zum Pfarrer gehen wolle, um sich verkünden zu lassen. Da lachten Mutter und Brüder, daß ihnen der Bauch nagelte, und schalten ihn einen Lappen, daß er sich so etwas einfallen lasse. Er aber blieb bei seinem Vorhaben und ging zum Pfarrer.
Der Pfarrer mußte über Hansls Einfall ebenfalls lachen, aber Hansl bestand auf seinem Begehren und sagte: »Kurzum, Ihr müßt mich verkünden und mir das Hochzeitsamt halten.« Der Pfarrer gab endlich doch nach, und Hansl ging vergnügt nach Hause.
Nach vierzehn Tagen war das Brautpaar ausverkündet, und es kam der Hochzeitstag. Hansl ging mit dem Brautzug in die Kirche, hängte aber zuvor das Brautkleid in der Sakristei auf. Das Amt fing an, es kam das Gloria, Credo, aber die Braut wollte sich noch immer nicht sehen lassen. Hansl schaute von Zeit zu Zeit verzagt auf die Sakristeitür, aber niemand kam heraus.
Das Amt wollte schon zu Ende gehen, und der arme Bräutigam hätte sich gern in das Loch einer Kirchenmaus hinein gewünscht. Die Leute, die in der Sakristei waren, schauten auch neugierig ins Freie hinaus, ob denn wirklich etwas kommen werde oder ob Hansl wieder einmal einen recht dummen Streich gespielt habe. Sie glaubten schon das letztere, als auf einmal jene Kröte heranhüpfte und in die Sakristei hinein patschte. Da schaute das garstige Tier neugierig herum, und als es das Brautkleid sah, hüpfte es mit einem Satz hinein.
Holla! wie rissen da die Kirchenbuben und Messnerknechte die Augen auf, als auf einmal eine wunderschöne Jungfrau in dem Kleid steckte, sich bewegte und in die Kirche hinaus ging und neben den Hansl hin kniete. Dieser aber war fast außer sich vor Verwunderung, und er getraute sich kaum, seine Braut recht anzuschauen, so schön war sie.
Die Leute in der Kirche vergaßen auf einmal den Geistlichen am Altar, und alles reckte die Köpfe auf und schaute nur mehr auf die schöne Braut. Das Amt war schnell zu Ende, der Pfarrer trat vom Altar herab und gab das Brautpaar zusammen. Dann ging es ins Wirtshaus zu Tisch und Tanz, und Hansl freute sich sein Lebtag, daß er ein so schönes und braves Weib bekommen hatte.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Absam
SCHNEIDER FREUDENREICH ...
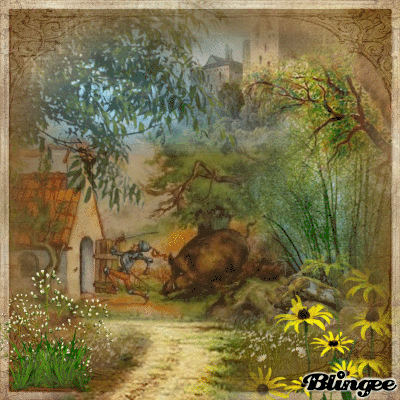
In uralter Zeit, als anstatt der Murbrüche noch die schönsten Wälder Hügel und Wand bekleideten, lebte ein armes Schneiderlein, das nur mit Mühe sein tägliches Brot sich erwarb und sich schwer durchs Leben brachte. Oft litt er Hunger und konnte seinen Durst nur am Brunnen stillen.
Da dachte er sich einmal: Heute ist Festtag und ich will mich auch einmal satt essen. Er kochte sich ein Hafermus, das so dicht und fest war, daß wohl Dragoner hätten darauf exerzieren können. Dann setzte er sich behaglich hin und fing an zu essen, daß es einem den Mund wässern machte.
Wie die Fliegen das sahen, kamen sie auch herbei, wollten ihr Teil haben und setzten sich auf den Brei. Darüber wurde der Schneider nicht wenig zornig, erhob seine Rechte, zielte und führte einen so gewaltigen Streich auf die armen Tierchen, daß sieben mausetot blieben und die übrigen erschreckt eiligst davon flohen. Als dies der Schneider sah, bildete er sich nicht wenig ob dieser Heldentat ein und wußte nicht, was er aus Freude anfangen sollte.
Endlich nahm er einen Zettel und schrieb mit großen Buchstaben darauf:
»Schneider Freudenreich
Schlägt sieben auf einen Streich.«
Den Papierstreifen mit diesen Worten heftete er auf seinen Hut, setzte diesen auf und zog seinen Sonntagsfrack an. Dann stieg er stolzierend aus seinem Stübchen und schritt mit herausfordernder Miene durch die Gasse des Dorfes. Da sahen nun alle, die ihm begegneten, den Zettel und lasen ihn. Davon bekamen sie großen Respekt vor dem Schneider, und in jedem Heimgart sprach man nur mehr vom Schneider und seiner riesenmäßigen Stärke.
Das gefiel ihm nicht wenig, und er nahm weder den Zettel vom Hut noch den Hut vom Kopf. Darob verbreitete sich der Ruf vom heldenhaften Schneider immer weiter und weiter und drang selbst bis zur Königsstadt. Das war bei Hofe eine gar erwünschte Märe, denn man hatte dort einen baumstarken Mann vonnöten, weil ein furchtbarer Eber im königlichen Tiergarten tagtäglich großen Schaden anrichtete.
Wie der König vom tapferen Schneider hörte, war er sehr froh und ließ ihn durch einen Läufer herbei holen. Das gefiel dem eitlen Schneider nicht wenig, und er begab sich im besten Sonntagsputz in die Residenz, wo der König Hof hielt. Dort wurde er gar huldvoll empfangen und königlich bewirtet.
Das sagte dem Schneider zu, und er aß und trank, als ob er ein Riese gewesen wäre. Der König erzählte ihm vom Untier, das dem Tiergarten so großen Schaden zufügte, und forderte vom Schneiderlein Hilfe. Als Lohn versprach ihm der König seine schöne Tochter zur Ehe und das Königreich zum Erbe.
Da ging Schneider Freudenreich auf den Antrag ein und machte sich flugs ans Werk. Singend und pfeifend wanderte er in den Wald hinaus, um dort das Abenteuer zu bestehen. Er war guter Dinge und suchte links und rechts und rechts und links nach dem Schadentier, doch all sein Suchen und Forschen war vergebens.
Als er schon alle Hoffnung, das Untier zu finden, aufgegeben hatte, knickte und krachte es plötzlich durch das Dickicht daher, daß dem Schneider Sehen und Hören hätte vergehen mögen. Der wilde Eber raste durch Busch und Baum daher, riß alles vor sich nieder und stürzte auf das Schneiderlein los.
Doch dieser faßte sich schnell, streckte lustig seine Beine aus und lief Hals über Kopf in eine Kapelle, wo er sich hinter die Tür stellte, die er offen ließ. Der Eber stürzte bald wutschnaubend und pfeilschnell durch die offene Pforte und vor zum Altar. Das Schneiderlein war aber ebenso schnell durch die Tür hinaus und schlug sie zu, daß die Kapelle zitterte. So war nun das Wildtier gefangen und konnte des Hungertodes sicher sein, denn all sein Toben und Wüten war fruchtlos.
Das Schneiderlein war über diese Tat nicht wenig erfreut und kehrte triumphierend in die Königsstadt zurück, wo er mit Jubel empfangen wurde. Er wurde von einem langen Zug Menschen in die Königsburg begleitet, wo er dem König seine Heldentat erzählte und um die versprochene Belohnung bat.
Dieser kam aber, anstatt sein Versprechen zu erfüllen, mit einer neuen Bitte. Denn eine neue Gefahr, weit schrecklicher als die erste, drohte dem Königshaus mit Tod und Verderben. Ein unzählbares Feindesheer war in das Reich eingefallen, und alle Heere, die man ihm bisher entgegengestellt hatte, waren geschlagen und vernichtet worden. Das Volk verweigerte aber den Kriegsdienst, weil es sich dachte, der Feind kann gegen uns und gegen alles, was uns heilig ist, nicht schlimmer walten als der König.
Der König war deshalb in einer verzweiflungsvollen Lage und bat das Schneiderlein um Hilfe und versprach ihm die Prinzessin zur Frau und das Reich als Erbe. Das Schneiderlein ging auf die Bitte ein, stieg in den Hof hinunter und ließ sich das beste Streitroß, das im königlichen Stall war, satteln, schwang sich so dann hinauf und ließ sich so fest daran schnüren, daß er droben saß, als wäre er angenagelt.
Dann sprengte er davon wie das Wetter, und die Knappen des Königs folgten ihm als ihrem Führer und zogen dem Feind entgegen. Der Weg führte sie an einem Kruzifix vorbei. Da dachte sich das Schneiderlein, alles muß mit Gottes Hilfe geschehen, hielt still, umfaßte das Kreuz und riß es aus der Erde. Er trug es mit sich und ritt dem Feind entgegen.
Als die Feinde den Schneider mit dem Kreuz sahen und auf seinem Hut lasen: »Sieben auf einen Streich«, faßte sie ein gewaltiger Schreck. Sie machten rechtsum, liefen davon und ließen sich nie mehr sehen. So wurde der Krieg glücklich ohne Blutvergießen beendigt.
Siegreich kehrte nun das Schneiderlein in die Königsstadt zurück und wurde auf das herrlichste empfangen. Besonders gut wurde er am Hofe aufgenommen, und es wurde eine große Tafel dem Schneiderlein zu Ehren veranstaltet, wobei es gar lustig herging und an Weinen und Braten nicht fehlte. Das Schneiderlein wurde hoch gefeiert und hatte alles ganz nach seinem Willen.
In diesem glücklichen Leben wurde es jedoch bald gestört, denn es war noch ein Feind zu bewältigen. Es hausten drei wilde Riesen im Wald draußen auf ihrer Burg und kümmerten sich weder um Recht noch um Ordnung. Sie taten nur, was ihnen taugte, schalteten nach Willkür und übten weit und breit List und Grausamkeit. Diese sollte nun das Schneiderlein auch demütigen und andere Sitten lehren.
Er besann sich nicht lange und marschierte schnurgerade auf die Riesenburg los.
Als er im grünen Wald zur Wohnung der Riesen kam, dunkelte schon der Abend heran. Er stellte sich müde und matt, klopfte an das Tor mit dem daran befestigten Hammer und bat, als ihm geöffnet
wurde, um eine Nachtherberge. Sie wurde ihm gerne gewährt.
Er wurde auf das gastfreundlichste aufgenommen und in ein herrliches, vor Gold und Silber funkelndes Zimmer geführt. Dort standen auf einem Tisch die kostbarsten Speisen und die besten Weine, und der Schneider ließ es sich dabei kreuzwohl sein. Die Riesen meinten es aber mit dem tapferen Schneider nicht ehrlich, denn sie fürchteten ihn und wollten ihn durch List aus dem Weg räumen. Deswegen taten sie so freundlich gegen ihn und zechten mit ihm um die Wette.
Nachdem sie bis tief in die Nacht hinein geschlemmt und getrunken hatten, stellte sich endlich der Schlaf bei allen ein. Da wurde dem Schneider ein schönes Schlafzimmer angewiesen, in dem eine eiserne Bettstatt war. Der Schneider streckte sich also gleich seiner Länge nach aufs Bett und fing an zu schnarchen, daß fast die Wände zitterten. Er lag aber ganz an einer Seite, und das war sein Glück, denn die Riesen blieben wach und warfen, sobald sie glaubten, daß der Schneider eingeschlafen sei, große Steine aus einer Öffnung am Oberboden auf ihren Gast herab.
Der Schneider gähnte, als er dies bemerkte, lachte dann und rief mit dem größten Gleichmut zu den Riesen hinauf: »Ihr Lumpen, wißt ihr denn nichts Besseres zu tun, als Erbsen auf mich herab zu werfen?« Dann griff er nach den Steinen und warf sie mit solcher Kraft durch das Loch an der Zimmerdecke, daß zwei Riesen davon tot zu Boden stürzten. Das jagte dem dritten eine so große Furcht ein, daß er sich eiligst verbergen wollte.
Aber jetzt dachte der Schneider nicht mehr an Schlaf. Da zwei Riesen tot waren, sollte auch der dritte nicht mit heiler Haut davon kommen. Der Schneider machte deshalb Licht und ging in die Riesenkammer hinauf. Als er dort eintrat, hatte der Riese gerade eine Leiter durchs Lichtloch angelehnt, stand darauf und wollte auf das Dach hinauf fliehen. Da ergriff der Schneider die Leiter, zog sie ihm weg, und der Riese fiel in den Hof hinunter und zerschmetterte ganz und gar.
Nun waren die drei Riesen tot und der Schneider Herr des Schlosses. Als er es genug besichtigt hatte, schwang er sich auf ein Roß und ritt in die Königsstadt, wo er freudig empfangen und bei Hof gar gut aufgenommen wurde. Er mahnte nun den König an sein Versprechen und erhielt auch die Prinzessin zur Braut.
Da gab es eine gar lustige Hochzeit, und das tapfere Schneiderlein war und blieb der glücklichste Mensch auf der Welt.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus dem Ötztal
VON DER ERSCHAFFUNG DES MONDES ...

Als Sankt Michael Adam und Eva aus dem Paradiese vertrieben hatte, kehrte er zurück in den Himmel. - 'Nun, hast du sie rausgejagt, diese Herrgottssakramenter?' fragt der Gottvater. -
'Hätt' der Herr auch einen anderen schicken mögen!' brummt Sankt Michael in seinen Bart - nein, Bart wird er keinen gehabt haben. 'Ich hab' mir', sagt er, 'in dieser Höllenfinsternis da unten das Knie angestoßen, daß schon all des Teufels! Beim Tag geht's noch an, da schupfen die Engel den Sonnenball hin und wieder; aber in der Nacht ist das schon eine stockfinstere Welt übereinander! Kann's der Eva gar nicht für übel halten, wenn sie in der rabenschwarzen Nacht einen unrechten Apfel erwischt hat; wird schon noch öfters so was passieren. Die Leut' müssen einen Mond haben!' -
'Ja?' fragt der Gottvater, 'nu, so steh ein wenig beiseite, Sankt Michael, ich erschaff' jetzt den Mond!' - Richtig, hat's getan! 'Aber', sagt der Gottvater, 'auf daß die Leute wissen, daß es nur ein guter Wille ist von mir, und daß sie sich nicht eine Rechtssache daraus machen, so lasse ich den Mond im Monat allemal 14 Nächte scheinen, die übrigen 14 Nächte laß ich's finster sein.'
Und deswegen haben wir den zunehmenden und den abnehmenden Mond.
Österreich: Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Märchen - Aus Steiermark
WARUM DIE SCHWEINE RINGELSCHWÄNZE HABEN ...
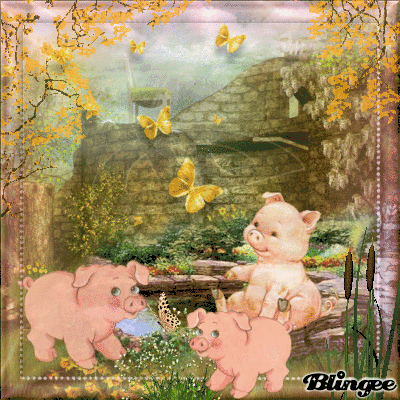
Einmal kam der Teufel zu einem Bauer und sagte: 'Bauer, ich bin imstande alle deine Schweine über das Dach des Schweinestalls zu werfen.' - 'Das ist keine so große Kunst,' erwiderte herzhaft der Bauer, 'das kann ich auch.' -
'Versuch's einmal!' entgegnete der Teufel. Der Bauer zögerte nicht lange, sondern machte sich gleich an die Arbeit. Aber nur bei einem einzigen Schwein gelang es ihm, es über das Stalldach zu werfen. 'Siehst du, was du für ein Prahlhans bist!' sagte der Teufel. 'Jetzt schau einmal her!'
Da nimmt der Teufel ein Schwein nach dem anderen, macht jedem am Schwanz eine Schlinge, um es bequemer halten und desto weiter und höher schleudern zu können, und wirft richtig eins ums andere über das Stalldach. Seither tragen die Schweine Ringelschwänze.
Österreich: Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Märchen, Märchen aus dem obersteirischen Gebirge
DIE VIER TÜCHER ...
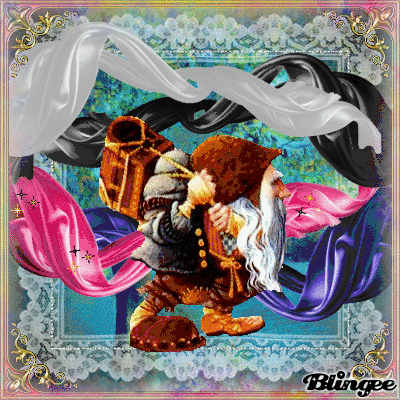
»Ihr seid nun groß und stark«, sagte ein Vater zu seinen vier Söhnen, »und müßt euch auch einmal in der Welt umsehen - vielleicht macht ihr euer Glück -, hier könnt ihr doch nicht immer bleiben.«
Darüber waren die rüstigen Jungen sehr erfreut und wollten nun alle zugleich in die Fremde gehen, denn schon lange war das ihr sehnlichster Wunsch. Der Vater aber bedeutete ihnen, daß er sie doch nicht alle auf einmal von sich entlassen könne, sondern es werde an jeden die Reihe kommen, sobald nur der andere zurückgekehrt sei.
Damit waren die Brüder zufrieden, und der älteste sollte zuerst Stock und Reisebündel nehmen und sich auf den Weg machen. Einen guten Spruch, den ihm der Vater ans Herz gelegt hatte, im Gedächtnis und einige Groschen als Reisegeld von der Mutter in der Tasche, verließ Wastl, so hieß der Bursche, das väterliche Haus und ging, ein Liedlein trällernd, aufs Geratewohl der Nase nach, da er selbst nicht wußte, wohin er wollte.
Er war schon eine ziemliche Strecke fort gegangen, als ihm ein kleines, graues Männlein begegnete, das ihn fragte, ob er nichts zu verschachern habe? »Nein«, antwortete Wastl, »ich verstehe mich schlecht aufs Schachern«, und wollte vorwärts. »Nun, eil doch nicht so«, sagte lachend das Männlein, »vielleicht habe ich etwas, was dir zu seiner Zeit wohl bekommen dürfte. Hat dir nicht die Mutter Geld gegeben auf die Reise? Geh, kauf mir dieses Tuch da ab!«
Wastl wunderte sich nicht wenig, als der winzige Wicht, den er doch nie zuvor gesehen hatte, von den paar Groschen wußte, die ihm das Mütterchen zugesteckt hatte; doch getraute er sich nicht zu widersprechen, denn ihm wurde völlig unheimlich. Er ging daher auf den Kauf ein und wanderte dann, unbekümmert um das Männlein, weiter, ja er hatte nicht einmal das Tuch recht angesehen, weil ihn gruselte.
So ging er zwei Tage seines Weges. Als aber der zweite Tag zu Ende ging, da wußte er keine Nachtherberge. Nirgends sah er ein Wirtshaus, sondern es lag ein großer, dunkler Wald vor ihm. Wenn nur ein Haus in der Nähe wäre!, dachte er, und kam so nachsinnend immer näher und endlich ganz nahe an den Wald.
Aber erst jetzt fiel es ihm ein, daß er ja kein Geld mehr habe, und er lachte über sich selbst, wie es ihm habe einfallen können, ohne Geld weiterzugehen oder gar an einen Abendschmaus zu denken. Mißmutig setzte er sich nieder, nahm sein Tuch heraus und breitete es lachend vor sich auf den Boden.
Er schaute es nun zur Kurzweil an, weil er nichts Besseres zu tun wußte. Es war hellrot und mit goldenen und silbernen Sternlein auf den Seiten ganz übersät. Ihm gefiel es, als er es so betrachtete, nicht übel, aber Geld hätte ihm doch noch besser gefallen. Da dachte er: Ja, hätte ich nur so viele Taler, als Sternlein darauf sind, dann wär es schon recht.
Kaum gedacht, da lagen auch schon die klingenden Taler zuhauf auf dem Tuch, ohne daß unser Wastl wußte, wie das zugegangen war. Nun fing er an, das Geld in seine Tasche zu stecken, und merkte gar nicht, daß es Nacht und immer dunkler und dunkler wurde. Und als er es gewahrte und fort gehen wollte, sah er sich von einer Schar Räuber umgeben, die ihn her nahmen und herumstießen, daß ihm Sehen und Hören verging. Er mußte, ob er wollte oder nicht, zu ihnen in die Höhle, wo er eine nicht verhoffte Nachtherberge fand.
Am anderen Tag versammelten sich die Räuber um ihn und wollten, wie sie sagten, die Sache ganz kurz machen, wenn er ihnen das Tuch nicht gebe. Wastl war froh, wenigstens mit dem Leben davon zu kommen, und ließ ihnen gerne, was sie verlangten. Darauf führten sie ihn aus der Höhle, und er wanderte nach kurzer Abwesenheit ganz betrübt wieder nach Hause und begehrte nicht mehr, in die Fremde zu gehen.
Als er daheim seinen Brüdern und dem Vater erzählte, wie es ihm ergangen war, versicherten die anderen drei, sie wollten sich gewiß besser in acht nehmen, und der zweite ließ nicht nach und bat immerfort, ihn ziehen zu lassen, bis endlich der Vater auch ihm das Reisebündel schnürte und die Mutter ihm einige Groschen gab und ihn wandern ließ.
Ganz wohlgemut zog er fort; aber nicht auf dem selben Weg wie sein Bruder, um sich vor den Wegelagerern zu hüten, und dachte immer: Wenn nur bald das graue Männlein käme und mir auch so ein Tuch brächte wie meinem Bruder! Ich wollte gewiß nicht erschrecken.
Und richtig, es dauerte nicht lange, da sah er ein Männlein, so klein wie ein Zwerg, daher kommen. Gleich fiel es ihm ein, das müßte das Männlein mit den Tüchlein sein. Die beiden redeten einander an, und das Männlein bot ihm ein Tüchlein zum Kauf an. Da kaufte denn unser Reisende das ihm angebotene Tuch dem kleinen Schacherer ab. Diesmal aber war es nicht mehr ein rotes, sondern ein blaues, mit runden Flecken und Flaschen bemaltes Tuch.
Kaum war das Zwerglein hinweg, setzte sich der frohe Hans, so hieß der zweite Bruder, ins Gras hin und wünschte Geld, soviel nur immer Gott Vater selber wünschen kann; aber es war umsonst. Jetzt fing ihn sein Handel zu reuen an. Er hörte nicht auf, den Zwerg einen listigen Betrüger zu nennen, und so lange grollte, schmähte und schalt er, bis seine Kehle ganz trocken wurde und er statt des Scheltens eine Flasche Wein sich wünschte.
Wie er aber diesen Wunsch getan hatte, stand auch schon die Flasche da, und nun meinte er, gehe es in einem hin, und er wünschte sich auch Speisen in Hülle und Fülle. Alle seine Lieblingsgerichte nannte er her, und also gleich stand alles schon zu Diensten.
Als es Abend wurde, ging er in ein nahe gelegenes Dorf und begab sich schnell in ein Wirtshaus, wo er vom Wirt nur ein Bett verlangte. Für das Nachtmahl, sprach er, werde er schon selber sorgen. Der Wirt wunderte sich, daß sein Gast so mir nichts dir nichts von der Straße ins Bett laufe, er ging daher dem selben nach und lugte beim Schlüsselloch ins Zimmer hinein.
Nun mußte er freilich sehen, wie Hans sich sein Nachtmahl zurichtete und wie ihm die Speisen mundeten. Da wässerten ihm die Zähne nach einer so wohl bestellten Küche. Er sann nun die ganze Nacht, wie er denn dieses Tuch sich verschaffen könnte, und am anderen Tag ließ er den Gast nicht aus dem Haus und tat so fein und schmeichelnd und zutraulich wie mit einem alten Bekannten, bis er ihn dahin gebracht hatte, für heute noch bei ihm zu bleiben.
Inzwischen aber schickte er nach den Gerichtsdienern und ließ ihn in der Nacht noch festnehmen, indem er ihn beschuldigte, er habe ihm die Zeche nicht bezahlt. So mußte Hans die Nacht im Kerker zubringen und konnte nur durch das Zurücklassen seines Tuches wieder frei werden.
Ganz zornig trat er den Rückweg an und kam endlich mißvergnügt über seine Reise nach Hause, wo er noch dazu von seinem dritten Bruder, Klaus, wacker ausgezankt wurde, der sich dann in aller Eile auch aufmachte, um zu versuchen, ob es ihm nicht besser glücken werde als den anderen zwei Brüdern.
Aber er mochte lange Zeit gehen, bis ihm das Männlein entgegenkam, so daß er schon zweifelte, ob ihm die Brüder wohl die Wahrheit gesagt hätten. Eben, als er so sinnend dahin schlenderte, spazierte auf einmal ein kleines, winziges, aber steinaltes Herrlein auf der Straße einher, und Klaus, der immer auf den Boden sah und in Gedanken rasch vorwärts ging, hätte das kleine Ding beinahe übersprungen.
Da schauten beide einander gewaltig groß an, und Klaus, fast erschrocken, wollte vorwärts eilen; der Alte aber hielt ihn, und lachend bot er ihm ein schwarzes Tuch zum Kauf an. Klaus ließ sich das nicht zweimal sagen, nahm schnell das Tuch für wenige Groschen und schritt dann rüstig weiter.
Kaum war das Männlein ihm aus den Augen, langte er als bald sein Tuch hervor und wünschte Geld - aber umsonst. Er wünschte Wein und Braten; aber es wurde keine Flasche sichtbar. Da ging ihm die Geduld aus, er kehrte und wendete das Tuch nach allen Seiten und gewahrte daran zufällig einen Riß, was ihn unwillig machte. Aber er nahm, weil er es doch nun gekauft hatte, das Tuch mit und hielt es vors Gesicht und lachte und schalt zugleich.
Auf einmal sah er seinen Vater und die Brüder zu Hause arbeiten und hörte, wie sie miteinander sprachen. Da merkte er, daß dies allemal der Fall sei, sooft er durch den Riß hindurch schaute. Nun, dachte er, das ist nicht übel, und freute sich über die neue Entdeckung.
Nun wanderte er weit und breit in der Welt umher. Da kam er in eine große, schöne Stadt, deren König eben gegen einen benachbarten Fürsten Krieg führte. Das hörte Klaus, und da fiel ihm ein: Ich könnte vielleicht ein angesehener und reicher Herr werden, und er bot sich dem König an, alles zu sagen, was seine Feinde gegen ihn im Sinne hätten.
Darüber war der König sehr froh und versprach ihm große Belohnung, wenn er in seine Dienste treten wolle, was jener auch gerne tat. Bald war nun der König Sieger über seine Feinde, und seine Macht wurde immer größer und größer. Aber dem, der ihm zu seiner Macht verholfen hatte, vergalt er seine guten Dienste schlecht. Denn sobald er merkte, auf welche Weise sein Dienstmann Klaus alles wissen konnte, nahm er ihm das Tuch, fertigte ihn mit schönen Worten ab und ließ ihn aus dem Land jagen.
Das hatte sich Klaus freilich nicht erhofft; um jedoch die Sache nicht noch schlimmer zu machen, nahm er sich vor, geradewegs nach Hause zu gehen und seinen jüngsten Bruder vom Reisen abzuhalten. Doch kaum war er daheim angekommen, wollte der jüngste auch schon fort und mochte es kaum erwarten, bis er über alle Berge hinweg wäre.
Weil der Vater den anderen erlaubt hatte, in die Fremde zu gehen, erlaubte er es, durch viele Bitten bewegt, auch seinem jüngsten und liebsten Sohn, wie sehr er ihm auch einschärfte, in der Fremde sei nicht der Ort zum Wohlleben. Der junge Wanderer dachte gar nicht, wie seine Brüder, an das Männlein, sondern nahm sich ernstlich vor, sich wenig um den Zwerg zu kümmern.
Doch dieser blieb auch bei ihm nicht aus, sondern kam nach einigen Wandertagen auch zu ihm und gab ihm für das Geld, das er noch hatte, ein weißes Tüchlein zu kaufen. Der Reisende hätte gerne sehen mögen, wozu denn etwa sein Tuch nütze, und kam endlich auf die Entdeckung, daß mit dem seinen die Kunst verbunden sei, sich unsichtbar zu machen.
Da ging ihm auf einmal ein Licht auf. - Geradewegs schritt er jetzt der Gegend zu, wo sein ältester Bruder unter die Räuber gefallen war, und schlich sich, da er einige von ihnen sah, in ihre Höhle. Hier fand er in einer Ecke das rote Tuch, das sie seinem Bruder weggenommen hatten, und machte sich unsichtbar damit davon.
Auf seiner Weiterreise sah er vor sich an der Straße ein großes, schönes Haus, und da eben die Sonne nicht gar hoch am Himmel stand, beschloß er dort zu übernachten, wenn man ihn aufnehmen würde. Als er ans Haus kam, stand ein wohlbeleibter Herr vor der Tür, der ihn gar höflich einlud, da zu bleiben.
Aha, dachte sich da der Reisende, das ist gewiß das Wirtshaus, wo mein Bruder so arg geprellt wurde. Er ging hinein und machte es geradeso, wie sein Bruder es früher gemacht hatte. Der Wirt, als er das sah, glaubte wieder einen reichen Fang zu machen und führte ihn in das nämliche Zimmer wie den früheren Reisenden.
Hier war auch noch das schöne blaue Tuch auf einem Tischchen, das unserem Jungen geschwind in die Augen fiel. Wie nun der Wirt sah, daß sein Gast anfing, auf einem roten Tuch Geld zu zählen, schickte er, ohne sich lange zu besinnen, zum Gerichtsdiener. Ehe aber der noch ankam, waren der Gast und das blaue Tuch verschwunden.
»Jetzt wird mir auch der Herr König nicht entgehen«, sagte er lachend zu sich selbst, als er das Wirtshaus verlassen hatte, und eilte, um nur bald in die Königsstadt zu gelangen. Unter verschiedenen Vorwänden wußte er sich beim König Zugang zu verschaffen, und durch die Eigenheit seines Tuches war es ihm ein leichtes, überall ungesehen aus und ein zu kommen, bis er auch das schwarze Tuch in den Händen hatte.
Furchtlos stellte er sich nun vor den König und gestand ihm frei, was er getan hatte. Der König, im höchsten Zorn über eine solche Kühnheit, wollte ihn also gleich festnehmen lassen; aber der Bursche antwortete ihm lachend: »Du kriegst mich ganz gewiß nicht!«
Und darauf war er verschwunden und kehrte wieder zum Vater und zur Mutter heim, die nun viele glückliche Tage mit ihren Söhnen verlebten und die reichsten Leute weit und breit im Land wurden.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus dem Zillertal
DER GANG ZUR APOTHEKE ...
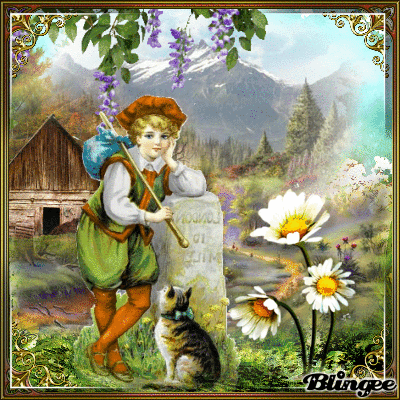
Es wurde einmal ein Knabe in die Apotheke geschickt, um ein Nichts im Wasserl zu holen. Er fürchtete den Namen der Arznei zu vergessen und sagte daher auf dem Wege immer vor sich hin: »Nichts im Wasserl - nichts im Wasserl.«
Einige Fischer, die am Weg saßen und seine Worte hörten, wurden darob überaus zornig, gaben ihm eine Anzahl Ohrfeigen und sagten, er müsse nicht sagen: »Nichts im Wasserl«, sondern: »Einen nach dem anderen.«
Der Bub merkt sich das, besonders wegen der Ohrfeigen, und sagte nun immerfort: »Einen nach dem anderen - einen nach dem anderen.« Bald kam er an einem Haufen Leute vorbei, die zusahen, wie einer gehängt wurde. Er ließ sich nicht Irre machen und wiederholte fleißig dabei: »Einen nach dem anderen.«
Die Leute, die das hörten, verwiesen ihm seinen Mutwillen und sagten: »Du mußt sagen: 'Gott tröste die arme Seel'!'« Der Bub ließ sich nicht zweimal warnen und sagte in einem fort: »Gott tröste die arme Seel' - Gott tröste die arme Seel'.« Mit diesen Worten ging er seines Weges, und es begegnete ihm bald ein Schinder mit einem krepierten Roß. Dieser ward zornig über den Buben wegen seiner gottlosen Rede und prügelte ihn tüchtig durch.
Dann gab er ihm Weis' und Lehre und sagte: »Du mußt sagen: 'Das Sauleder stinkt.'« Der Bub merkte sich die Worte, besonders wegen der Prügel, und sagte nun immerfort: »Das Sauleder stinkt - das Sauleder stinkt.« Da kam des Weges ein Herr mit einer schönen Frau am Arm, und als der die Worte des Buben hörte, wurde er krebsrot vor Zorn, wichste ihm mit seinem Stock ein paar Ordentliche auf und gab dann neue Weis' und Lehr, indem er sagte: »Du mußt sagen: 'Das ist ein schönes Ding.'«
Der Bub merkte sich die Worte, besonders wegen der Streiche, und sagte immerfort: »Das ist ein schönes Ding - das ist ein schönes Ding.« Sein Weg führte ihn an einem Schusterhaus vorbei, an dessen Fenster der Meister gerade Schuhe nagelte. Wie dieser den vorbeigehenden Buben ein um das andere Mal sagen hörte: »Das ist ein schönes Ding«, wurde er neugierig und schaute zum Fenster hinaus.
Während er die Augen anderswo als bei der Arbeit hatte, schlug er sich einen Nagel in den Finger. Deshalb wurde er über den armen Buben zornig, lief hinaus und haute ihn tüchtig durch. Der Bub getraute sich nun nimmer zu sagen: »Das ist ein schönes Ding«, und weil ihn der Schuster auch nichts anderes dafür gelehrt hatte, so hatte er gar nichts zu sagen, und er wußte nicht, was er in der Apotheke verlangen sollte.
Er kehrte also um und schleunte sich nach Hause zurück zu Vater und Mutter. Diese verlangten von ihm die Arznei, und weil er keine mitgebracht hatte, so ging die Musik aufs neue los, und der Bub bekam Schläge, daß sich ein Stein über ihn hätte erbarmen mögen.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Kramsach
WER BEKOMMT DAS HAUS? ...
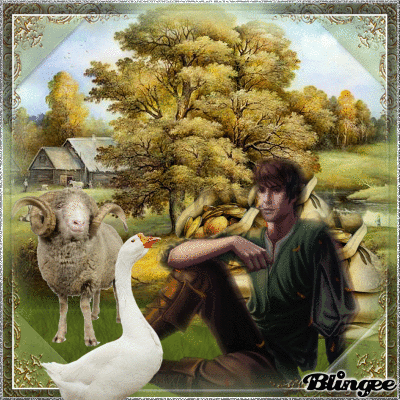
Es war einmal ein Bauer, der hatte drei Söhne mit Namen Michel, Jackel und Hansl. Hansl war anscheinend ein dummer Bursch; er war aber hie und da sehr pfiffig. Eines Tages sagte der alte Bauer zu seinen Söhnen: »Wer mir einen Widder bringt, der bekommt die Erbschaft. Aber er darf nicht gekauft, sondern er muß gestohlen sein.«
Die zwei Söhne antworteten: »Oh, wir werden dir schon einen bringen, aber der Hansl darf nicht mit, sonst könnte er uns den ganzen Fang verderben.« Der Hansl war sehr über den Schimpf erbittert und dachte: Wartet nur, wir wollen schon sehen.
Hansl paßte nun auf, wo die Brüder hingehen wollten, lief voraus und sagte zum Eigentümer: »Hörst du, heute kommen Diebe, die dir einen Widder stehlen wollen. Gib mir einen Widder und einen Hammer, so werde ich ihnen das Wiederkommen schon verleiden.«
Gesagt, getan. Hansl nahm den Hammer und ging damit in den Widderstall, setzte sich vor die Öffnung, wo man das Licht herein läßt, und wartete auf die Diebe. Um Mitternacht kamen sie wirklich. Der Michel sagte zum Jackel: »Geh du hinein, ich werde heraußen warten und dir den Widder abnehmen!«
Der Jackel kroch nun hinein; kaum hatte er aber den Kopf in das Loch gesteckt, als er einen Schlag empfing, daß ihm der Kopf brummte. »O weh«, schrie er, »Michel, Michel, zieh mich zurück, sonst stoßen mir die Widder den Kopf ein!«
Michel gab ihm einen Puff und flüsterte: »Bist ruhig, oder ich haue dich windelweich. Du bist ein nichtsnutziger Tropf! Laß mich hinein.« Jedoch auch dem Michel ging es nicht besser, und so mußten sie unverrichteter Sache wieder fort trollen. Hansl aber kehrte mit einem Widder zurück und hatte somit das Haus geerbt.
Aber seine Brüder ließen dem Vater keine Ruhe, bis er ihnen wieder eine Probe auferlegte, nämlich die schönste Gans gestohlen nach Hause zu bringen. Die Brüder sagten wieder: »Den Hansl lassen wir nicht mit.«
Jedoch Hansl wußte den Ort, wo sie die Gans stehlen wollten, lief voraus und sagte zum Eigentümer der Gänse: »Du, heute kommen Gänsediebe. Gib mir eine große Zange und eine Gans, so werde ich dir
die Diebe vom Hals schaffen.«
Der Bauer gab dem Hansl das Verlangte, worauf er sich in den Stall begab.
Am Abend kamen richtig die Brüder. Diesmal mußte zuerst der Michel hinein, denn Jackel sagte: »Ich habe das vorige Mal zuerst hinein müssen!« Der Michel kroch also hinein; doch kaum war er mit dem Kopf darin, als schon der Hansl seine Nase mit der Zange dermaßen kneipte, daß Michel laut um Hilfe schrie.
Diesmal kroch aber der Jackel nicht mehr hinein, sondern machte sich Hals über Kopf davon. Also kamen Michel und Jackel mit leeren Händen, Hansl aber mit seiner feisten Gans heim.
Aber die Brüder ließen nicht ab, den Vater zu bitten, bis er ihnen noch eine dritte Probe auferlegte, die war: Wer am meisten Geld nach Hause bringt, würde Erbe werden.
Diesmal nahmen die Brüder den Hansl mit. Alle drei nahmen etwas mit sich. Michel nahm einen Kübel voll Wasser mit, Jackel einen Sack voller kleiner Steine, und Hansl schleppte eine schwere Eisentür. So kamen sie in den Wald, als es schon dunkel war.
Sie fürchteten sich vor wilden Tieren und stiegen auf eine hohe Eiche. Hansl war zuunterst. Um Mitternacht kamen auf einmal drei Hexen auf ihren Besen durch die Luft daher gefahren, mit großen Geldsäcken unter den Armen, und setzten sich unter die Eiche, um das Geld zu zählen.
Michel, vor Angst ganz außer sich, ließ den Kübel gerade auf die Hexen niederfallen, welche glaubten, die Meisterin lasse heute regnen. Jackel glaubte nun, sie seien verraten, und warf ganze Handvoll Steine auf die Hexen; diese sagten: »Heute wirft's große Schloßen.«
Plötzlich ließ Hansl die schwere Eisentür auf die Hexen fallen, die alle drei erschlug. Weil nun Hansl am niedrigsten saß, so war er mit einem Sprung auf der Erde, nahm alles Geld und lief heim zum Vater. Dieser übergab ihm das ganze Gut, und Hansl war glücklich und reich.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus dem Hinterpustertal
DIE ZWEI KÜNSTLER ...
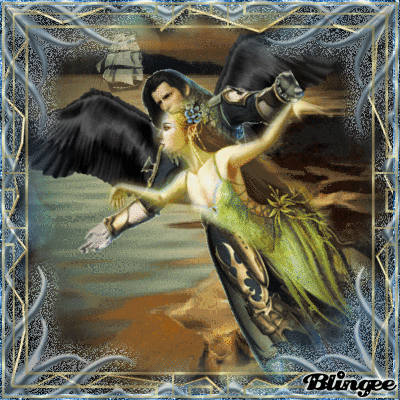
Ein Goldschmied und ein Wahrsager kamen an einem Sonntag in einem Wirtshaus zusammen. Sie fingen an, mit ihren Künsten zu prahlen, und da keiner dem andern nachgeben wollte, so beschlossen sie, es etwas gelten zu lassen. Sie wetteten also dreihundert Gulden, die derjenige bekommen sollte, der in einer Woche das größere Kunststück zuwege bringen würde.
Der Goldschmied ging schon am Montag zu seiner Arbeit und saß den ganzen Tag in der Werkstätte. Wenn jemand sagte, er solle doch bald Feirum lassen, so dachte er bei sich: Du hast leicht sagen, du weißt nicht, was es gilt. Der Wahrsager aber tat, als ob ihm gar nichts daran läge, kam alle Abend fleißig ins Wirtshaus und soff sich einen tüchtigen Dusel an.
Da der Goldschmied sah, wie sein Wettgeselle alle fünf gerade sein ließ, zweifelte er gar nimmer, daß er gewinnen würde. Wie aber die Woche zu Ende ging und schon der Freitag da war, fing auch der Wahrsager an zu arbeiten, um bis zum Sonntag mit seinem Kunststück fertig zu werden.
Am Sonntag kamen die beiden Künstler ins Wirtshaus, und es sagte einer zum anderen: »Nun, laß schauen, was du hast!« Da ließ der Goldschmied ein Becken mit Wasser bringen, packte dann etliche Goldfische aus und warf sie ins Wasser. Da fingen sie an herum zu schwimmen und aufzuhüpfen wie lebendige Fische, und er meinte, so ein Stück habe der Wahrsager doch nicht zustande gebracht.
Der Wahrsager lachte ihn aber aus, zog zwei Flügel aus seiner Tasche und schwang sich die selben über die Achseln. Dann hob er sich vom Boden, flatterte zum Fenster hinaus und flog dreimal um das Haus herum. So oft er wieder einmal herum geflogen war, schaute er beim Fenster herein, zum Zeichen, daß er wieder einen Flug ums Haus gemacht habe.
Der Goldschmied wollte kaum seinen Augen trauen, allein endlich mußte er doch glauben, was er sah, und als der Wahrsager nach der dritten Runde zum Fenster herein schoß, hieß es den Beutel auftun und die dreihundert Gulden bezahlen.
Der Wahrsager hatte einen Sohn, dem das Fliegen seines Vaters gar so gut gefiel, so daß es ihm keine Ruhe ließ, bis er nicht auch die Flügel probierte. Er schwang sich die Flügel auf die Achseln und flog auf. Wie er aber einmal in der Höhe war, da ging es mit ihm fort wie der Wind, und er mochte anstellen, was er wollte, er konnte nicht wieder herab kommen. Es schwindelte ihn ganz, wenn er auf die Erde hinabschaute und ein Dorf nach dem anderen, eine Stadt nach der anderen unter ihm vorbei lief.
Er war schon lange Zeit so fort geflogen, da gelang es ihm endlich, in einem fernen, fernen Land auf den Boden zu kommen. Als er sich umschaute, sah er einige Schweinehirten neben sich, die ihn anschauten wie die Narren, weil sie nicht wußten, wie er da heran geflogen kam.
Er besann sich nicht lange, was er zu den Hirten sagen sollte, denn auf der langen Reise hatte er einen Hunger bekommen, daß ihm der Magen völlig hinab fiel. Er bat also zuallererst um ein Stück Brot. Den Hirten kam das sonderbar vor, daß der rüstige, schön gekleidete junge Herr, der aus der Luft geflogen kam, um ein Stück Brot bat.
Weil er aber gar so inständig bat und man ihm die Mattigkeit an allen Gliedern ansehen konnte, so faßten sie Mitleid mit ihm, reichten ihm nicht nur Brot zur Stillung des Hungers, sondern gaben ihm auch Arbeit, so daß er bei ihnen bleiben und unter ihnen sich sein Brot verdienen konnte. Darüber war der Sohn des Wahrsagers froh und blieb bei den Hirten.
Nicht weit von dem Platz, wo diese ihre Schweine hüteten, wohnte der König des Landes. Der hatte eine wunderschöne Tochter, die er aber immer eingesperrt hielt, so daß niemand zu ihr kommen konnte. Er hatte sogar den Fußboden des Zimmers mit Asche bestreuen lassen, damit es schnell auf käme, wenn einer es wagte, seine Tochter zu besuchen.
Auch der Sohn des Wahrsagers hörte von der schönen Königstochter und ihrem strengen Vater erzählen. Wart nur, dachte er sich, ich komm schon hinein, wenn auch alles verriegelt und versperrt ist. Er nahm seine Flügel, schwang sich auf und flog zu dem Fenster der Königstochter.
Mit kräftiger Baßstimme rief er zu ihr hinein: »Ich bin der Engel Gabriel und bin vom Himmel gekommen, um dich aus deiner Gefangenschaft zu retten.« Dann flog er wieder weg und kam ein zweites und drittes Mal wieder und sagte die nämlichen Worte.
Einmal flog er gar durch das Fenster hinein und trat mit einem Fuß in die aufgestreute Asche, so daß sein Fuß darin sichtbar blieb. Als nun der »Engel Gabriel« wieder weg war und der König zu seiner Tochter in das Zimmer trat und den Fußabdruck in der Asche bemerkte, da wurde er krebsrot vor Zorn und gab so gleich Befehl, daß alle seine Untertanen vor ihm erscheinen müßten.
Als nun die Leute von allen Ecken und Enden seines Reiches zusammen kamen, da mußten alle versuchen, ob ihr Fuß in den in die Asche gedrückten Fußabdruck passe. Allein keiner wollte passen, und der König meinte schon, daß alle seine Mühe vergeblich sei.
Eines Tages kamen drei Schweinehirten am königlichen Palast vorbei gegangen, und da der König merkte, daß diese seinem Gebot noch nicht nachgekommen waren, rief er sie zu sich herauf. Sie mußten nun auch ihren Fuß mit dem Abdruck in der Asche vergleichen lassen.
Und richtig, als sie alle nacheinander ihren Fuß hin hielten, schrie der König auf einmal mit wütender Miene: »Halt! Du bist es, der sich erfrecht hat, zu meiner Tochter zu kommen. Du sollst mir aber bitter dafür büßen.« Der, den er so anfuhr, war aber kein anderer als der Schweinehirt mit den Flügeln.
Der König befahl nun, seine Tochter und den Schweinehirten in abgesonderte Gemächer einzusperren, er werde dann beide der verdienten Strafe überantworten. Wie der Schweinehirt das hörte, erhob er seine Stimme und sprach: »O König! Möchtest du mir nur noch eine Bitte gewähren, so wollte ich gerne meine Strafe aushalten.«
»Was willst du noch?« fragte barsch der König. »Ich bitte dich, daß du mir erlaubst, deiner Tochter nur einen einzigen Kuß zu geben, bevor ich auf immer von ihr scheide.« Das wurde ihm gerne gewährt.
Als nun die Prinzessin herbei kam, eilte der Schweinehirt auf sie zu, schlang seine Arme um sie und gab ihr einen herzhaften Kuß. Dann ließ er sie aber nicht los, sondern fing an, seine Flügel zu schlagen, flog zum Fenster hinaus und trug die Königstochter mit sich durch die Luft. Jetzt hatte der König eine lange Nase und mochte Gift und Galle speien - alles half ihm nichts.
Der Schweinehirt flog mit der schönen Jungfrau seinem Vaterland zu, und nach einer langen, langen Luftfahrt kam er endlich dort an und kehrte mit der Prinzessin im nächsten Wirtshaus ein. Hier fand er mehrere Gäste, die sich eben erzählten, daß vor einigen Jahren der Sohn des Wahrsagers mit den wunderlichen Flügeln fort geflogen sei.
Er hörte eine Weile ihrem Gespräch zu. Endlich aber stand er von seinem Sitz auf, trat vor die übrigen Gäste und sagte: »Der Sohn des Wahrsagers, von dem ihr da redet, steht vor euch, und die schöne Jungfrau da drüben ist eine Königstochter, die ich als meine Braut mit mir Heim gebracht habe.«
Die Gäste schauten ihn groß an, und als sie ihn als denjenigen erkannten, der vor mehreren Jahren davon geflogen war, da staunten sie nicht wenig über seine plötzliche Wiederkunft.
Der Sohn des Wahrsagers aber hielt Hochzeit mit der schönen Königstochter und lebte mit ihr glücklich bis an sein Ende.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DIE RÄTSELHAFTE ANTWORTEN ...
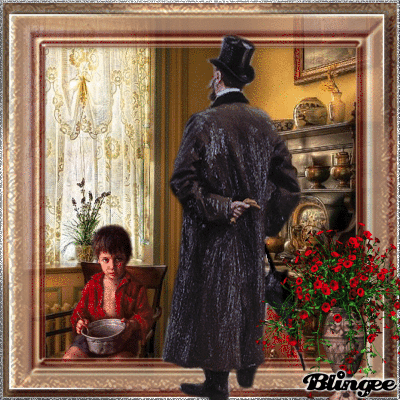
Es kam einmal ein Herr in ein Bauernhaus und fand da einen Knaben. Weil er ihn gerade allein sah, dachte er sich, es sei sonst niemand im ganzen Haus, und fragte, wo denn der Vater wäre. Der Knabe schaute ihn gescheit an und sagte: »Der Vater ist auf das Feld hinaus gegangen, um aus einem Schaden zwei zu machen.«
Der Herr verstand diese Worte des Knaben nicht und bat ihn, er möchte ihm doch erklären, was diese Antwort sagen wolle. »Ja, die Leute sind immer über das Getreidefeld gegangen«, antwortete der Knabe, »und haben sich einen ganzen Weg hindurch gemacht. Jetzt ist der Vater hinausgegangen, diesen Weg mit einem Zaun zu vermachen. Meinst du nicht auch, jetzt werden die Leute neben dem alten Weg vorbei gehen und sich einen neuen bahnen? Und so sind denn wohl zwei Schäden aus einem gemacht.«
Der Herr staunte über die Pfiffigkeit des Knaben und sagte: »Schau, schau, das hätt' ich von dir nicht gedacht, daß du so gescheit bist. Aber jetzt sag mir, wo du die Mutter hast?« »Die Mutter ist beim Backofen draußen und bäckt das Brot, das wir die vorige Woche gegessen haben.«
»Wie ist aber das möglich, daß sie heute das Brot bäckt, das ihr schon gegessen habt?« »Ist halt doch, wie ich gesagt habe. Die Mutter hat ja das Brot geliehen, das wir in der vorigen Woche gegessen haben. Und jetzt bäckt sie eines, um es zurückzugeben.« Der Herr staunte noch mehr als das erste Mal und fragte wieder: »Und wo hast du denn die Schwester?«
»Die Schwester, die ist in der Kammer oben und beweint, daß sie das vorige Jahr gelacht hat.« Der Herr verstand wieder nicht, was hiermit gemeint sei, und verlangte eine Aufklärung. Der Knabe erklärte ihm die Sache so: »Die Schwester hat das vorige Jahr in Saus und Braus, in Lust und Leichtsinn dahingelebt, und jetzt weint sie immerfort über ihr schlechtes Leben.«
Der Herr bedankte sich für die Erklärung, sagte »Behüt' dich Gott!« und ging nachdenklich von hinnen. Wohin er gegangen ist, das weiß der liebe Himmel.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Rattenberg
WARM UND KALT AUS EINEM MUND ...
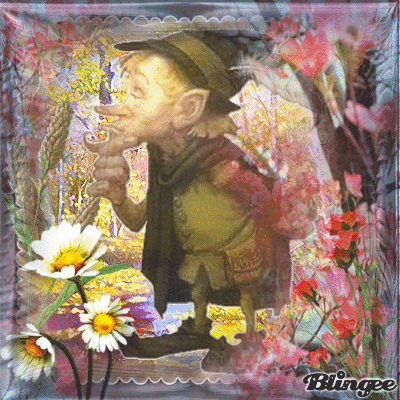
Es war einmal ein Mann, der schlug tief im Wald Holz. Zu diesem kam ein Waldmännlein, das gar freundlich zu ihm sprach. Es war aber sehr kalt, denn es war mitten im Winter, und den Mann, der Holz hackte, fror es sehr an seinen Händen. Oft legte er die Axt bei Seite und hauchte in die hohlen Hände, um sie dadurch zu erwärmen.
Das Waldmännlein sah dies und fragte ihn, was das zu bedeuten habe. Der Holzschläger erklärte ihm, daß er durch den Hauch seines Mundes seine erfrorenen Hände erwärmen wolle; das Männlein glaubte es und war mit der Antwort zufrieden.
Da kam endlich Mittagszeit, und der Holzfäller schickte sich an, am Feuer sein Mittagsmahl zu bereiten, und kochte sich den fetten Schmarren. Noch immer war das Waldmännlein bei ihm und sah ihm neugierig zu. Der Holzfäller aber hatte großen Hunger und wollte nicht warten, bis die Speise abgekühlt war, sondern er aß davon vom Feuer her. Da sie aber noch recht heiß war, blies er mit seinem Mund auf jeden Löffel voll.
Das Waldmännlein nahm dies wunder und sagte: »Ist der Schmarren vom Feuer her nicht warm genug, daß du noch daran bläst wie an deine erfrorenen Hände?«
Der Holzschläger aber erklärte ihm, daß er dies tue, um den heißen Bissen abzukühlen. Das konnte das Waldmännlein aber nicht mehr fassen.
Es sprach zum Holzschläger: »Du bist ein ganz unheimliches Wesen; aus deinem Mund kommt bald warm, bald kalt, bei dir mag ich nicht länger verweilen.« Und augenblicklich ging das Waldmännlein davon.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Unterinntal
DAS BÄUERLEIN ...
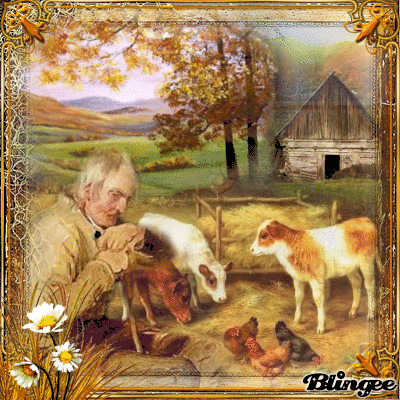
Es war einmal ein Bäuerlein, das nichts hatte als ein Weib und eine Kuh und sich sein Brot damit verdienen mußte, daß es das Vieh des ganzen Dorfes hütete. Das Bäuerlein war aber bei den übrigen Bauern nicht gut eingetragen, weil im ganzen Dorf keine Kuh fett werden wollte als die Kuh des Bäuerleins und weil an jedem Abend nur seine Kuh satt und vollgestopft nach Hause kam, die übrigen aber leer und hungrig in ihre Ställe zurückkehrten.
Sie gaben die ganze Schuld dem Hirten und forderten ihn auf, zu bekennen, warum beim Heimkehren immer nur seine Kuh vollgestopft sei, die anderen aber leer und hungrig. Der Hirte antwortete mit großem Ernst: »Was kann ich dafür, wenn ihr so schlechtes Vieh haltet, das auf der besten Weide zu faul ist, zu fressen.« Die Bauern mußten sich mit diesem Bescheid zufrieden geben, sannen aber auf andere Mittel, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Einmal gingen sie hinaus, um selbst zu sehen, ob die Schuld an den Kühen oder am Hirten liege. Sie versteckten sich im Gebüsch und warteten, bis die Herde heranzog. Da sahen sie dann, wie das Bäuerlein seine Kuh immer auf den frischen Weideplatz führte, die anderen Kühe aber nur dort grasen ließ, wo zuvor schon alles abgefressen war. Da entbrannten sie in großem Zorn, gingen nach Hause, und weil sie dem Hirten sonst nichts nehmen konnten, beschlossen sie, sein Weib zu erschlagen.
Als der Hirte abends nach Hause kam, fand er seine Alte schon tot. Er jammerte darüber, daß sich ein Stein hätte erbarmen mögen, und je länger er jammerte, desto mehr freute es die Bauern. Aber auch er dachte sich an den Bauern zu rächen und kam auf einen pfiffigen Einfall.
Er nahm sein totes Weiblein, trug es vor das Dorf auf die Straße und setzte es dort auf einen Stuhl. Dann stellte er ein Spinnrad davor und richtete alles so, daß jedermann glauben mußte, das Weiblein sei lebendig und spinne da mitten auf der Straße. Er selbst versteckte sich hinter den Stauden und wartete ab, was sich da zutragen würde.
Als bald kam ein Fuhrmann des Weges, und als er das Weiblein sah, knallte er mit der Peitsche und rief: »Heda, Platz gemacht!« Das Weiblein rührte sich nicht. Der Fuhrmann schrie wieder: »Platz gemacht oder nieder gefahren!« Das Weiblein blieb fest wie eine Mauer. Da schnellte der Fuhrmann, daß einem die Ohren gellten, und fuhr mit seinem Wagen vorwärts.
Als er an das Weiblein kam, schrie er noch einmal: »Platz gemacht, du alte Hexe!« Die Alte rührte sich nicht, und der Wagen fuhr über sie hinweg.
Das Bäuerlein hatte dem ganzen Spektakel zugeschaut und stürzte jetzt mit dem größten Lärm aus seinem Versteck hervor: »Du Lumpenkerl, du Spitzbub, wer hat dich geheißen, mein Weib
niederzufahren? Warte nur, dich werde ich schon vor Gericht finden.« So fabelte er fort, als ob es sein größter Ernst wäre.
Der Fuhrmann wurde auch zornig und sagte: »Mehr als zehnmal sagen kann man es nicht. Ich habe ihr schon gesagt, sie soll Platz machen. Warum ist sie nicht gegangen? - Jetzt hüo.« Das Bäuerlein ließ ihn aber nicht weiterfahren und sagte: »Du mußt mir vor Gericht. Platz gemacht hat meine Alte freilich nicht, wenn du auch geschrien hast und nahe herangefahren bist, sie hat ja nichts gesehen und nichts gehört.«
Jetzt fürchtete sich der Fuhrmann freilich vor dem Gericht, fing an zu bitten und sagte: »Ich will dir gern Roß und Wagen geben, wenn du mich nur bei Gericht nicht anzeigst.« Das Bäuerlein war damit zufrieden, hieß den Fuhrmann absteigen und stieg dafür selbst auf den Wagen. Dann fuhr es in das Dorf hinein und schrie hü und hott und knallte mit der Peitsche, daß alles zusammenlief.
Da schauten die Bauern groß drein, als sie das Bäuerlein daher fahren sahen, und sie fragten, woher es denn Roß und Wagen habe. Das Bäuerlein antwortete ihnen, es habe die Haut seines Weibleins verhandelt und für den Erlös Roß und Wagen gekauft.
Der Handel schien den Bauern profitabel, sie traten zusammen und beschlossen insgesamt, die Weiber zu erschlagen. Sie fielen also über sie her, machten ihnen den Garaus und zogen ihnen die Häute ab. Dann gingen sie mit den Häuten auf die Handelschaft und hofften bald, mit Roß und Wagen heimzukehren. Aber die Häute ließen sich nicht gut verkaufen, so daß sie alle mit langer Nase heimkehren mußten.
Darob wurden sie aufs neue erbittert über das Bäuerlein und beschlossen, es in einen Sack zu stecken und in den See zu werfen. Richtig wurde das Bäuerlein ergriffen, in einen finsteren Sack gesteckt und zum See hinaus geführt. Am Weg stand eine Kapelle, darin eben Messe gelesen wurde. Die Bauern wollten die gute Gelegenheit nicht versäumen und gingen in die Messe.
Den Sack mit dem Bäuerlein ließen sie indes vor der Kapelle liegen, um ihn nach der Messe in den See zu werfen. Das Bäuerlein merkte seinen Vorteil und rief in einem fort aus dem Sack: »Ich mag sie nicht, ich will sie nicht; ich mag sie nicht, ich will sie nicht.«
Da kam ein Wanderer des Weges, der hörte lange den sonderbaren Worten zu, trat endlich zum Sack und sagte: »Was magst du nicht, was willst du nicht?«
Da antwortete die Stimme im Sack: »Jawohl? Eine Königstochter soll ich heiraten, die mag ich nicht und die will ich nicht. Möchtest nicht du sie?«
»Eine Prinzessin kriegt man nicht alle Tage«, antwortete der Wandersmann, »warum soll ich die nicht heiraten.« »Ja so knüpfe nur den Sack auf und schlüpfe statt meiner herein, dann wirst du sie schon bekommen.« Der andere knüpfte den Sack auf, ließ das Bäuerlein heraus und schlüpfte an seiner Statt hinein. Das Bäuerlein machte sich aus dem Staub und lachte sich den Buckel voll.
Als die Messe zu Ende war, kamen die Bauern heraus, fuhren mit dem Sack zum See und warfen ihn hinein. Dann kehrten sie wieder heim und waren seelenfroh, weil sie glaubten, das Bäuerlein habe jetzt sein Teil bekommen. Sie spazierten aber nicht lange im Dorf herum, da kam schon wieder das Bäuerlein des Weges und trieb eine Schar Schweine vor sich her, die es irgendwo gestohlen hatte.
Die Bauern wußten nicht recht, wie ihnen war, schauten einander groß an und kratzten sich hinter den Ohren. Ein paar gingen hinzu und fragten das Bäuerlein: »Wie kommst denn du wieder zu Leben, und woher hast du denn die Kutt Facken?«
Das Bäuerlein antwortete: »Die Facken habe ich aus dem See geholt. Dort sind sie genug. Ist nur schade, daß ich es früher nicht gewußt habe. Wenn ihr gescheit seid, geht nur auch hin und holt euch einen Haufen!« Diese Rede des Bäuerleins verbreitete sich Wind schnell im ganzen Dorf.
Die Bauern hielten Rat und beschlossen in den See zu springen, um sich die Schweine herauszuholen. Sie gingen nun zum See hinaus, und als sie dort ankamen, kehrte sich einer von ihnen um und sagte: »Jetzt wartet ein wenig. Ich will voraus springen, und wenn ich die Facken sehe, so rufe ich: 'Kummt!' Wenn ihr mich also hört, dann springt ihr alle nach, und wir werden die Facken herauf bringen.«
Dieser Vorschlag war allen recht. Der Bauer ging nun ans Wasser und sprang von der Ferne hinein. Plumpf, tat es. »Habt ihr gehört?« sagten die Bauern zu einander. »Er hat gerufen: 'Kummt!'« Auf das hin sprangen alle Bauern ins Wasser und mußten jämmerlich ersaufen.
Nun waren zu den Bäuerinnen die Bauern auch tot, und das Bäuerlein war mutterseelenallein im ganzen Dorf. Es wußte sich den Reichtum der Bauern tüchtig zu Nutzen zu machen und war so lustig und wohl auf, daß es mit keinem Fürsten getauscht hätte.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus dem Burggrafenamt
LÖWE, STORCH UND AMEISE ...
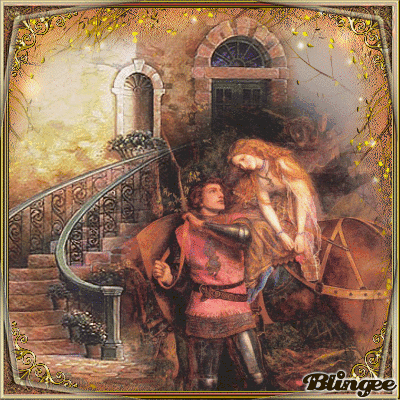
Es war einmal eine arme, arme Witwe, die aus einem sehr vornehmen Geschlecht stammte und einen einzigen Sohn hatte. Sie wohnte mit ihm in stiller Einsamkeit in einem Wald und erzog ihn zu aller Zucht und Tugend.
Der Knabe, der Johannes hieß, nahm lernbegierig die guten Lehren seiner Mutter auf und machte ihr Freude und erweckte ihr die schönsten Hoffnungen. Nur eines wollte ihr nicht gefallen, und das war seine Reiselust. Bei Tag und Nacht dachte er nur an die Schönheit und Pracht ferner Städte und Schlösser, von denen er erzählen gehört hatte.
Die kluge Mutter war mit diesem Wandertrieb desto weniger einverstanden, da sie wußte, daß ihrem Sohn doch immer das Geld zum Reisen fehlen würde. Ihr Abmahnen davon half jedoch nichts. Dem Sohne wurde es im Wald immer mehr und mehr zu eng, und es trieb und drängte ihn seine Sehnsucht nach der Fremde so, daß er sich eines Tages aufmachte und seiner weinenden Mutter und der Waldhütte Lebewohl sagte.
Wie er so frank und frei, voll schöner Hoffnungen durch den dunklen, dichten Wald ging, hörte er plötzlich ein fürchterliches Geheul. Da dachte er sich: Ich muß doch sehen, was es da gibt, vielleicht kann ich helfen, und eilte mutig der Gegend zu, aus der der Lärm herkam.
Als er so ein Stück gelaufen und zur Stelle gekommen war, sah er einen Löwen, einen Storch und eine Ameise, die sich um den Körper eines toten Pferdes stritten und dadurch diesen Lärm vollführten. Kaum waren sie aber des Fremden ansichtig geworden, als sie vom Streit ließen und ihn baten, er möchte ihren Rechtshandel schlichten.
Da besann sich Hans nicht lange und machte den Schiedsrichter. Dem Löwen teilte er das Fleisch zu, dem langschnabeligen Storch überließ er die Gebeine zum Abnagen, und der Ameise gab er den hohlen Kopf, damit sie darin nisten könne. Die Tiere waren über diese Teilung seelenvergnügt und dankten dem Jüngling aufs beste.
Der Löwe sprach: »Guter Freund, ich will dich belohnen und nicht ohne Dank von dir scheiden. Wenn du sagst: 'Hans, der Löwe', so sollst du siebenmal stärker sein als der stärkste Löwe.«
Darauf sprach der Storch: »Guter Freund, ich will dich belohnen und nicht ohne Dank von dir scheiden. Wenn du sagst: 'Hans, der Storch', so wirst du siebenmal höher fliegen können als meinesgleichen.«
Dann nahte die kleine Ameise und wisperte: »Guter Freund, ich will dich belohnen und nicht ohne Dank von dir scheiden. Wenn du sagst: 'Hans, die Ameise', so wirst du siebenmal kleiner werden als die kleinste Ameise.«
Hans ging nun von den Tieren weg und wanderte weiter durch den Wald. Da wurde das Gehölz endlich lichter, und als er aus dem Forst hinaustrat, lag eine große, große Stadt vor ihm. Hans konnte sich nicht satt daran schauen und wanderte schnurstracks auf sie los.
Als er aber in die Stadt kam, war er durch ihr düsteres Aussehen nicht wenig überrascht. Denn alle Häuser waren mit schwarzen Decken behangen, und alle Einwohner trugen sich schwarz. Da wunderte sich Hans, was das zu bedeuten habe, und er fragte einen Bürger, der ihm begegnete, um die Ursache der Trauer.
Darauf antwortete ihm der Mann mit trauriger Miene: »Ach, weh uns! Unsere geliebte Königstochter ist in ein fernes Schloß verwunschen worden, und ihre Rettung ist beinahe unmöglich, denn ein fürchterlicher Drache mit drei Köpfen bewacht die verwünschte Jungfrau.« Mit diesen Worten ging der Mann traurig von dannen.
Hans blieb allein stehen und hatte mit der armen Prinzessin das tiefste Mitleid. Er wünschte sie zu erlösen, möge es kosten, was es wolle. Er erkundigte sich daher um die Lage des Schlosses und machte sich dann fröhlich auf den Weg dahin.
Er mußte einige Tage wandern, bis er zum Schloßberg kam. Da bemerkte er aber zu seinem Schrecken, daß man nicht zum Schloß hinauf kommen könne, denn der Berg war steil und so glänzend und schlüpfrig, als wäre er mit Öl übergossen. Hans dachte nun nach, wie er hinauf kommen könnte, doch all sein Sinnen und Trachten war vergebens.
Da fiel ihm plötzlich die Geschichte mit den Tieren ein, und er sprach vor sich hin: »Hans, der Storch.« Kaum hatte er es gesagt, da war er auf einmal in einen Storch verwandelt und flog auf den Berg hinauf. Er stand nun vor dem Schloß, doch die Pforte war Eisen fest verschlossen, und niemand öffnete sie.
Da sprach der Jüngling: »Hans, die Ameise!«, und in einem Nu war er die kleinste Ameise und schlüpfte durch ein Astloch der Tür in den Hofraum. Dort bekam er wieder seine vorige Gestalt und besichtigte das große, feste Gebäude. Wie er so dastand und sann, wo etwa die Prinzessin gefangen sei, erschien ein altes Männchen, das sehr klein war, aber einen ungeheueren Bart hatte.
Dieses fragte den Jüngling mit grunzender Stimme: »Bürschchen, was willst du hier?« »Die verwunschene Prinzessin erlösen«, erwiderte Hans. Darauf entgegnete der Alte: »Das wird schwer gehen, denn sie wird von einem fürchterlichen Drachen bewacht, der auf ihrem Schoß liegt.«
Hans verlor durch diese Rede gar nicht den Mut und meinte, es würde schon gehen. Dann fragte er das Männchen: »Wo ist ein Schwert?« Das Zwerglein gab darauf den Bescheid: »Geh hinauf in die Rüstkammer, und dort wirst du ein Schwert finden, das du kaum tragen kannst. Das nimm!«
Hans stieg also gleich in die Rüstkammer hinauf und holte das großmächtige Schwert, das er fast nicht tragen konnte. Dann ging er auf das Zimmer zu, in dem der Drache die Jungfrau bewachte, und sprach: »Hans, der Löwe.« Da wurde er siebenmal stärker als der stärkste Löwe, trat in das Zimmer und schlug dem Drachen alle drei Köpfe mit einem Hieb herunter.
Kaum war dies geschehen, so begann es im ganzen Schloß zu poltern und zu donnern, und der Berg senkte sich mehr und mehr, bis er ganz verschwand.
Dann machten sich Hans und die erlöste Königstochter auf den Weg und gingen in die Residenzstadt.
Dort entstand ein unermeßlicher Jubel über die Befreiung der schönen Jungfrau, und es folgte deshalb ein Fest auf das andere. Die Königstochter heiratete dann aus Dankbarkeit ihren Erlöser und lebte mit ihm vergnügt und glücklich bis zu ihrem seligen Ende.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Brixen
DAS BERGGEISTL ...
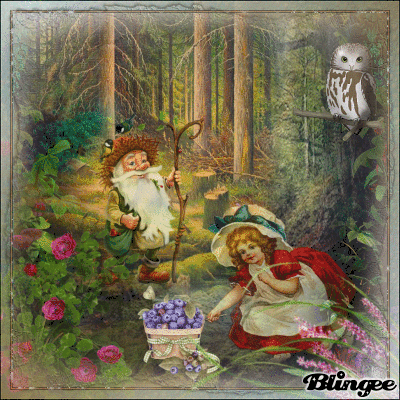
Es war einmal ein blutarmes Weib, das lag sterbenskrank und hatte weder einen Bissen Brot noch einen roten Pfennig zu Hause. Da sprach es zu seinem einzigen Kind, das ein gar braves, frommes Mädchen war: »Geh in den Wald, Moidele, und suche Beeren! Die kannst du dann in die Stadt tragen und dort verkaufen.«
Das Mädchen nahm sein Weidenkörbchen, ging in den Wald hinein und kam immer weiter und weiter im dunklen Forst, bis es endlich Schwarzbeeren in Unzahl fand. Es sammelte nun die selben ins Körbchen, gab auf nichts anderes acht und wurde des Pflückens gar nicht müde. Dabei dachte es sich: Wenn ich das Körbchen gehäuft voll habe, kann ich zwei Sechser bekommen und der Mutter auch etwas Besseres als nur Brot kaufen.
Indessen war der Tag sehr vorgerückt, und der Abend dämmerte schon hinter den Bergen herauf. Da stand auch das Mädchen auf, sah seelenvergnügt aufs volle Körbchen und wollte heimgehen. Es machte sich nun auf den Weg, doch bald war der Steig verschwunden, und es wußte nicht wohin und wo aus. Es lief nun über Stock und Stein, durch dick und dünn, doch je weiter es ging, desto dichter wurden die Bäume und desto mehr begann es zu dunkeln.
Da wurde es dem Kind gar unheimlich zumute, es stand still und weinte bitterlich. Dann faßte es sich wieder und ging vorwärts, doch an ein Herausfinden aus dem Wald war nicht zu denken. Wie das Moidele schon jede Hoffnung aufgab, nach Hause zu kommen, trappelte es plötzlich durch die Bäume daher, und ehe sie es meinte, stand ein kleines, kleines Männchen, das in grauen Baumbart gekleidet war, vor ihm.
Es war das Berggeistl. Als es sah, daß das Mädchen weine, redete es das Mädchen gar freundlich an und fragte: »Was fehlt denn dir, daß du weinst?« »Ach«, sagte schluchzend das Moidele, »ich habe Schwarzbeeren gesucht, um dafür Brot und Fleisch für die kranke Mutter zu kaufen, und jetzt find' ich nicht mehr aus dem Wald, muß hier übernachten, und die kranke Mutter ist ganz allein.«
»Wenn nur das fehlt«, erwiderte das Männchen, »so ist dir leicht zu helfen. Warte, ich werde dich gleich aus dem Wald führen, folge mir nur!« Mit diesen Worten ging das Berggeistl voraus, und wo es hin trat, war guter Weg. Das Mädchen folgte, obwohl es hundemüde war, und bald wurde der Wald lichter und lichter, bis sie im Freien standen.
Dem Moidele klopfte nun das Herz vor Freude, und es dankte dem kleinen Männchen gar herzlich. »Deine Mutter ist krank«, sprach da das Berggeistl. »Weil du so brav bist, soll ihr geholfen werden.« Dann bückte es sich und pflückte einige Kräuter, die es dem Kind gab. »Siede sie heute noch und gib das Wasser davon deiner Mutter zu trinken, und sie wird alsogleich gesund werden.« Das Berggeistl lächelte, und im Nu war es verschwunden.
Moidele lief nun voll Freude heim und erzählte der Mutter, was ihm im Wald begegnet war. Dann ging es in die rußige Küche, machte Feuer an und sott die Kräuter. Als dies geschehen war, seihte sie das Wasser davon ab und brachte es der Mutter. Diese trank es, und kaum hatte sie den letzten Tropfen davon zu sich genommen, als sie sich ganz gesund fühlte und aufstand.
Dies alles hatte der Bub des Nachbarn, der öfter in die Hütte kam, gesehen und gehört, und er dachte sich: Warte, jetzt will ich auch in den Wald hinausgehen und mir solche Wunderkräuter geben lassen. Die will ich dann in der Stadt um teures Geld verkaufen und mir dafür Zuckerfeigen und anderes anschaffen.
Gedacht, getan. Am anderen Tag ging der böse Bub in den Wald, aß dort Heidelbeeren und als er deren satt war, drang er tiefer in den Wald und fing endlich zu flennen und zu heulen an, daß die Bäume widerhallten. Er hatte schon lang gelärmt, als das Berggeistl daher gegangen kam und fragte: »Was machst du hier in meinem stillen Wald für einen Lärm?«
»Weil ich nimmer heimfinde und meine kranke Mutter ganz allein ist.« Dabei weinte der Knabe, hob beide Hände auf und bat kniefällig, ihn doch aus dem Wald zu führen. »Wenn dir nichts anderes fehlt, so soll dir geholfen werden«, sprach das Berggeistl und ging voran. Der Knabe folgte ihm.
Da führte das Berggeistl den falschen Buben vier Stunden lang durch den dichtesten Wald, bergab, bergauf, so daß er todmüde wurde und seine Falschheit bitter bereute. Als der Knabe vor Müdigkeit beinahe nicht mehr weiter kam, standen sie endlich am Saum des Waldes. Da war der Knabe froh und wollte schon davon laufen, als das Männlein sprach: »Warte, ich muß dir auch ein heilsames Kräutlein mitgeben.«
Bei diesen Worten bückte sich das Berggeistl und rupfte einige Blätter ab, die es dem Buben gab. Dann sprach es: »Siede sie dir und trink vom heilsamen Wasser.« Kaum hatte der Knabe die Kräuter, so eilte er über Stock und Stein nach Hause und tat nach den Worten des Berggeistls.
Er ging in die Küche, machte Feuer an und sott die Kräuter. Dann seihte er das Wasser ab und trank es voll Gier. Doch siehe, kaum hatte er es getrunken, als er für seine Falschheit bitter bestraft wurde. Er bekam Bauchweh, daß er sich vor Schmerzen wie ein Wurm wand und bog. Das dauerte einige Tage, und seitdem war er ein braver Bursche, denn das Kräutlein hatte eine gar heilsame Wirkung getan.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zirl
DIE ZWEI KÖNIGSKINDER ...
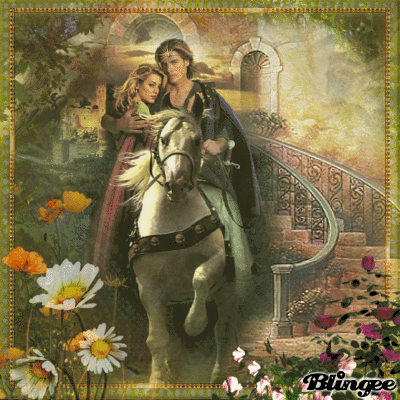
Es waren ein König und eine Königin, die hatten sich lieb und waren fein miteinander wie die Engel im Himmel. Noch war es nicht lange her seit ihrer Hochzeit, da brach ein furchtbarer Krieg aus. Der König mußte Abschied nehmen von seiner lieben Gemahlin und dem Feind entgegenziehen.
Wie er nun im Feld stand, erhielt er eines Tages einen Brief von seiner Mutter, darin stand geschrieben, daß die junge Königin zwei Kinder bekommen habe, einen Prinzen und eine Prinzessin. Die Prinzessin trage einen goldenen Apfel in ihrer Hand, auf der Stirn des Prinzen aber funkle ein goldener Stern. Übrigens tue der König nicht gut und gescheit, wenn er diese zwei Kinder als die seinigen aufnehme.
Der König merkte nicht die Bosheit seiner Mutter, die der jungen Königin spinnefeind war und deswegen Zwietracht zu säen suchte zwischen ihr und ihrem Mann. Feuerrot vor Zorn legte er den Brief beiseite und schrieb seiner Mutter zurück, man solle die zwei Kinder bei Seite schaffen und die Königin in den Turm werfen.
Die Alte tat, wie ihr der König befohlen hatte, und ließ die arme Königin in das Gefängnis werfen. Die Kinder aber wurden in ein hölzernes Kästchen geschlossen und nachts in den Bach geworfen. Das Kästchen schwamm auf dem Bach dahin und wurde von den Wassern weit, weit fort getragen. Endlich kam es an eine Mühle.
Da es den Gang der Räder hemmte, kam der Müller, um nachzusehen, was denn dahinter stecke, daß die Mühle nicht mehr gehen wolle. Er fand das Kästchen und nahm es aus dem Wasser, und die Räder fingen wieder an zu rasseln und zu patschen. Der Müller aber war wie vom Himmel gefallen, als er das Kästchen geöffnet hatte und die beiden Kinder erblickte.
Weil er ein gutherziger Mann war, faßte er schnell den Entschluß, die armen »Höselen« bei sich zu behalten und mit seinen eigenen Kindern aufzuziehen. Die Kinder des Müllers hatten anfangs ihre Freude an den beiden Findlingen, und es war Ruhe und Frieden im Hause. Es kam aber eine Zeit, wo des Müllers Kinder den beiden Königskindern vor hielten, daß sie eigentlich nicht hierher gehörten und bloß gefundene, nicht aber rechte Kinder des Müllers seien.
Das tat den beiden Geschwistern weh bis tief in die Seele hinein, und als sie beiläufig ins zwanzigste Jahr gingen, beschlossen sie sich aufzumachen und in der weiten Welt ihre rechten Eltern zu suchen. Der Müller, der seine lieben Pflegekinder ungern von sich ließ, mochte sagen, was er wollte, sie ließen sich nimmer aufhalten. Er gab ihnen einen Zehrpfennig und manche gute Lehre auf die Reise, und die beiden Königskinder traten wohlgemut ihre Wanderung an.
Sie gingen den ganzen lieben Tag in einem fort und dachten weder ans Müde werden noch ans Essen und Trinken. Ums Dunkel werden kamen sie an ein einsames Wirtshaus, und in diesem blieben sie über Nacht. Der Wirt war ein freundlicher Mann und fragte sie um dies und das, woher sie kämen und wohin sie gingen, und zeigte die aufrichtigste Teilnahme an ihrem Schicksal.
Sie vertrauten ihm auch alles an, was auf ihrem Herzen lag, und erzählten ihm, daß sie ausgegangen seien, um Vater und Mutter zu suchen. Der Wirt, dem ihr Schicksal zu Herzen ging, gab ihnen ein
Pferd und einiges Geld mit auf die Reise.
Am anderen Tag machten sie sich wieder auf, und ihr Weg führte sie nun in einen dichten, finsteren Wald.
Da gingen sie eine Weile fort, bis sie zu einem wunderschönen Palast kamen. In diesen gingen sie hinein, fanden aber darin zu ihrem Erstaunen keine Menschenseele. Aber Lebensmittel gab es da in Hülle und Fülle. Im Stadel lag auch reichliches Futter fürs Pferd, und da ihnen hier gar nichts abging, so beschlossen sie, einstweilen in dem Schloß zu bleiben.
Der Wald, in dem das Schloß stand, gehörte zum königlichen Forst, und der König, der unterdessen wieder vom Krieg heimgekehrt war, schickte einstmals seine Jäger aus, um ein köstliches Stück Wildbret zu erjagen. Die Jäger ritten lange Zeit im Wald umher, konnten aber kein einziges Stücklein auftreiben. Sie blasen in das Horn, der Jüngling schaut zum Fenster des Schlosses heraus und wird von einem Jäger gesehen.
Der hat gewiß ein Stück Wild, dachte sich der Jäger und ging hinauf in das Schloß. Er erzählte dem Jüngling, daß er in königlichen Diensten sei, und ließ auch sonst manches Wörtlein fallen über den königlichen Hof. Der Jüngling gab dem Jäger den Auftrag, den König in seinem Namen zu einer Mahlzeit einzuladen.
Der Jäger richtete seinen Auftrag getreu aus, und in einigen Tagen ging der König hinaus in das Schloß im Wald, um bei den unbekannten Fremdlingen zu Gast zu sein. Er wurde freundlich empfangen und aufs herrlichste bewirtet. Beim Essen ging die Rede über dies und jenes, und endlich lud auch der König seine freundlichen Nachbarn in sein Schloß zu einem Mahl ein. Sie sagten ohne Weigern zu, und der König ging nach Hause.
Die böse Schwiegermutter hörte auch von den beiden Geschwistern, die im Wald hausten und von ihrem Sohn zur Tafel geladen waren. Da regte sich ihr böses Gewissen und sagte ihr: »Holla, das könnten die zwei Kinder sein, die auf dein Anstiften in den Bach geworfen worden sind!« Es war ihr angst und bange bei der Sache, und sie ging zu einer Hexe, um sich Rat zu holen. Die Hexe redete ihr die Flausen aus und sagte: »Laß du nur mich machen!«
Eines Abends geht die Hexe hinaus in den Wald, klopft an die Tür des Palastes und bittet um Einlaß: »Husch, husch, ist mir kalt; darf ich mich nicht ein bißchen erwärmen?« Die Königskinder vergönnen ihr das gerne und lassen sie augenblicklich herein.
Sie hockt sich an das Feuer und lobt den Kindern in einem fort die Schönheit ihres Palastes vor und wie er so herrlich gelegen sei und wie sie es da so fein hätten und ohne Kummer und Sorge leben könnten. »Grad etwas solltet ihr noch haben«, fügte sie endlich bei, »einen Sonnenbaum, der recht schimmert und leuchtet.«
Sie munterte dann den Jüngling auf, diesen zu suchen, und zeigte ihm auch die Gegend, wo er zu bekommen sei. Sie tat aber das in der bösen Absicht, den Jüngling in eine Wildnis hinauszulocken, wo er von giftigen Schlangen umkommen sollte.
So sehr sich der Jüngling den strahlenden Sonnenbaum wünschte, so konnte er sich doch nur hart entschließen, ihn zu holen. Es kam ihm immer vor, als ob da nichts Rechtes dahinter wäre. Auch die Schwester konnte es fast nicht über ihr Herz bringen, von ihm Abschied zu nehmen, obwohl sie sich immer dachte, er ist ja nur einen Tag aus, und wenn die Sonne heimgegangen ist, kommt er ja wieder zurück mit dem schönen, glitzernden Sonnenbaum.
Der Jüngling konnte sich aber doch nicht halten, und eines Morgens sagte er zu seiner Schwester: »Heute werde ich ausziehen, den Sonnenbaum zu suchen. Laß uns die ganze Sache dem Himmelvater anheimstellen, er wird uns nicht verlassen.«
Sie zündeten dann zwei Lichter an, und wenn eines von diesen auslöschen würde, so sollte das der Schwester als Zeichen gelten, daß dem Bruder etwas widerfahren sei und daß er nimmermehr zurückkehre. Solange aber die Kerzen brannten, sollte sie immer noch gute Hoffnung haben, wenn es auch schon finstere Nacht wäre.
Der Bruder begab sich nun auf den Weg und wanderte durch einen schauerlichen Wald dem Ort zu, wo nach der Beschreibung der Hexe der Sonnenbaum stehen sollte. Als er seinem Ziel nahe kam, hörte er hinter sich die Stimme eines großmächtigen Wurms, der ihm zurief: »Geh nit hin! Du bist hin. Geh dort hin!«
Der Jüngling folgt der Stimme des Wurms und geht nach jener Seite hin, die er ihm angezeigt hatte. Es war schon tiefe Nacht, da sah er vor sich etwas leuchten und strahlen, daß er den Glanz fast nicht aushalten konnte - und das war der Sonnenbaum.
Die Schwester wartete voll Sehnsucht auf ihren Bruder, allein je tiefere Nacht es wurde, desto mehr sank ihre Hoffnung. Nur die beiden Kerzen, an denen immer noch helle Lichter brannten, waren ihr noch zum Trost. Jeden Augenblick schaute sie auf die Lichter, ob sie wohl noch brannten, und dann wieder zum Fenster hinaus nach der Gegend hin, nach der ihr Bruder gezogen war.
Endlich in später Nacht sah sie in der Ferne einen Glanz, der immer näher und näher zum Schloß kam und immer heller und heller leuchtete. Bald erkannte sie, daß dieses der Sonnenbaum war, und aller Kummer war vergessen. Als der Bruder endlich mit dem Sonnenbaum, der ihm den Weg erleuchtet hatte, herankam, glaubten die beiden Geschwister fast, es müsse ihnen das Herz zerspringen vor Freude.
Die Zeit verging in Heiterkeit und Ruhe, und bald kam der Tag, an dem die beiden Königskinder zu Hofe geladen waren. Beiden kam in den Sinn, daß der König ihr Vater sein könnte, und weil sie sich diesen Gedanken um alles in der Welt nicht aus dem Kopf bringen konnten, so dachten sie an ein Mittel, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Sie machten miteinander aus, bei der königlichen Tafel weder zu essen noch zu trinken, bevor alle gegenwärtig wären, die zum königlichen Haus gehörten.
Mit diesem Entschluß machten sie sich auf und kamen an den Hof. Der König empfing sie gar freundlich und führte sie in einen herrlichen Saal, wo eine mit den köstlichsten Speisen besetzte Tafel
stand.
Weil nun die Gäste da waren, setzten sich alle Anwesenden zu Tisch, und man forderte die beiden auf, sich zu laben an Speise und Trank. Aber eines weigerte sich wie das andere, früher zu essen, bevor alle Mitglieder des königlichen Hauses da wären. Man schickte nun nach der alten Mutter des Königs, die zuerst draußen geblieben war. Allein die zwei Gäste wollten noch nicht essen, denn »noch seien nicht alle da«.
Den Gästen zuliebe entschloß sich endlich der König, auch seine seit vielen Jahren eingesperrte Gemahlin vorführen zu lassen. Man mußte eine Zeitlang warten, bis endlich die Königin in erbärmlicher Gestalt in den Saal hereinwankte. Kaum hatte sie sich zur Tafel gesetzt, so setzte sich die eingeladene Königstochter an ihre Seite, der Königssohn aber setzte sich an die Seite des Königs.
Bruder und Schwester nahmen nun ihr Glas und tranken auf das Wohl von Vater und Mutter. Dem König wurde es ganz schwarz vor den Augen, er wußte anfangs nicht, was das bedeuten sollte und was da zu machen sei. Dann ließ er seine Räte kommen und alle Türen verriegeln. Es wurden nun alle Bücher und Schriften durchwühlt, und alles wurde offenbar, was der König und die zwei Geschwister zu wissen wünschten.
Man fand, daß die beiden Gäste des Königs Kinder seien und daß die Königin unverschuldet von der bösen Schwiegermutter angeschwärzt worden war. Darum wurde die Königin wieder von ihrem Gemahl in Liebe und Gnaden aufgenommen, die böse Schwiegermutter aber samt der falschen Hexe hingerichtet.
Der Müller, der die beiden Kinder in seinem Haus erzogen, und der Wirt, der ihnen Geld und Pferd gegeben hatte, wurden reichlich beschenkt. Der Palast im Wald verschwand, und am königlichen Hof war nun wieder Freude und Friede wie ehedem.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Oberinntal
NOCH EIN MÄRCHEN VON DER KRÖNLNATTER ...
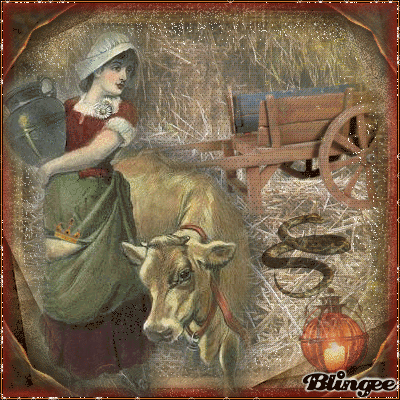
Es lebte vor langer Zeit, als du, mein Kind, noch den Pfeiffaltern nachflogst, eine kreuzbrave Magd, die bei einem Bauern im Dienst war. Sie tat treu und redlich ihre Pflicht, sah auf die Sache und das Vieh ihres Dienstherrn und arbeitete von frühmorgens bis spätabends.
Im Haus, in dem sie Ehehalt war, wohnte auch eine Krönlnatter. Das scheckige Würmchen, das ein hell glänzendes Krönlein auf dem Kopf trug, hielt sich in einer Mauerritze des Stalles auf und ließ sich selten sehen. Die meisten Hausbewohner wußten nur deshalb, daß eine Krönlnatter im Hause war, weil sie ihr wunderschönes Singen oft hörten.
Sooft aber die brave Magd in den Stall kam, um die Kühe zu melken, fand sich auch die Krönlnatter ein. Es war ein herziges Tierlein und hatte glänzende schwarze Äuglein, mit denen es die Magd gar bittend und klug ansah. Da dachte sich dann die Magd, ich weiß schon, was du möchtest, und goß ein wenig Milch in ein irdenes Schüsselchen und gab sie dem Tierchen zu trinken.
Da hättest du die Natter sehen sollen, wie sie ihr Zünglein spielen ließ und die weiße, warme Milch gierig einschlürfte. Wenn sie dabei ihr Köpfchen wendete, schimmerte das Krönlein wie eitel Gold, daß einem das Sehen hätte vergehen mögen. War das Schüsselein geleert, nickte die Natter mit ihrem Köpfchen, daß das Krönlein hellauf funkelte wie der Tau im Sonnenschein, und schlüpfte in die Ritze der Mauer.
Die Magd hatte ihre Freude an dem Tierchen und gab ihm morgens und abends Milch, und dies geschah um so lieber, als sie sah, daß die Natter Glück und Segen brachte. Denn seitdem diese Milch bekam, waren die Kühe immer gesund und gaben viel mehr Milch als früher. So ging es lange Zeit, und nichts kam dazwischen.
Als eines Abends die Natter wieder im Stall war und ihr Schlücklein Milch trank, kam der Bauer, der ein rechter Geizhals war, dazu und sah es. Gleich fing er an zu schelten und zu toben wie ein wildes Tier, nannte die brave Magd eine Schelmin und machte ihr die bittersten Vorwürfe. Das arme Mädchen schluchzte und weinte, daß eine Träne um die andere über ihre roten Wangen floß, und beteuerte ihre Unschuld.
Der Bauer ließ sich in seinem Fluchen und Schelten nicht irremachen und schrie: »Ich kann eine Magd, die so wirtschaftet und die Milch den Würmern gibt, nicht brauchen. Nimm deine Sachen und pack dich aus meinem Haus!« Die arme Magd mochte sagen und tun, was sie wollte, er bestand auf seinem Wort. Da ging sie weinend in ihre Kammer, schnürte ihre Kleider zusammen und ging aus dem Haus.
Bevor sie aber für immer Abschied vom Hof nahm, ging sie in den Stall, um noch einmal die lieben Kühe zu sehen. Wie sie dort stand und es sie schwer ankam, von den lieben Tieren, die ihre Stimme kannten und so oft ihre Hand geleckt hatten, zu scheiden, kroch plötzlich die Krönlnatter daher, machte vor der Magd halt und schüttelte das funkelnde Krönlein vor sie hin. Im Nu war dann das Tierlein durch die Stalltür hinaus und wurde nie wieder gesehen.
Die Magd nahm das schöne Krönlein, das ihr die Natter aus Dankbarkeit gebracht hatte, zu sich und kehrte zu ihrer Mutter, die eine Häuslerin war, zurück. Und wie ist es dem braven Mädchen weiter ergangen? Ganz gut, denn das Krönlein macht jeden, in dessen Besitz es ist, steinreich.
Der Bauer hatte aber, seitdem die Krönlnatter aus dem Haus war, kein Glück mehr. Mit seiner Wirtschaft ging es bergab, und er kam später von Haus und Hof. So wurden seine Unbarmherzigkeit und sein Geiz bitter bestraft.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Absam
DER BETTLER ...
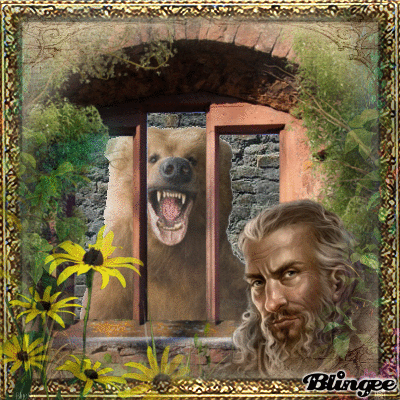
Ein Bettelmännlein kam einmal auf eine Alpe und bettelte um einen Ziegenkäse. Er bekam auch ein ordentliches Stück, denn die Almer waren mitleidige Leute und gaben gern von dem, was sie hatten. Das Stück Käse legte der Bettler in seinen zerlumpten Hut, und während er seines Weges fortging, schaute er nicht immer auf den Boden, sondern jeden Augenblick betrachtete er wieder seinen Ziegenkäse.
Den Fliegen aber, die um ihn herumsummten, stieg der Geruch davon auch in die Nase, und flugs saß es kohlschwarz auf dem Käse. Das Bettelmandl wurde darüber zornig, nahm den Hut in die linke Hand und holte mit der rechten zu einem tüchtigen Schlag aus. Patsch! Da klebten sieben Fliegen maustot auf dem Käse.
»Eins - zwei - drei - vier - fünf - sechs - sieben - richtig, ihrer sieben sind's«, sagte das Mandl und wollte fast eher glauben, daß es falsch gezählt als daß es eine solche Heldentat ausgeübt habe. Es zählte noch einmal langsam und bedächtig, allein es kam wieder bis zum Siebener und jauchzte laut auf: »Sieben auf einen Streich! Das müssen sie im Dorf auch wissen!«
Gesagt, getan. Er nahm einen Fetzen Papier und schrieb darauf: »Sieben auf einen Streich.« Den Zettel heftete er sich auf den Hut, und so zog er in das Dorf ein. Alle Leute, die ihm begegneten, blieben stehen und schüttelten verwundert die Köpfe. »Das muß ein Mordskerl sein«, sagte einer zum anderen, »der schlägt sieben auf einmal tot.«
Im Nu war die Nachricht vom Bettelmandl durch das ganze Dorf verbreitet. Die Leute dachten sich, wenn der sieben Lottern auf einmal das Lichtl ausbläst, so wird er einen Brummbären wohl auch kriegen. Man bot nun dem Bettler einen großen Haufen Geld, wenn er den Bären im Wald draußen erlegen würde. Er traute sich so etwas schon zu und ging eilends in den Wald hinaus.
»Kommt mir das Vieh nur«, brummte er vor sich hin, »ich will mit ihm schon fertig werden. Wer sieben auf einen Streich totschlägt, der fürchtet sich nicht vor einem Bärlein.« Während er so vor sich hin murmelte, kam der Petz langsam aus dem Dickicht heraus getrippelt. Den Bären sehen und davonlaufen, das war eins.
Ohne umzuschauen lief das Bettelmandl bis zu einer Hütte, die ihm gerade am Weg lag. Da lief es hinein und der Bär hintennach - aber der Bettler hatte Zeit, schnell wieder umzukehren und bei der Tür herauszuschlüpfen. Sobald er im Freien war, schlug er die Tür zu, und der Petz kam nimmer aus.
Dem Bettler war jetzt freilich die Angst wieder vergangen und er lief Hals über Kopf in das Dorf. »Jetzt geht hinaus schauen, wenn ihr euch wundert. Dort draußen in der Hütte ist er eingesperrt«, so rief er den Leuten zu, die ihm begegneten.
Alle wunderten sich, daß er das wilde Vieh so mir nichts, dir nichts in die Hütte hineingebracht hatte. Die jungen Burschen gingen hinaus und wollten dem Petz den Garaus machen, konnten aber den großen Kerl fast gar nicht meistern. Der Bettler, der bei der Arbeit zuschaute, lachte sie tüchtig aus und sagte: »Schämt euch doch, wenn ihr mit dem eingesperrten Bären nicht fertig werdet; schaut, ich habe ihn gerade bei den Ohren genommen und in die Hütte gezogen. Das ist was anderes!«
Die Burschen mußten sich auslachen lassen, allein endlich kriegten sie den Petz doch, und nachdem die Geschichte so abgelaufen war, mußte auch dem Bettler das versprochene Geld ausbezahlt werden. Das Ding war gut, aber es dauerte nicht lange, da kamen die Leute auf den Einfall, der starke Kerl, der den Bären bei den Ohren aus dem Wald geführt habe, könne sich wohl auch über den wilden Mann herwagen.
Sie versprachen ihm wieder einen Haufen Geld, und der Bettler geht in den Wald hinaus. Er wird des wilden Mannes bald ansichtig und wettet etliche Male mit ihm, wer von beiden stärker sei. Allemal aber gewinnt der wilde Mann, und der Bettler zieht den kürzeren.
Endlich fangen sie an, miteinander Prügel zu klieben. Es dauert nicht lange, da klemmt sich der wilde Mann fest ein. »Geh nur gleich zu meinem Weib, der Fangga, und laß dir den Eisenkeil geben«,
sagt er zum Bettler. Der Bettler geht zur Fangga und begehrt den Geldbeutel. Die Fangga weiß nicht recht, wie sie daran ist, und schreit endlich ihrem Manne zu: »Oder soll ihnen göbe?«
»Nun geschwind«, schreit der wilde Mann.
Der Bettler kriegt den Geldbeutel und läuft davon. Er kommt zu einer Schafherde, faßt heimlich von dem Hirten ein Lamm und steckt es sich in den Hemdschlitz. Dann schneidet er dem Lamm während des Laufens den Bauch auf und wirft die Gedärme heraus. Jetzt läuft er noch schleuniger, und endlich versteckt er sich im Gebüsch.
Es dauert nicht lange, da kommt der wilde Mann atemlos daher gerannt, und wie er die Schafhirten sieht, fragt er sie, ob da niemand vorbei gelaufen sei. »Freilich ist einer vorbei gelaufen, der hat sich selber den Bauch aufgeschnitten, und dann ist's noch viel schleuniger gegangen als zuvor.«
Wie der wilde Mann das hört, nimmt er ein Messer, schneidet sich den Bauch auf und wirft die Gedärme heraus. »So, jetzt wird's besser gehn«, meint er, und da liegt er schon der Länge nach auf dem Boden und gibt den Geist auf. Der Bettler hüpft aus seinem Versteck hervor, betrachtet lustig den toten Kerl und läuft ins Dorf zurück. »Geht hinaus, zu schauen, wenn ihr euch wundert, da draußen liegt der wilde Mann und tut keinen Zappler mehr. Aber jetzt her mit dem versprochenen Geld!«
Die Bauern gehen hinaus und sehen wohl, daß dem wilden Mann kein Zahn mehr wackelt. Sie zahlen nun dem Bettler gern das versprochene Geld, und der Bettler ist ein reicher Mann.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Oberinntal
DER ADVOKAT ...
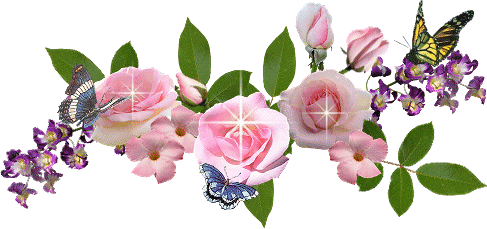
Vor alter Zeit lebte ein Advokat, der das Recht verkehrte, wann und wie es ihm taugte, und sich weder um Hölle noch um Himmel kümmerte. Einmal mußte er wieder vor Gericht erscheinen und eine Aussage eidlich bekräftigen. Er legte seinen Eid ab, schwor aber falsch.
Da erschien der Teufel in leibhaftiger Gestalt, wollte den Rechtsanwalt beim Kragen nehmen und in die Hölle tragen. Man holte, als man dies sah, einen frommen, alten Priester, und dieser betete so lange, bis der Teufel sich in eine Katze verwandelte und die Gerichtsstube verließ.
Sie ging in die Wohnung des Advokaten und legte sich dort auf die Stiege, wo sie bis zum Tod des Advokaten trotz aller Segnungen und Beschwörungen blieb. Dem Advokaten konnte sie aber kein Leid mehr antun, weil er sich von dem Meineid an gebessert hatte und rechtliche Wege wandelte.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DER RIESE ...

Unversehens kam einmal ein Hütebub in eine Berghöhle und erblickte da zu seinem Schrecken einen Mordskerl von einem Riesen. Der saß an einem Tisch, stützte den schweren Kopf auf die Hand und schnarchte wie ein Trompeter. Der Bub hatte keinen Schneid, den langen Lümmel aufzuwecken, und lief Hals über Kopf in das Dorf.
Keuchend erzählte er den Bauern, was er gesehen habe und wie er bei dem grausigen Anblick erschrocken sei. Die Bauern, die das hörten, rissen die Mäuler auf wie nicht gescheit, und den meisten flatterte bei dem bloßen Hören das Herz wie der Schweif eines Lämmleins.
Die zwölf tapfersten aber stellten sich zusammen und beschlossen hinaus zu gehen, um dem Riesen den Garaus zu machen. Denn sie dachten sich: So einen Nachbar zu haben ist doch nicht recht, und wenn er tot wäre, könnte es auch was tragen. Er wird doch auch was in seiner Höhle haben.
Sie gingen nun alle zwölfe hinaus und schlichen sich in die Höhle hinein. Sie fanden den Kerl noch im tiefen Schlaf, und neben ihm sahen sie Schwert und Spieß liegen. Wie mit einem Griff tappten alle zwölfe nach dem schweren Spieß und stießen ihn nach einem kräftigen Schwung dem Riesen ganz durch den Leib.
Durch den Stoß geriet er in Bewegung, und die Bauern glaubten nicht anders, als daß es ihnen jetzt schlimm ergehe, weil er schon anfange sich zu regen. Sie machten alle rechtsum und liefen mit solcher Hast in das Dorf, daß einer den anderen fast überrannte.
Im Dorf erzählten sie den Leuten, was das für eine gräßliche Geschichte gewesen sei mit dem Riesen, wie er über sie hergefallen sei und sie sich nur mit knapper Not gerettet hätten. Da war ein Schrecken im Dorf, als ob der jüngste Tag käme und alt und jung und klein und groß mußte sich rüsten, um gegen den Riesen auszuziehen.
Nach langer Zeit kam es endlich zum Auszug. Mit lautem Herzklopfen wanderte das ganze Dorf der Höhle zu. Wie sie da ankamen, war freilich von dem Riesen nichts anderes mehr übrig als die Knochen, mit Staub bedeckt. Denn die Rüstung hatte so lange gedauert, daß der Leichnam völlig verfault war.
Aber auch diese wenigen Überbleibsel vom Riesen setzten die Leute so in Schrecken, daß sie schnell Bäume und Sträucher umhauten und vor die Höhle schleppten. So verrammelten sie den Eingang, damit etwa der Riese gewiß nimmer heraus käme.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Oberinntal
DER MENSCHENFRESSER ...
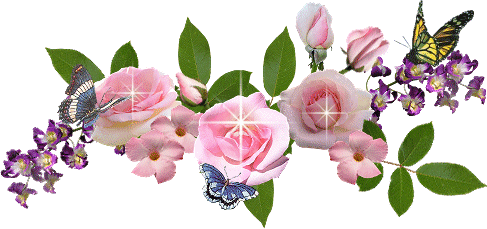
Einmal verspätete sich ein Büblein, das Erdbeeren suchte, im Wald. Es dunkelte schon, und an ein Nachhausekommen war nicht mehr zu denken. Da dachte das Büblein: Vielleicht wohnen Leute in der Nähe, bei denen ich übernachten kann. Wart, ich will mal auf einen Baum klettern und schauen, ob nirgends ein Haus zu sehen ist.
Gedacht, getan. Es spuckte sich in die Hände und kletterte auf eine Tanne hinauf wie ein Eichkätzchen. Als es am hohen Wipfel droben hing, schaute es nach allen Seiten aus und sah in nicht weiter Entfernung ein Hüttchen stehen. Darob hatte das Bübchen keine kleine Freude und stieg rasch und munter vom Baum herunter, dann schlug es den Weg zum Hüttchen ein, bei dem es auch bald anlangte.
Das Büblein wollte nun hineingehen, allein die Tür war geschlossen. Da klopfte der Knabe an die Tür, bald wurde sie geöffnet, und ein altes, kleines Mütterlein fragte um sein Begehr. Da sprach das Büblein: »Ich bitt' um eine Nachtherberge, denn ich komme heut nicht aus dem Wald, und da draußen fürcht' ich mich vor den Wölfen und Bären.«
Darauf antwortete das Mütterlein: »Mein gutes Kind, da bist du hier nicht am rechten Ort, denn hier wohnt der Menschenfresser, der dich mit Haar und Bein auffräße, wenn er deiner ansichtig würde.« Als das Büblein dies hörte, fing es an zu weinen und sprach bittend: »Gebt mir doch eine Nachtherberge und versteckt mich vor dem Menschenfresser.«
Das Mütterlein hatte Mitleid mit dem Knaben und führte ihn in das Hüttchen. Dort versteckte sie ihn in einem leeren Fäßchen, gab ihm ein Hölzchen und sprach: »Nun duck dich und halt dich mäuschenstill. Wenn dich aber der Alte dennoch aufspürt und er einen Finger von dir sehen will, so halt ihm das Hölzchen heraus.« Dann ging sie ihren Geschäften nach.
Dem Büblein war aber in seinem Fäßchen höllenangst, so daß ihm der kalte Schweiß herab rann. So war ihm unter Furcht und Angst schon einige Zeit verstrichen, als es draußen polterte und der wilde Mann in die Stube trat. Dieser witterte und sprach dann: »Ich schmecke, ich schmecke Menschenfleisch!«
Da wollte das alte Mütterchen ihm diesen Glauben nehmen und sagte: »Du schmeckst, du schmeckst einen Hennendreck.« Der Menschenfresser ließ sich aber nicht irremachen, witterte immer mehr und mehr und kam zum Fäßchen, in dem das Bübchen saß, da sprach der Alte mit grauenhafter Stimme: »Da drin, da drin ist Menschenfleisch. Reck du deinen Finger heraus, damit ich sehe, ob du fett bist.«
Da dachte das Büblein an den Rat des alten Weibchens und hielt das Hölzlein heraus. Das betastete der Menschenfresser und sprach: »Dieses Stück ist noch holzdürr! Es muß noch gemästet werden.« Dann setzte er sich zum Tisch, fraß, trank und fluchte und ging, als er satt war, ins Bett.
Das Büblein war aber seelenfroh und dankte Gott für seine Rettung. Dann schlief es auch ein. Am anderen Morgen ging der wilde Mann schon früh in den Wald. Als er fort war, hieß das alte Mütterchen den Knaben aus dem Fäßchen gehen und gab ihm ein Frühstück. Dann sagte sie: »Jetzt iß und stille deinen Hunger, dann will ich dich aus dem Wald führen.«
Der Knabe ließ sich das nicht zweimal sagen, aß wie ein Drescher und ging dann mit dem alten Mütterlein in den Wald hinaus. Dieses führte ihn durch dichten und dünnen Wald, bis sie ins Freie kamen, dann sagte sie zum Bübchen: Verspäte dich in Zukunft nicht mehr im Wald, denn es könnte dir schlechter gehen als dieses Mal.«
Das Bübchen dankte der kleinen Frau und lief dann über Stock und Stein in die Heimat. Seitdem verspätete es sich nie mehr und kam immer zur rechten Zeit nach Hause.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Deutsch-Tirol
BEUTEL, HÜTLEIN UND PFEIFLEIN ...

Es war einmal ein Vater, der hatte drei Buben und vermachte jedem von ihnen ein kostbares Erbstück. Für den ältesten bestimmte er einen Geldbeutel, der nie leer wurde, für den zweiten ein Hütlein, durch das man alles bekam, was man sich nur wünschte, und für den jüngsten ein Pfeiflein, mit dem man sich so viele Soldaten herbei- und fortpfeifen konnte, wie einem in den Kopf kam.
Nachdem der Vater gestorben war, nahmen die drei Söhne Besitz von ihrem Erbteil, und der Älteste dachte daran, seinen Beutel gut anzuwenden. »Ei«, sagte er eines Tages zu seinen Brüdern, »ich habe gar keine Lust mehr, in der engen Stube zu sitzen, ich will hinausgehen und ein bißchen die Welt anschauen. Wer einen Beutel hat wie ich, dem kann es auf der Reise nicht fehlen.« Also nahm er Abschied von seinen Brüdern und zog hinaus in Gottes freie Welt ohne Plan und Regel.
Nachdem er eine Zeitlang herumgereist war, kam er in die Residenzstadt des Königs. Hier gefiel es ihm, weil es Gelegenheit gab, sich zu zeigen und mit Geld zu glänzen. Er lebte in Saus und Braus wie ein Fürst und tat so groß, wie nur einer tun kann, dessen Beutel nie leer wird.
Alles in seinem Haus glänzte von Gold und Silber, und in der Küche ging es so vornehm her, daß die Köche statt des Holzes Zimtspäne verheizten. Darob verbreitete sich ein so starker Geruch in der ganzen Stadt, daß der König auf den fremden Mann aufmerksam wurde und ihn an seine Tafel lud, um sich des nähern zu erkundigen.
Der König hatte auch eine Tochter, die tat dem neuen Gast so schön und wußte sich so an ihn heranzumachen, bis er endlich zu reden anfing. Er zeigte der schönen Prinzessin seinen Geldbeutel und erzählte ihr von der Wunderkraft, die ihm innewohnte. Der König hieß ihn bei Hof bleiben und hielt ihn so in Ehren, daß er ihn endlich gar zu seinem Minister machte.
Die schlaue Königstochter verschaffte sich indessen einen Geldbeutel, der dem wunderbaren Säckel ganz gleichsah, und lud eines Tages den Minister zu einem Spaziergang ein. Der Minister nahm die Einladung an und ging mit der schönen Prinzessin hinaus in die freie Natur, bis sie zu einem großen, schattigen Baum kamen. »Hier wollen wir ein wenig ausrasten«, sprach die Königstochter, »und ein gutes Glas zur Erquickung trinken.«
Der Minister tat ihr wieder den Gefallen, und so setzten sich beide in den kühlen Schatten des Baumes. Die Prinzessin zog eine Flasche aus dem Sack und brachte sie dem Minister. Dieser wußte nicht, wie faustdick es die Königstochter hinter den Ohren hatte, und tat einen kräftigen Zug.
Es dauerte aber nicht lange, so fühlte er die Wirkung des Schlafpulvers, das die Prinzessin in den Wein getan hatte, schloß von Zeit zu Zeit kurz die Augen und schlief endlich wie eine Ratte. Nun machte sich die Prinzessin über seine Taschen her, stahl ihm den wunderbaren Beutel und tat den nachgemachten, tüchtig mit Gold angefüllt, an dessen Stelle. Dann ließ sie den Minister Minister sein und machte sich aus dem Staub.
Als der Minister aufwachte und keine Königstochter mehr bei sich sah, kam ihm die ganze Sache nicht mehr richtig vor, und sein erster Griff ging in die Tasche, worin er den wunderbaren Beutel zu tragen pflegte. Er gewahrte den vollen Beutel, stand auf und ging ohne weitere Sorge an den Hof zurück.
Der Beutel hatte aber seine treffliche Eigenschaft verloren, so daß er in wenigen Tagen leer wurde und nimmer voll werden wollte. Der Minister merkte nun wohl, daß er von der Prinzessin hintergangen worden sei, konnte aber weder seinem Ärger Luft machen noch den kostbaren Beutel wiederbekommen.
Nach langem Kopfzerbrechen reiste er nach Hause, um dort Hilfe zu suchen. Er ging zu seinem jüngeren Bruder, der das Wünschhütlein geerbt hatte, und bat ihn: »Lieber Bruder, ich bin um meinen Beutel schändlich betrogen worden, und nur du kannst mir wieder dazu verhelfen. Sei doch so gut und leihe mir auf kurze Zeit dein Wünschhütlein, damit ich meinen Beutel wiederbekommen kann. Ich würde dir dafür mein Lebtag Dank wissen.«
Der Bruder war ein guter Kerl und schlug ihm seine Bitte nicht ab, sondern brachte ihm alsogleich das wunderbare Hütlein. Der Minister wollte nimmer aufhören zu danken, nahm das Hütlein und reiste damit an den Hof zurück. Er ließ sich also beim König melden, und der König lud ihn zur Mittagstafel ein. Da wurde gegessen, getrunken und musiziert, und der Himmel war voller Geigen.
Der Minister machte zwar anfangs ein Gesicht wie ein Pechstecher, vergaß aber bald Kummer und Sorgen und scherzte und lachte wie alle übrigen. Der schlauen Königstochter entging das nicht, sie setzte sich wieder an seine Seite und wußte sich so an ihn heranzumachen, daß er vor ihr kein Geheimnis hatte und ihr von seinem Wünschhütlein erzählte.
Ei, dachte die Prinzessin, das Hütlein ist viel wert, das lasse ich nicht aus. Sie machte es wieder wie das erste Mal, verschaffte sich ein Hütlein, das dem Wünschhütlein ganz ähnlich sah, und ging mit dem Minister spazieren. Unter einem schattigen Baum machten sie Rast, und der Minister bekam wieder ein Tränklein, auf das er in einen tiefen Schlaf versank.
Als er aufwachte, war die Prinzessin fort, und sein Wünschhütlein war auch fort; denn so oft er mit dem Hütlein, das er jetzt aufhatte, etwas herbeizuwünschen versuchte, kam gar nichts zustande. Was sollte nun der arme Minister machen? Den Beutel verloren, das Hütlein verloren und sonst auch nichts haben, das war ein bißchen zu arg.
Hätte er nur jetzt das Pfeiflein des jüngsten Bruders gehabt, er hätte Soldaten ausmarschieren lassen ohne Maß und Ziel und würde Beutel und Hütlein schon wiederbekommen haben. Ja, dieses Pfeiflein sah ihn jetzt wohl recht an, aber er besann sich doch lange, bis er sich wieder entschloß, nach Hause zu gehen und auch noch das Pfeiflein zu leihen.
Endlich machte er sich auf den Weg, und als er heimkam, begab er sich zu seinem jüngsten Bruder: »Schau, Brüderle, ich bin um alles gekommen, um Beutel und Hütlein. Wenn du mir dein Pfeiflein nicht leihst, so werden wir nichts mehr zurückbekommen.« Der jüngste Bruder war ein guter Kerl, brachte ihm sein Pfeiflein und wünschte ihm Glück auf den Weg.
Nun war der Minister wieder obenauf und eilte dem Hof zu. Er ließ sich beim König melden und wurde wieder zur Tafel geladen. Da war alles kreuzlustig und der Minister nicht minder, denn Speise und Trank mundeten ihm gut. Das kostbare Pfeiflein ließ ihn auch nicht kopfhängerisch sein.
Wie aber die Prinzessin den Minister wieder sah und merkte, daß er so lustig sei, so dachte sie sich gleich: Holla, der hat gewiß wieder etwas mitgebracht! Sie setzte sich an seine Seite, tat freundlich mit ihm und wußte sich wieder so an ihn heranzumachen, daß er ihr das Pfeiflein zeigte und von dessen wunderbarer Eigenschaft erzählte.
Nun ging Sinnen und Trachten der Prinzessin wieder einzig und allein darauf hin, des wunderbaren Pfeifleins habhaft zu werden. Sie verschaffte sich zu dem Zweck ein ähnliches Pfeiflein, lud den Minister zu einem Spaziergang ein und gab ihm unter einem kühlen Baum ein Tränklein, das ihm alsbald die Augen zufallen machte.
Als er nach langem Schlaf wieder zu sich kam, war die Prinzessin aus dem Staube, und auf dem Pfeiflein, das er in der Tasche hatte, konnte er keinen einzigen Mann herbei blasen. Nun saß er freilich recht übel in der Tinte! Der Beutel fort, das Hütlein gestohlen und das Pfeiflein nicht mehr da - was war da zu machen?
Bei seinen Brüdern hatte er nichts mehr zu hoffen, außer höchstens Vorwürfe, und an den Hof zurückzugehen konnte er auch keine Lust mehr haben. Er wußte nicht, was anfangen vor lauter Zorn und Ärger. Endlich sprang er von seinem Sitz auf und lief Hals über Kopf in den Wald hinein. Da irrte er lange Zeit herum und dachte an nichts als an die drei verlorenen Stücke.
Eines Tages trug es sich zu, daß er tief im Wald an eine Klausnerhütte kam. Er ging hinein, und da saß ein grauer Mönch, der ihn freundlich anredete und um sein Anliegen fragte. Dem erzählte er sein ganzes Unglück von A bis Z und bat ihn, er möge ihm doch helfen, wenn es in seiner Macht stände.
Der Mönch horchte gut zu und murmelte für sich in den Bart hinein. Als die Erzählung zu Ende war, tröstete er den Minister und sagte: »Helfen kann ich dir schon, aber du mußt pünktlich vollziehen, was ich dir sage.« Der Minister versprach, aufs genaueste zu folgen, und er war gespannt, was ihm der Alte für ein Mittel geben werde.
Der Mönch suchte eine Zeitlang in der Zelle herum, zog endlich einen Korb aus einer Ecke hervor und brachte ihn dem Minister: »Siehst du, da hast du einen Korb voll Äpfel, und unter diesen ist ein ausnehmend schöner, der ganz wunderbare Kräfte hat. Denn wer immer davon ißt, dem wachsen sogleich Hörner, die ihm kein Doktor mehr weg doktern kann.
Du gehst nun in die Stadt, setzt dich auf den Marktplatz und bietest deine Äpfel zum Verkauf. Aber diesen schönen darfst du nicht billiger hergeben als um einen Louisdor. Denn wenn du ihn so teuer gibst, so wird ihn gewiß niemand anders kaufen als der König.«
Der Minister versprach zu gehorchen, zog eine alte Kutte an, die er sich vom Mönch auslieh, und ging in die Stadt. Auf dem Obstplatz setzte er sich nieder und bot seine Äpfel zum Verkauf. Viele Leute, die vorbei gingen und den schönen, großen Apfel sahen, wollten ihn haben, aber als sie den Preis hörten und durch Handeln nichts ausrichteten, ließen sie ihn gerne liegen.
Endlich kam die Köchin des Königs, sah den schönen Apfel und zahlte ohne Widerrede den hohen Preis. Sie tischte ihn am gleichen Tag noch auf und freute sich schon auf das Lob, das sie wegen des
schönen Obstes zu bekommen hoffte.
Bei der Tafel staunte alles über den herrlichen Apfel, und weil es gar so etwas Außerordentliches war, wurde er in drei Teile zerteilt, so daß der König ein Stück erhielt und eins die Königin und
eins die Prinzessin.
Alle drei machten sich mit der größten Gier darüber her und ließen sich kaum Zeit zum Kauen. Als aber alle drei einen Bissen verschluckt hatten - wie schauten sie da einander an! Einem jeden schoben sich zwei Hörnlein zur Stirn heraus, die wuchsen immer schneller und schneller, und in einigen Minuten schauten alle drei aus wie der leibhaftige Teufel.
Da gab es die größte Verwirrung im ganzen Schloß, man holte einen Arzt nach dem anderen und eine Salbe nach der anderen, aber nichts wollte helfen - die Hörner blieben so fest und so lang, wie sie anfangs gewesen waren.
Als der Minister den kostbaren Apfel so gut an den Mann gebracht hatte, war er über die Maßen froh, nahm seinen Korb und ging schleunig in die Klausnerhütte zurück. Mit der größten Freude erzählte er dem Mönch von dem glücklichen Handel und schilderte ihm, wie gut sich die Prinzessin mit den Hörnern ausnahm.
»Jetzt warte ein wenig«, sagte der Mönch, »ich werde dir eine Salbe geben, mit der du die Hörner wieder weg bringen kannst. Aber dann sieh zu, daß du deine drei Stücke wiederbekommst.« Er holte eine Salbe, gab sie dem Minister und nahm Abschied von ihm. Dieser dankte lange Zeit und ging wohlgemut in die Residenz zurück.
Auf dem Weg kam er an ein Wirtshaus, in dies ging er hinein und erkundigte sich, ob es nichts Neues gäbe. »Ja, Neues genug«, hieß es, »bei Hof sind ja Hörner gewachsen, und kein Doktor kann diese Dinge wieder fortbringen.« »Da wäre ja ich der Mann«, erwiderte der Fremde. »Die Hörner sollen fort gehen wie weg geblasen.«
»Ja, wenn du das kannst«, hieß es, »dann geh nur und laß dich bei Hof melden.«
Er ging und ließ dem König ansagen, daß ein Doktor gekommen sei, der alle Hörner flugs wegbringen könne. Wie der König das hörte, ließ er ihn sogleich zu sich kommen und bat ihn um seine
ärztlichen Dienste. Der Minister packte seine Salbe aus, bestrich die Hörner des Königs, und alsbald war nichts mehr davon zu sehen.
Der König war herzlich froh, die unanständige Zierde los zu sein, und rief nach seiner Gemahlin. Die Frau Königin mit dem zweizackigen Diadem trat herein und schrie vor Freude laut auf, als sie ihren Gemahl zum ersten Mal wieder ohne Hörner sah. »Da ist der Mann, der dich kurieren kann«, sagte der König. »Komm und halte ihm dein Haupt hin.«
Die Frau Königin lief auf den Doktor los, daß sie ihn fast mit den Hörnern nieder stieß, und bat ihn um seine Hilfe. Der Doktor machte nicht lange Umstände, bestrich die Hörner mit seiner Salbe, und im Nu waren sie weg. Auf den Ruf des Königs kam nun auch noch die gehörnte Prinzessin herein stolziert und schaute groß drein, als sie den König und die Königin auf einmal ohne Hörner sah.
Sie erschrak ordentlich als sie daran dachte, daß sie jetzt die einzige gehörnte Person am Hof sei. Sie war aber sogleich wieder getröstet, als sie der König zu dem Doktor führte und ihr sagte, daß es dieser Mann sei, der gegen die Hörner helfen könne. Der Doktor griff sogleich zu seiner Salbe und schmierte die Hörner der Prinzessin damit ein. Aber, o Schrecken! Anstatt abzunehmen, fingen die Hörner an zu wachsen und wurden um ein gutes Stück länger.
Während alle vor Schrecken die Hände zusammenschlugen und am meisten die Prinzessin, lächelte der Doktor und sagte: »Königliche Hoheit müssen vielleicht ein ungerechtes Gut besitzen, weil die
Salbe die verkehrten Wirkungen macht.«
Als die Prinzessin das hörte, wurde sie brennrot vor Scham, lief in ihr Gemach und brachte den wunderbaren Beutel.
Der Doktor nahm ihn zu sich und fing wieder an, die Hörner einzuschmieren. Aber nein! Die Hörner fingen wieder an zu wachsen und fuhren noch immer um ein gutes Stück in die Höhe. Da wußte sich die Prinzessin nimmer zu helfen vor Entsetzen und wollte anfangen den Doktor zu schelten. Dieser aber lächelte wieder und sagte: »Königliche Hoheit müssen noch ein ungerechtes Gut besitzen, weil die Salbe die umgekehrte Wirkung tut.«
Brennrot vor Scham lief die Prinzessin in ihr Gemach und kam alsbald mit dem Wünschhütlein wieder. Der Doktor nahm das Hütlein zu sich und beschmierte die Hörner zum dritten Mal. Die Hörner fingen wieder an zu wachsen, wuchsen aber nicht rückwärts, sondern stiegen wieder fein langsam in die Höhe.
Der Doktor aber ließ die Prinzessin nicht anfangen zu schelten und zu jammern, sondern sagte sogleich: »Königliche Hoheit müssen noch ein ungerechtes Gut besitzen, weil die Salbe die umgekehrte Wirkung tut.« Brennrot vor Scham lief die Prinzessin in ihr Gemach und kam eiligst mit dem wunderbaren Pfeiflein wieder. Nun salbte ihr der Doktor die Hörner zum vierten Mal, und im Nu waren sie verschwunden.
Die Prinzessin war froh, daß ich nicht sagen kann wie, und dankte von ganzem Herzen. Auch König und Königin waren außer sich vor Freude und gaben ein großes Fest, das ich dir nicht beschreiben will, weil dir sonst die Zähne darnach wässern könnten.
Der Doktor war froh, seine drei Stücke wieder zu besitzen, und freute sich auf das gute Leben, das nun vom neuen beginnen sollte. Zu seinen Brüdern wollte er nicht mehr zurückkehren, sondern die zwei Stücke, die er von ihnen geliehen hatte, ungerechterweise für sich behalten.
Dafür traf ihn aber die Strafe Gottes, denn der König fiel über ihn her, nahm ihm alle drei Stücke ab und brachte ihn selber ums Leben.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DIE WETTE ...

Büblein, wie heißt du?
»Hansele.«
Wenn du Hansele heißt, so muß ich dir schon wieder einmal ein Geschichtlein von einem Hansl erzählen.
Hansl hieß ein recht dummer Bauer, der kaum bis fünf zählen konnte. Dieser fuhr einmal mit seiner Kuh auf den Markt, und weil das Vieh bald so langsam fort trottete wie eine Schnecke, bald mit seinen schwerfälligen Füßen davonlief, daß der Kot aufflog, so ging dem Hansl die Geduld aus, und er brummte und fluchte und fuchtelte mit seinem Stecken herum, daß ihn fast die Gänse ausgelacht hätten. Er hatte noch einen guten Scheibenschuß bis zum Marktplatz, als er an einem Menschen vorbeikam, der eine Geiß feil bot.
Hansl hörte das Angebot und beschloß, schnell einen Handel zu machen, um nur einmal die lästige Kuh ahnig zu werden. »Auch schon auf, guter Freund?« rief er. »Wollen wir etwa einen Tausch machen? Ich wollte mein Kühle da auf den Markt treiben, aber wenn du mir deine Geiß dafür gibst, so brauch' ich mir nicht viel Mühe zu machen, und ich geh' wieder heim.«
Der Angeredete machte zuerst große Augen, dachte sich aber: Eine Kuh für eine Geiß, das kann ich schon tun, schob die Geiß dem Hansl zu und führte dafür die Kuh nach Hause. Hansl fuhr mit der Geiß seiner Heimat zu, und es war ihm zumute wie dem Vogel im Hanf, weil er ein so feines Geißlein für die störrische Kuh eingehandelt hatte.
Aber alles auf der Welt dauert nicht lange, und so war es auch mit der Freude des Hansl. Die Geiß fing an zu meckern, stellte sich dem Hansl gegenüber auf und lief dann auf ihn zu, daß sie ihn fast mit den Hörnern über den Haufen stieß. Dieser Spaß schien dem Tier zu gefallen, und von Zeit zu Zeit bekam Hansl wieder ein paar Püffe.
Das Ding wurde ihm bald zu arg, und wie ihm recht die Galle aufstieg, dachte er auch schon daran, die Geiß auf gute Weise an den Mann zu bringen. Wie gerufen kam eine Bäuerin aus einem am Weg gelegenen Haus, die eine ganze Herde von Schnattergänsen mit einem Stecken vor sich her trieb.
»Guten Morgen, Weibele!« rief Hansl. »Wollen wir einen Tausch machen?«
»Was willst du?« schrie die Bäuerin. »Wenn die Vieher so schreien, daß man sein eigenes Wort nicht versteht!« Hansl ging mit seiner Geiß ganz nahe zur Bäuerin und ließ die Gänse schreien und
pfeifen und aufhüpfen, soviel sie wollten:
»Eine Gans sollst du mir geben für mein Geißlein«, schrie er der Bäuerin ins Ohr, »hast du verstanden?« »Verstanden hab' ich's jetzt wohl«, antwortete die Bäuerin, »aber das kann nicht dein Ernst sein.« »Hand drauf«, sagte Hansl und drückte der Bäuerin recht kräftig die Hand. »Selbst getan, selbst haben«, antwortete die Bäuerin, nahm die Geiß und fing dafür dem Hansl eine Gans.
Hansl ging nun seines Weges weiter, führte die Gans an einem Strick und dachte an die guten Händel, die er heute schon gemacht hatte. Aber die Freude dauerte kaum ein paar Augenblicke, denn die Gans hüpfte und flatterte rechts und links, den geraden Weg aber wollte sie nicht finden. Da fing der Hansl wieder an ungeduldig zu werden, und in seinem Ärger schrie er endlich: »Wäre mir ein Pfifferling lieber als so eine dumme Gans.«
Ein Hennenmädl hatte diese Worte gehört, sprang sogleich aus dem Haus, wickelte Hennenkot in ein Papier und lief dem Hansl damit nach. »Heda, einen Pfifferling habe ich in dem Papier.« »Ach, einen Pfifferling, der wird dir halt um meine Gans nicht feil sein?« »Warum denn nicht? Nur her mit der Gans; da ist der Pfifferling.«
Das Hennenmädl nahm die Gans und lief in das Haus, Hansl nahm den Pfifferling und zog seines Weges weiter. Er glaubte, was er da für ein Wunderding gekriegt habe, und war guter Dinge. Als er an ein schönes, vornehmes Wirtshaus kam, da ließ es ihn nimmer vorbei; er ging hinein und setzte sich ins Herrenzimmer.
Er war noch nicht lange bei seinem Seidel gesessen, da fingen die Herren an herumzuschauen und herumzuriechen, als ob es irgendwo nicht ganz richtig wäre. »Ist etwa der Pfifferling in meiner Tasche schuld?« fragte Hansl auf einmal die Gesellschaft und zog das Wunderding hervor.
Die Herren lachten laut auf, als sie den Pfifferling sahen, und sie merkten sogleich, wie viel Uhr es bei dem Bäuerlein geschlagen hatte. Sie hielten nun den armen Häuter für einen Narren und lockten ihm nach und nach die ganze Geschichte heraus.
Als er ihnen alles Stück für Stück erzählt hatte, riefen sie wie aus einem Munde: »Aber was wird denn dein Weib dazu sagen?« »Oh, meine Alte, die hat gewiß nichts gegen meinen Handel.« »Aber das können wir doch nicht glauben, daß sie dich heute nicht ein wenig filzen wird.« »Glaubt es, oder glaubt es nicht. Ich kenne mein Weibele schon.«
»Willst du wetten, daß es heute Sturm gibt, wenn du nach Hause kommst?«
»Wetten, soviel ihr wollt.« »So wetten wir hundert Gulden. Kriegst du's, wenn du heimkommst, so zahlst du die hundert Gulden, und sonst zahlen wir sie.« »Ganz recht. Hand darauf!«
erwiderte Hansl und reichte jedem der Herren seine rechte Hand.
Er stand dann auf, heimzugehen, und zwei von den Herren mußten ebenfalls mit, um den Empfang bei seinem Weib mit anzusehen. Als Hansl mit den beiden Herren zu seinem Haus kam, fand er die Tür zugesperrt, denn sein Weib war schon in das Bett gegangen. Aber auf seinen ersten Ruf kam sie schon zur Tür und schob den Riegel auf: »Bist du endlich da? Wie hast du das Kühle verkauft?«
Hansl erzählte, wie er um die Kuh eine Geiß eingetauscht habe, und die beiden Herren meinten schon, jetzt werde das Wetter losgehen. »Hast wohl recht getan«, sagte die Bäuerin, »für eine Geiß haben wir doch Futter genug, bei der Kuh aber hatte es immer seine liebe Not. Hast du die Geiß schon eingestellt?«
»Nein, ich habe das ungeschickte Viech ja um eine Gans umgetauscht.« »Oh, wie recht hast du getan, mein Hansl! Wir haben ein leeres Bett im Haus, und jetzt können wir es doch mit Federn füllen. Aber wo hast du denn die Gans?« »Ja - die Gans habe ich freilich nimmer. Aber einen Pfifferling habe ich für sie bekommen.«
»Nichts Besseres hättest du bringen können, Hansl. Heute ging ich zur Nachbarin und wollte von ihr ein bißchen Salz leihen, und denk dir, da schnarrt sie mich an und sagt: 'Du kommst doch um jeden Pfifferling zu mir.' Jetzt braucht sie nichts mehr zu sagen, weil wir selbst einen Pfifferling im Haus haben.«
Die beiden Herren hatten bei diesem Zwiegespräch immer größere Augen gemacht und sahen jetzt wohl, daß die Wette für sie verloren war. Sie zahlten dem Hansl die hundert Gulden und machten sich fein hübsch aus dem Staub.
Gefällt dir das Geschichtlein, Hansele?
»Ja.«
Möchtest du auch ein solcher Hansl sein?
»So dumm möcht' ich nicht sein, aber die hundert Gulden möcht' ich kriegen von den Herren.«
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, bei Rattenberg
WARUM IST DER TOD SO DÜRR? ...
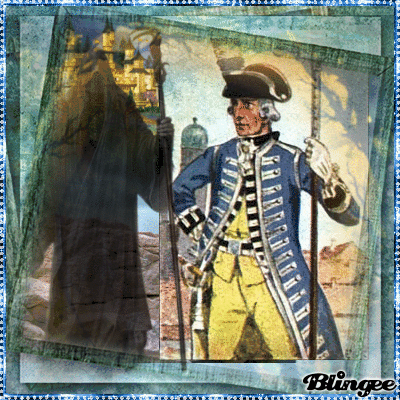
Ein ausgedienter, verabschiedeter Soldat ging einmal durch einen Wald und begegnete zwei Bettelleuten, die ihn um Almosen ansprachen. Der Soldat hatte nichts als sechs Kreuzer in der Tasche, aber weil er mitleidigen Herzens war, reichte er jedem von den Bettlern einen Kreuzer.
Wohlgemut ging er weiter, aber als er einige Scheibenschüsse weit gegangen war, standen schon wieder zwei Bettler am Weg und baten um ein Almosen. Der Soldat ließ sich erweichen und gab jedem von ihnen einen Kreuzer. Dann ging's weiter, aber in kurzer Frist brachten ihn zwei andere Bettler um seine letzten zwei Kreuzer.
Mit leerem Sack setzte er seine Wanderung fort, sah aber bald wieder einen Bettler am Weg stehen, der auf ihn zuging und ihn um Gottes willen um etwas bat. Weil er nichts mehr hatte, konnte er ihm auch nichts geben; allein es war ihm leicht am Gesicht anzusehen, wie weh es ihm tat, einen armen Menschen ohne Gabe von sich zu weisen.
Der Bettler, der wohl auch seinen guten Willen sah, redete ihn aufs neue an und sagte: »Weißt du, wer ich bin?« »Wie sollte ich das wissen? Hab' ich dich doch mein Lebtag nicht gesehen.« »Ich bin der Apostel Paulus, und weil du dich so mildtätigen Herzens gezeigt hast, so ist es dir erlaubt, drei Wünsche zu tun, die ich dir zum Dank erfüllen will.«
Der Soldat machte große Augen und wußte anfangs nicht recht, was er sich denken sollte. Dann aber fing er an zu wünschen und wünschte sich vor allem, nach dem Tod in den Himmel zu kommen. Auch der zweite und dritte Wunsch kostete ihn nicht viel Kopfzerbrechen, er war gleich mit sich selber eins und sagte:
»Zum zweiten wünsche ich mir eine Karte, mit der ich jedes Spiel gewinne, und zum dritten wünsche ich einen Sack, bei dem ich bloß sagen darf: 'Marsch hinein!', um alles darin zu haben, was mir gefällt.«
Der Apostel versprach ihm die ewige Seligkeit und gab ihm die übrigen zwei Stücke ohne Verzug. So wanderte der Soldat wohlgemut weiter und kam bald an ein Wirtshaus. Hier ging er hinein und fand zwei vornehme Herren, die beim Wein saßen und eins diskurrierten. Er setzte sich zu ihnen hin, fing auch mit ihnen zu plaudern an und schlug endlich ein Spielchen vor.
Die Herren waren sehr bereit, und der Soldat zog seine Karten aus der Tasche. Nun ging das Spielen an, aber die Herren mochten aufpassen, wie sie wollten, der Soldat gewann immer und tat doch nicht falsch. Sooft ein Spiel aus war, meinten die beiden, das nächste Mal müßten sie gewinnen. Sie spielten wieder, und richtig gewann es wieder der Soldat. So ging es lange Zeit fort, und der Abschiedler gewann so viel Geld, daß er sich ein Pferd kaufen konnte.
Er ließ die Herren mit langen Gesichtern nachschauen, kaufte dem Wirt einen tüchtigen Gaul ab und ritt weiter. Das taugte ihm schon besser als das langweilige Zufußgehen. Er dünkte sich fast ein General und ritt auch gerade so, wie er es bei seinem Obersten gesehen hatte.
Bis zum Abend des anderen Tages ging es so fort. Da kam er zu einem mächtigen Schloß, und weil ihm das Reiten verleidete, stieg er ab, band sein Roß an eine Ecke und schritt zum Tor hinein. Er ging treppauf, treppab und durch sämtliche Zimmer - aber alles war wie ausgestorben. Er hörte keinen Tritt und sah keinen Menschen, aber das machte ihn nicht irre, denn von Furcht wußte er nicht viel, und er hatte sich einmal in den Kopf gesetzt, hier zu übernachten.
Als es anfing, recht finster zu werden, ging er in ein großes, schönes Zimmer, worin ein Bett aufgerichtet war, und da legte er sich nieder. Weil er müde von der Reise war, brauchte er aufs Einschlafen nicht lange zu warten. Es wurde Mitternacht, da weckte ihn ein fürchterliches Getöse vom Schlaf auf. Er erhob sich im Bett und schaute im Zimmer herum.
Da sah er einen schwarzen Bock, der auf ihn zu lief und zu stoßen anfing. Er besann sich nicht lange und rief: »Marsch hinein!« Der Bock sitzt im Sack, der Soldat aber legt sich aufs rechte Ohr und schläft weiter. Es dauerte eine halbe Stunde, da ging der Lärm aufs neue an, und der Soldat fuhr wieder aus dem Schlaf.
Er setzte sich auf, schaute im Zimmer herum und sah einen Stier, der mit den Hörnern auf ihn losging. »Marsch hinein!« Der Stier fährt in den Sack, der Soldat legt sich auf ein Ohr und schläft wieder. Es dauerte aber wieder nur eine halbe Stunde, und ein neuer Lärm weckte ihn auf. »Was ist doch das für eine Ordnung?« schreit er im Aufwachen und schaut im Zimmer herum.
Er sieht ein Kamel auf das Bett losgehen, aber - »Marsch hinein!« und das Kamel steckt im Sack. Er schlief aber nicht wieder ein, denn alsbald stand eine wunderschöne Jungfrau vor ihm, welche ihm für ihre Rettung dankte. Sie erzählte ihm auch, daß sie von drei Teufeln hier gefangen gehalten wurde, jetzt aber, weil er die Teufel gefangen gesetzt habe, durch ihn befreit worden sei.
Der Soldat hörte ihr aufmerksam zu und hatte eine Freude, daß es nicht zu sagen ist. Er nahm die schöne Jungfrau zur Frau und beschloß, mit ihr in seine Heimat zu gehen, die er schon lange nicht mehr gesehen hatte. Er machte sich bald auf die Reise und freute sich innig, die schöne Frau seinen Verwandten vorzustellen.
Sein Weg führte ihn zufällig zu einer Schmiede. Hier konnte er nicht vorbeigehen, denn die drei Teufel wollte er doch ein wenig abklopfen lassen. Er trat also in die Schmiede und gab dem Meister seinen Sack. »Seid doch so gut und klopft mir für gute Bezahlung die drei Kerle, die drinnenstecken, ordentlich zusammen.«
Der Schmied nahm den größten Hammer, den er nur schwingen konnte, hielt den Sack auf den Amboß und klopfte aus Leibeskräften drauflos. Die Teufel fingen jämmerlich zu schreien an, aber der Schmied hatte keine Ohren. Endlich, als alle drei aus Herzensgrund aufschrien und ein über das andere Mal versprachen, einem Soldaten nie mehr etwas in den Weg zu legen, da ließ sich der Abschiedler erweichen und sagte zum Schmied:
»Jetzt laß es gut sein, sie haben ihr Teil und werden unsereinem nicht ein zweites Mal unter die Hände kommen wollen.« Der Schmied tat, wie er befahl, machte den Ranzen auf, und wie der Wind
fuhren alle drei Teufel zur Öffnung heraus.
Der Soldat bezahlte den Schmied für die Arbeit und verfolgte seinen Weg weiter.
Nach wenigen Tagen kam er in der Heimat an. Da war große Freude über seine glückliche Wiederkehr, und die Tage vergingen je lustiger, desto schneller.
Der Soldat fing nach und nach an, sein Alter zu spüren, und der Gedanke, daß ihn der Tod bald abholen werde, fiel ihm schwer auf die Seele. Es dauerte auch nimmer lange, da erschien der Tod
wirklich und wollte ihn holen.
Er besann sich aber zur rechten Zeit und rief: »Marsch hinein!« Der Tod flog in den Sack, und den Soldaten plagte keine Sorge mehr. Den Sack hängte er an dem Ofen auf und ließ ihn da sieben Jahre lang hängen. Als das siebente Jahr vorbei war, da kam der Apostel Paulus zum Soldaten und sagte: »Warum hältst du den Tod so lange gefangen? Sieben volle Jahre hast du ihn schon eingesperrt, und sieben Jahre hat kein Mensch sterben können!«
Der Soldat tat dem Heiligen seinen Willen und ließ den Tod frei. Darauf starb er und fuhr auf in den Himmel. Weißt du jetzt, warum der Tod so dürr ist? Wenn er sieben Jahre lang am Ofen gedörrt worden ist, wirst du dich doch nimmer darüber verwundern.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, bei Rattenberg
DIE SCHLANGE ...
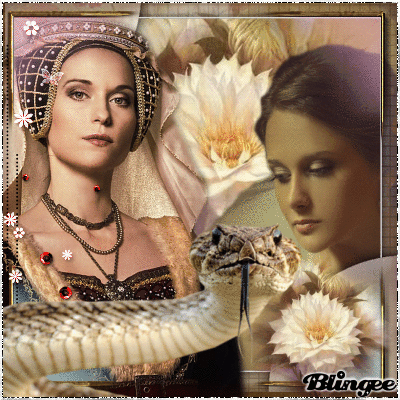
Vor alter Zeit, da noch das Schloß auf dem Hügel droben stand, lebte darin ein Graf mit seiner Hausfrau. Sie hatten Güter in Hülle und Fülle und hätten das glücklichste Paar sein können, wenn ihnen nicht ein Kind und der häusliche Friede gefehlt hätten. Vom frühesten Morgen bis spätabends zankten und haderten Graf und Gräfin, und er hieß seine Frau nie anders als die hale Schlange.
So war es viele lange Jahre gegangen, und der Graf war noch schlimmer als je, bis seine Frau endlich wider Erwarten in die Hoffnung kam. Da wurde der schlimme Herr freundlicher und freute sich ob des künftigen Erben. So ging es viele Wochen lang fort, und man meinte, es sei der Friede für immer in das Schloß eingekehrt, da wurde es schlimmer als je; denn die Gräfin wurde, als die Wehen vorüber waren, einer Schlange entbunden.
Als sich der Graf in seiner süßen Hoffnung so bitter getäuscht sah, war er erboster als jemals. Er tobte und wütete wie ein wildes Tier, schalt seine Frau eine böse Hexe, die mit dem Teufel im Bund stehe, und wollte die Schlange ohne weiteres töten.
Da bat die Gräfin so lange und so innig, daß er ihr Kind am Leben lasse, damit sie wenigstens sehe, was daraus werde, bis er endlich nachgab und die Schlange nicht tötete. Er blieb aber seitdem immer böse und kümmerte sich weder um Weib noch um Kind und ging seine Wege.
Die Gräfin hatte aber die Schlange so lieb, als ob es der schönste Knabe wäre, und stand Tag und Nacht an der Wiege. Der Wurm aber wuchs und wuchs, und die Gräfin hatte ihn noch lieber und pflegte ihn wie ihr eigenes Kind. So ging es zwanzig Jahre hindurch, und die Schlange war noch nie aus ihrer Kammer gekommen.
Als sie zwanzig Jahre alt geworden war und die Gräfin eines Abends bei ihr in der Kammer saß, öffnete die Schlange plötzlich ihr Maul und fing zu sprechen an.
»Liebe Frau Mutter«, sprach sie, »ich bin nun zwanzig Jahre alt und möchte heiraten; deshalb bitte ich Euch, daß Ihr mir eine Braut verschafft.«
Die Gräfin war nicht wenig erstaunt, als sie ihr Kind sprechen hörte, und noch mehr über das, was es gesprochen hatte. Sie versprach ihm, seinen Wunsch zu erfüllen, und suchte für ihre Schlange eine Braut. Allein das war ein schweres Kuppeln, denn es mochte ein Mädchen noch so heiratslustig sein, so wollte sie von einer solchen Versorgung nichts wissen.
Die Schlange aber wiederholte tagtäglich ihre Bitte, und die Gräfin sah sich immer ängstlicher um eine Braut für ihr Kind um, konnte aber keine auftreiben.
Da kam ihr das Hennenmädl, das ein gar liebes, folgsames Kind war, in den Sinn, und sie dachte, dieses werde gewiß darauf eingehen und es für ein Glück schätzen, wenn sie Frau Gräfin werden
könne.
Darin hatte sich aber die Frau Mutter verrechnet, denn das Hennenmädl wollte, als ihr der Antrag gestellt wurde, ganz und gar nichts davon wissen. Das Mädchen meinte, es werde, wenn es brav sei, wohl auch sonst durch die Welt kommen und es könnte die Schlange doch nicht gerne haben. Es wolle lieber ein armes Hennenmädl bleiben und schwarzes Brot essen, als an der Seite eines so unheimlichen Tieres das reichste Leben führen.
Wie die Gräfin dieses hörte, wurde sie böse auf das arme Mädchen und sprach: »Wenn du dein Glück verschmähst, werde ich schon eine andere finden.«
Das dauerte aber seine Zeit, und die Gräfin mußte überall, wo sie für ihr Kind warb, mit langer Nase abziehen. Als sie dies sah, wandte sie sich wieder an das liebe, fromme Hennenmädl und gab ihm
viele schöne, süße Worte.
»Sei doch nicht so dumm und steh nicht selbst deinem Glück im Weg«, redete sie ihr zu. »Wenn du mein Kind heiratest, wirst du Gräfin und bist für dein Lebtag aufgehoben. Was hast du denn, wenn du so bleibst, für Aussichten? Du mußt die Hennen füttern und bleibst die geringste Magd, während dir, wenn du meinem Rat folgst, Ehre und Reichtum lachen.«
So bedrängte sie die Gräfin und sprach ihr zu, daß es dem armen Kind im Kopf wie ein Mühlrad hin und her ging und es nicht wußte, was es tun sollte. Die Gräfin drang, wie sie die Ratlosigkeit des Mädels sah, noch heftiger auf das Kind ein, bis es endlich, um die Gnädige loszuwerden und sich sammeln zu können, drei Tage Zeit verlangte, um darüber nachzudenken. Die Gräfin war damit zufrieden und verließ das Kind.
Am folgenden Tag kam sie aber schon wieder und fragte um den Entschluß und sprach dem Mädchen zu. So machte sie es auch am zweiten. Da wußte sich das Kind nicht zu helfen und dachte: Wenn mir der Himmel nicht guten Rat gibt, weiß ich nicht, was zu tun ist. Wenn ich die Schlange nicht heirate, dann habe ich keine Ruhe mehr, denn die Frau ist gar so aufdringlich; und sie zu heiraten habe ich auch keine Lust.
In diesen Zweifeln ging es hinauf in den Gang des Schlosses, wo in einer Ecke ein gar schönes Muttergottesbild stand. Das fromme Mädchen hatte dazu eine besondere Andacht und hatte in verschiedenen Anliegen schon oft Erleichterung dabei gefunden. Sooft es daran vorbeiging, sprach es deshalb ein Ave-Maria, und dann fühlte es sich besser und wohler.
Es kniete sich diesmal vor der Muttergottes nieder und betete recht andächtig um Rat, was in diesem Fall zu tun sei. Als das Mädchen schon lange gebetet hatte und es meinte, es müßte die Muttergottes ein Ja winken oder ein Nein schütteln, fing das wunderbare Bild auf einmal zu sprechen an und sagte:
»Dein Gebet ist erhört; heirate der Gräfin Kind, denn du bist berufen, es zu erlösen. Es ist wegen des sündhaften Lebens seiner Eltern zwar eine Schlange, du kannst ihm aber die menschliche Gestalt geben.
So höre denn! Wenn du in der Hochzeitsnacht bei der Schlange allein in der Brautkammer sein wirst, wird sie sagen: 'Zieh dich aus!' Da mußt du erwidern: 'Zieh du dich zuerst aus!', und die Schlange wird sich einmal häuten. Dann wird sie wieder sagen: 'Zieh dich aus!', und dann mußt du wieder entgegnen: 'Zieh du dich zuerst aus!' Die Schlange wird sich dann wieder häuten. So muß es siebenmal geschehen, und wenn du zum siebenten Mal gesagt haben wirst: 'Zieh du dich zuerst aus!', wird die Schlange die siebente Haut abstreifen, und der Grafensohn wird erlöst sein und als schöner Jüngling vor dir stehen.«
Das Bild hatte es gesprochen und verstummte. Ein Stein war vom Herzen des bedrängten Mädchens genommen, und es fühlte sich nun leicht und beruhigt. Es dankte dem Himmel für seine Hilfe und ging dann zur Gräfin und sagte ihr, daß es die Schlange heiraten wolle.
Da war diese hocherfreut und nannte das Hennenmädchen ihre liebe Tochter und koste es; dann ging sie mit ihm zu ihrem Kind und führte ihm die Braut vor. Weil aber die Gräfin fürchtete, es könnte das Mädchen seinen Sinn wieder ändern, wollte sie am nämlichen Tag noch das Paar getraut sehen. Sie hieß deshalb die Braut sich festlich putzen und gab ihr Schmuck und Kleider.
Als diese sich gewaschen, gekleidet und geschmückt hatte und wieder in das Zimmer getreten war, ließ die Gräfin den Geistlichen holen, der das Paar traute. Da war die Gräfin froher Dinge und wünschte dem Brautpaar Glück. Die Schlange zeigte sich auch munter, und die Braut liebkoste sie, daß man sich darüber wundern mußte.
Indessen war es Abend geworden, und am Himmel zogen die Sterne herauf. Da nahm die Gräfin von ihren Kindern Abschied und ließ sie allein. Als die Schlange sich mit ihrer Braut allein im Zimmer sah, sprach sie: »Zieh dich aus!« Da erwiderte die Braut: »Zieh du dich zuerst aus!«
Die Schlange schien über diese Antwort froh zu sein und schälte sich alsogleich eine Haut ab. Dann sprach sie wieder: »Zieh dich aus!« Die Braut entgegnete: »Zieh du dich zuerst aus!«, und die Schlange zog wieder eine Haut aus. Dann sprach sie wieder: »Zieh dich aus«; die Braut antwortete aber wieder, wie die ersten beiden Male.
So geschah es siebenmal, und als die Braut zum siebenten Male gesprochen hatte: »Zieh du dich zuerst aus!«, da zog die Schlange die siebente und letzte Haut ab, und siehe - anstatt der Schlange stand ein so wunderschöner Jüngling vor ihr, daß sie nie einen schöneren Ritter gesehen hatte.
Er flog auf sie zu, umarmte und herzte sie und nannte sie seine liebe, liebe Braut und seine Erlöserin. Dann bestiegen sie das hohe Brautbett und schliefen selig, bis der Morgen graute und es im Schloßhof laut wurde.
Als der Tag angebrochen war und das schöne Paar aus der Kammer trat, stand die Gräfin schon an der Tür; denn sie war sehr neugierig, wie die Brautnacht vorüber gegangen sei. Wie groß war da ihr Staunen, als sie anstatt der häßlichen Schlange den schönsten Mann sah! Sie wollte anfangs kaum ihren Augen trauen.
Als der schöne Ritter sie aber Mutter nannte und ihre Hand küßte, da sah sie ein, daß er wirklich ihr umgewandelter Sohn war, und kannte keine Grenzen der Freude. Es wurde nun die Hochzeit gefeiert, bei der es so laut und lustig zuging wie im ewigen Leben. Doch dauerte das Glück nicht immer. Wenn die alte Gräfin ihren Sohn betrachtete und sah, wie schön er war, da schien ihr, er sei für das Hennenmädel schade, und sie beneidete ihre Schwiegertochter um ihren Mann.
Sie wurde immer verstimmter und neidischer, so daß sie ihrem Sohn zuredete, er solle seine Gemahlin verstoßen. Der junge Graf aber, der seine Frau zärtlich liebte, hatte keine Ohren für die Ratschläge seiner Mutter und blieb seiner Frau treu. Als die alte Gräfin ihn wieder bedrängte und durchaus bewegen wollte, seine Frau zu verstoßen, sprach er: »Meiner Gattin verdanke ich meine Erlösung, und deshalb werde ich ihr immer dankbar und treu bleiben.«
Seit dieser Rede sah die Gräfin ein, daß ihre Ratschläge umsonst waren, und gab sich zufrieden. Das junge Ehepaar lebte noch lange, lange Zeit recht glücklich.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Absam
DER STINKKÄFER ...
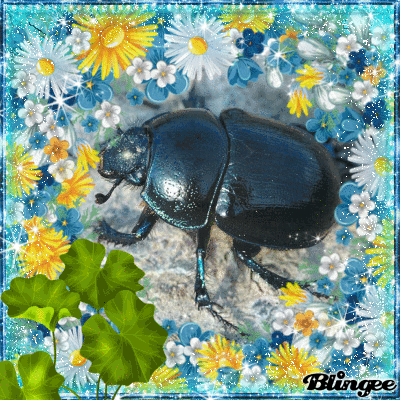
Vor langer, langer Zeit lebte ein armer Knabe, der eine böse Stiefmutter hatte. Sie war ihm so feindlich gesinnt, daß er ihr nichts recht machen konnte und alle Tage Scheltworte und Schläge bekam.
Einmal gab sie dem guten, armen Kind einen großen Korb und sprach: »Mach dich, kleiner Darm, gleich in den Wald hinaus und suche Moosbeeren, und bringst du den Korb nicht voll zurück, so sollst du Schläge bekommen, daß dir die Rippen krachen.«
Der arme Bursche nahm den Korb und lief mit weinenden Augen in den grünen Wald hinaus, denn er sah wohl, daß er, wenn er zehn Hände statt einer hätte, so viele Moosbeeren nicht pflücken könnte, und fürchtete sich vor den gedrohten Schlägen gar sehr.
Im Wald kroch er von einer Staude zur anderen und pflückte nach Leibeskräften. Allein er sah nur immer deutlicher, daß er den Korb nicht werde voll machen können. Er hatte schon einige Stunden gearbeitet, und die Sonne brannte gar heiß nieder. Da fing der Knabe an schläfrig zu werden vor lauter Hunger und Müdigkeit.
Er sank ermattet in das Moos und begann zu schlafen, daß es eine Lust war. Die Sonne wollte schon Abschied nehmen, als der Knabe seine Augen aufschlug und mit Schrecken sah, daß es schon Abend war. Um wie viel größer war aber sein Schrecken, als ein winziges Männlein in einem grünen Röcklein vor ihm stand und ihm mit seinen kleinen, stechenden Augen fest und steif ins Gesicht schaute.
Als der Zwerg den Knaben so erschrocken sah, redete er ihm freundlich zu und fragte ihn, was er hier mache. »Ja, ich muß hier Moosbeeren pflücken, den ganzen Korb voll«, erwiderte stotternd der Knabe, »und wenn er nicht voll wird, bekomme ich Schläge, denn die Mutter ist gar so streng zu mir.«
»Sei getröstet«, sprach das Männlein und fing an, Moosbeeren zu pflücken, daß der Korb im Augenblick voll war. Dann gab er dem Knaben ein Schächtelchen mit den Worten: »Du bist ein braver Bub; bleibe so, und es soll dir nichts Übles zustoßen. Nimm das Schächtelchen, doch öffne es erst in der größten Not, wenn du sonst keinen Ausweg mehr siehst, und es wird dir geholfen werden.«
Der Knabe versprach es dem alten Männlein, griff freudig nach dem Schächtelchen und dankte dafür, wie brave Kinder es tun. Kaum war dies geschehen, so war das Waldmännlein auch verschwunden. Der arme Bursche steckte das Schächtelchen behutsam ein, nahm den vollen Korb auf den Rücken und wanderte froher als je seiner väterlichen Hütte zu, denn er hatte ja einen Helfer in seiner Tasche.
Als er müde und vom Schweiß triefend heimkam, stand seine böse Stiefmutter schon auf der Türschwelle und wollte ihn mit Scheltworten empfangen. Wie sie aber den vollen Korb sah, bekam sie Respekt vor dem Buben und machte ein süßes Gesicht.
Seit diesem Tage quälte sie den Knaben nicht mehr so sehr und gab ihm oft freundliche Worte. In der Tat haßte sie das arme Kind doch wie früher und wartete nur auf eine günstige Gelegenheit, ihn loszuwerden. Der Knabe hatte nun glückliche Tage und sah wohl oft, wenn er allein war, das Schächtelchen an, öffnete es aber nie, denn er hatte es ja dem Männchen versprochen, und Hilfe war ihm auch gerade nicht nötig. So ging es einige Wochen.
Da kam einmal ein unbekannter Mann ins Dorf, und dieser hatte ein wunderliches Pfeiflein. Wenn er damit pfiff, mußten ihm alle Kinder, die nicht gesegnet waren, nachlaufen, und niemand konnte sie mehr von dem geheimnisvollen Pfeifer befreien.
Wie der Hansl das Pfeiflein hörte, schoß es ihm auch in die Füße, daß er mitlaufen mußte, denn die böse Mutter hatte ihn absichtlich nie gesegnet. Der Mann ging pfeifend voraus, ein großer, großer Haufen ungesegneter Kinder folgte ihm. Der Zug ging durch das Dorf dem Wald zu, wo ein kahler, grauer Berg aufragte.
Als sie dort angekommen waren, tat der Mann einen lauten Pfiff, und der hohle Berg öffnete sich. Die armen Kinder mußten in den finsteren Schacht hinein, und hinter ihnen schloß sich polternd die Öffnung des Felsens.
Da hättest du die armen Kinder sehen sollen! Von aller Welt verlassen befanden sie sich im stockfinsteren Berggewölbe, wohin nie ein Sonnenstrahl drang, und wußten nicht, was mit ihnen geschehen würde. Sie weinten und jammerten, daß es ein steinernes Herz hätte rühren mögen; doch alles war umsonst.
So ging es drei Tage und drei Nächte, und Hansl weinte und klagte mit den übrigen Kindern. Am vierten Tag fiel ihm endlich ein, daß er ja das Schächtelchen noch ungeöffnet bei sich habe und daß
ihm dieses vielleicht helfen könnte.
Gedacht, getan! Mit der größten Vorsicht nahm er das Geschenk des Zwergleins aus seinem Sack und öffnete es behutsam.
Wie fühlte er sich aber in seinen Erwartungen getäuscht, als er bemerkte, daß ein ganz gewöhnlicher Stinkkäfer daraus hervor kroch, der endlich summend und brummend aufflog und bald da, bald dort surrend anprallte. So war er längere Zeit herum gesurrt, als er sich auf den Boden niederließ, die Erde aufwühlte und endlich ein kleines, kleines Schlüsselein fand, das er dem Hansl brachte.
Dieser war darüber nicht wenig erfreut, nahm das Schlüsselchen und tastete an allen Ecken und Wänden herum, um ein Schlüsselloch zu finden. Er hatte wohl schon lange herumgesucht, als er endlich ein klein winziges Schlößlein fand, in das der Schlüssel gerade paßte.
Er steckte ihn an, drehte ihn herum, und es sprang eine bisher nicht bemerkte Pforte auf. Welche Freude hatten da die armen Kinder, als das goldene Tageslicht in den hohlen Berg fiel und sie einen Ausgang sahen. Froh und munter eilten sie der Tür zu und ins Freie.
Da war aber eine ihnen ganz unbekannte Gegend, die sich durch Schönheit und Anmut auszeichnete, fette Wiesen und kühle Wäldchen mit riesigen Eichen und Buchen, und zwischendurch rieselten und murmelten spiegelklare Bächlein. Die schönsten Blumen hoben ihre bunten, duftenden Kelche empor, und die prachtvollsten Schmetterlinge flatterten durch die laue, würzige Luft.
Die Kinder kannten nun kein Ende der Freude, und das eine lief dahin, das andere dorthin. Hansl, der seinen Stinkkäfer wieder in das Schächtelchen gesteckt hatte, ging allein auf einem Steig, der sich durch ein Wäldchen schlängelte, fort und dachte nach, was er nun anfangen sollte, denn er hatte wenig Lust, wieder nach Hause zurückzukehren.
Als er eine gute Strecke gegangen war, sah er plötzlich ein großes, prächtiges Schloß vor sich stehen. Es ragte mit seinen Türmen und Zinnen hoch über die riesigen Bäume empor, die es umgaben. Um das Gebäude zog sich ein herrlicher Garten mit grünen, stolzen Bäumen, leuchtenden Blumen und rauschenden Springbrunnen.
Hansl konnte sich lange nicht an all dieser Pracht und Herrlichkeit satt sehen. Als er alles lange Zeit angegafft hatte, dachte er sich, ich muß doch schauen, wie es drinnen ausschaut. Er suchte nun einen Eingang, aber all sein Suchen war vergebens, denn nirgends fand er eine Tür oder ein Gitter.
Er ging noch einmal um das Schloß herum und konnte gar nicht begreifen, wie man ein Haus ohne Aus- und Eingang bauen konnte. Wie er so da stand und schaute, hörte er plötzlich eine Stimme rufen: »Wenn du den Schlüssel findest, gehören dir Schloß und Hof.«
Da war der Junge nicht verlegen und nahm zu seinem Schächtelchen Zuflucht. Der Käfer wurde losgelassen, und das kluge Tierlein flog und surrte herum, bis es sich endlich auf dem Boden niederließ, die Erde aufgrub und dort einen goldenen Schlüssel fand.
Hansl war über diesen Fund nicht wenig erfreut und suchte nun am Turm hin und her, bis er das Schlüsselloch sah. Da steckte er lustig den Schlüssel an, drehte ihn herum, und im Nu war das Tor offen. Da hättest du dabei sein und all die Pracht und Herrlichkeit im Schloß sehen sollen. Und da gab's einen Jubel und eine Freude, daß dem Hansl Sehen und Hören verging.
Als er so da stand und vor Staunen nicht zu sich kommen konnte, kam ein alter König auf ihn zu, und dieser führte eine wunderschöne Prinzessin an seiner Hand. Der alte König umarmte den Hansl und dankte ihm für seine Erlösung und die Erlösung seiner Tochter und seiner Leute.
Dann bot er ihm seine Tochter zur Frau und das reiche Königreich zur Erbschaft an. Da besann sich Hansl nicht lange, ging darauf ein, und es wurde noch am selben Tag Hochzeit gehalten. Der König aber war kein anderer als der Stinkkäfer, in den er von einer bösen Hexe verwandelt worden war.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Absam
DER FÜRPASS ...

Einmal sind auch ein Mandl und ein Weibele gewesen, die nichts gehabt haben als die Not und jeden Kreuzer haben anschauen müssen. Das Leben ist ihnen nie verleidet, und der Mann hat oft zum Weib gesagt: »Wir sind zufrieden, und was braucht's mehr?«
Einmal hat der Mann fortgehen müssen, und davor hat er dem Weib aufgetragen, recht zu sparen und etwas für den Fürpaß zu behalten. »Ist schon recht«, hat das Weib gesagt, »sparen will ich schon, daß mir die Rippen krachen, und für den Fürpaß will ich schon etwas aufbehalten.«
Der Mann ist also abgereist und hat alles seinem Weib überlassen. Das Weib hat gespart und gerackert wie alle Wetter und hat immer an den Fürpaß gedacht.
Einmal ist nun ein Bettelmann ins Haus gekommen und hat zur Bäuerin gesagt: »O Bäuerin, ich bitt' Euch, könnt Ihr mir nicht ein Bröcklein Speck schenken?«
»Nein«, hat die Bäuerin gesagt, »ich kann jetzt nichts hergeben. Mein Mann ist weit fort, und ich muß alles für den Fürpaß aufsparen.«
»Das ist eben recht«, hat das Bettelmandl gemeint, »dann gebt nur mir den Speck. Ich bin ja selber der Fürpaß.« »Ja dann«, hat die Bäuerin gesagt, »ist's freilich etwas anderes«, und hat ihm die ganze Seite Speck geschenkt, die sie noch gehabt hat. Das Bettelmandl ist mit dem Speck durchgegangen, und die Bäuerin hat gemeint, daß jetzt alles in Ordnung sei.
Wie aber ihr Mann heimgekommen ist, hat die Sache ein anderes Gesicht bekommen. »Hast du fleißig gespart?« hat er zuerst gefragt. »Ja, alles hab' ich für den Fürpaß aufgespart.« »Und wo
sind denn nachher die Sachen?« »Ja, du hast gesagt, ich soll für den Fürpaß sparen. Und dem Fürpaß hab' ich alles gegeben.«
»Was für einem Fürpaß denn?« »Der zu mir gekommen ist, die Sachen abzuholen.« »Was für einer ist zu dir gekommen?«
»Ja, daß ich's kurz sag', es ist ein Bettelmandl ins Haus gekommen, und wie ich ihm gesagt habe, ich könne ihm nichts geben und müsse alles für den Fürpaß behalten, so hat er gesagt, der Fürpaß sei er selber, ihm soll ich alles geben.«
Da ist der Mann zornig geworden und hat räsoniert und gesagt: »Du dummes Weib, wirst du denn in alle Ewigkeit nimmer gescheit? Ich habe gemeint, für die Zukunft sollst du etwas aufbehalten, damit wir nicht darben müssen, wenn wir alt sind. Verstehst du mich jetzt? Das ist doch zum Fußausreißen, nichts für den Fürpaß in der Hütte haben und noch dazu einen solchen Kürbis von einem Weib erhalten zu müssen!«
So hat er fortgeschimpft, bis ihm fast der Atem ausgegangen ist, und hat sich halt gesorgt und gekümmert um die Zukunft, als wenn er gerade am Verhungern gewesen wäre. Da ist ihm auf einmal in den Kopf geschossen, es könnte das Gescheiteste sein, seine einzige Kuh zu verkaufen und so für den Fürpaß zu sorgen. Dann ist er in den Stall gegangen, hat die Kuh abgelöst und ist damit auf den Markt gefahren.
Lange Zeit ist er mit seiner Kuh auf dem Markt gestanden und hat alle Leute angeschrien, ob sie ihm nicht die Kuh abkaufen wollten. Aber die Leute sind alle vorbeigegangen und haben ihn bei seiner Kuh stehen gelassen. Endlich ist einer mit einem Esel gekommen und hat zu ihm gesagt: »Wenn du mir deine Kuh gibst, so geb' ich dir dafür meinen Esel.«
»Was nützt mich der Esel?« hat der Bauer gesagt. »Wenn ich dann für den Fürpaß nichts habe, behalt' ich lieber die Kuh.« »Aber weißt du, was der Esel kann? Der Esel kann Geld furzen, und wenn du Geld hast, braucht dich der Fürpaß nimmer verzagt zu machen.«
Da hat sich der Bauer gedacht: Wenn das Ding so ist, dann muß ich den Esel freilich nehmen, und hat dem Händler seine Kuh dafür gegeben. Nachher ist er mit dem Esel heimgefahren und hat sich schon gefreut, den Esel einmal furzen zu lassen.
Unterwegs aber ist er zu einem Wirtshaus gekommen, und weil es schon angefangen hat finster zu werden, ist er dort über Nacht geblieben. In dem Wirtshaus sind aber lauter Hexen gewesen, und die haben dem Bauern so schön getan und ihn so auszufragen gewußt, daß er ihnen nach und nach alles erzählt hat, warum er auf dem Weg sei, wie er gehandelt habe und was für eine wunderbare Eigenschaft sein Esel habe.
Da haben die Hexen nicht lange Spaß gemacht, haben ihm seinen Esel genommen und einen anderen dafür in den Stall getan. Am anderen Tag hat der Bauer den Esel aus dem Stall geholt und ist wieder weiter gegangen. Wie er heimgekommen ist, hat er schon von weitem seinem Weib zugerufen: »Schau her, was ich bring'! Das ist ein Esel, der Geld furzt.« »Auch recht«, hat das Weib gesagt. »Einen solchen Esel kriegt man nicht alle Tage.«
Sie sind nun miteinander in den Stall gegangen, haben einen Stecken genommen und haben den Esel Geld furzen machen wollen. Der Esel aber hat sich nicht gerührt und kein Gran Geld gefurzt. Da ist das Weib zornig geworden, hat angefangen, den Mann zu schimpfen und hat gesagt:
»So dumm wie du hab' ich doch nicht getan. Jetzt gehst du gar mit der guten Milchkuh auf den Markt und gibst sie für einen alten Esel her, von dem wir nichts haben, als daß wir ihn füttern müssen. Hättest du besser gleich die Kuh verschenkt, du Narr!«
So hat sie ihn lange Zeit herabgewürdigt und hat ihm alle »Titel« gegeben, die sie nur gewußt hat. Der Bauer hat sich das gefallen lassen müssen und ist ganz niedergeschlagen gewesen. Aber dann ist er wieder fortgegangen und hat den Menschen gesucht, der ihm den Esel angehängt hat. Wie er zu dem gekommen ist, hat er gesagt:
»Du Betrüger, du nichtsnutziger, schau, daß du mir meine Kuh wiedergibst, sonst werd' ich dich schon kriegen. Du hast gesagt, daß dein Esel Geld furzt, und das ist erstunken und erlogen.« Der Mensch hat sich nicht lang schimpfen lassen und hat gesagt:
»Wenn du lästern willst, so geh in das Wirtshaus, wo sie dir den Esel ausgetauscht haben, und leere dort dein Maul aus. Ich habe dir schon einen Esel gegeben, der das Geldfurzen kann. Aber weil du wirklich um den Esel gekommen bist, will ich dir jetzt eine Henne geben, die statt der Eier Gold legt. Schau aber, daß es dir nicht wieder geht wie mit dem Esel, und geh nimmer in das Wirtshaus hinein.«
Der Bauer hat die Henne genommen und hat gesagt: »Nein, das Wirtshaus sieht mich gewiß nimmer.« Aber gesagt ist's bald. Wie er wieder zu dem Wirtshaus gekommen ist, ist die Kellnerin an der Tür gestanden und hat ihm allerhand vorgemacht, daß er hungrig sein müsse und jetzt etwas zu essen brauche und daß es heut so lustig sei im Wirtshaus und - weiß ich, was alles? Kurzum, sie hat so lange geredet, bis es ihn endlich hinein gerissen hat.
Wie er in der Stube drinnen gesessen ist, haben sich die Hexen wieder hergesetzt und ihn so lange ausgefragt, bis er halt endlich erzählt hat, wer ihm die Henne gegeben und was für eine wunderbare Eigenschaft sie an sich habe. Jetzt haben ihm die Hexen wieder bei Nacht seine Henne mit einer anderen vertauscht.
Am anderen Morgen hat er sich mit seiner Henne auf den Weg gemacht und hat sich lange auf das Goldlegen gefreut. Wie er heimgekommen ist, hat er seinem Weib schon von weitem zugeschrien: »Weib,
heute bring' ich etwas Rechtes.«
»Was bringst du denn?« »Ich bring' eine Henne, die nicht Eier legt wie die anderen Hennen, sondern lauter Geld.«
Dann ist er in die Stube hineingegangen und hat gewartet, bis die Henne gelegt hat. Aber wie sie geschaut haben, ist nur ein Ei da gewesen und kein bißchen Geld. Da hat das Weib noch viel ärger aufbegehrt als das erste Mal und hat gewettert, daß dem Mann lange Zeit die Ohren gesummt haben. Es ist ihm freilich weniger um das Geschrei der Alten gewesen als um die Henne, die sie ihm im Wirtshaus vertauscht haben.
Wie er sich nicht hat zu raten und zu helfen gewußt, ist ihm endlich wieder eingefallen, zum Händler zu gehen und zu schauen, ob der ihm nicht helfen könne. Er hat sich also wieder auf den Weg gemacht und hat den Händler aufgesucht.
Wie er ihn gefunden hat, hat er zu ihm gesagt: »Oh, mein lieber Mensch, im Wirtshaus haben sie mir schon wieder die Henne ausgetauscht, und jetzt ist halt alles verloren, was ich gehabt habe.
Schau, könntest du mir gar nimmer helfen?«
»Wenn du bei dem Wirtshaus nicht vorbeigehen kannst, dann ist dir nimmer zu helfen«, hat der Händler gesagt. Der Bauer hat aber darauf bestanden, daß er in das verhexte Wirtshaus gewiß
nimmer hineingehen wolle.
»Wenn du mir das versprichst«, hat der Händler gesagt, »nachher will ich dir jetzt ein Tischlein geben. Wenn du dazu sagst: 'Tischlein, richte dich!', so werden allemal darauf die herrlichsten Speisen angerichtet sein.« Dann hat er ihm das Tischlein gegeben, und der Bauer ist völlig aufgehüpft vor lauter Freude und ist wieder heimzu gegangen.
Jetzt, hat er sich gedacht, habe ich doch noch das Beste. Hätt' ich Geld in Hülle und Fülle gehabt, so hätt' ich doch immer die Speisen erst einkaufen müssen. So aber habe ich keine Mühe und mein Weib keine, und wir können uns gerade zum gerichteten Tisch setzen.«
So hat er allerhand simuliert und ist unterdessen wieder zu dem Hexenwirtshaus gekommen. Die Kellnerin ist akkurat wieder auf der Schwelle gestanden und hat den Bauern angeredet. Er aber hat sie nicht beachtet und ist seinen Weg weitergegangen.
Jetzt ist die Kellnerin zu ihm heraus gekommen und hat gar so süß geredet und ihm so verhext schön getan, bis er endlich sein Versprechen vergessen hat und mit ihr ins Haus hinein gegangen ist. Da hat er ihr auch noch von seinem Tischlein erzählt, woher er es habe und was für eine wunderbare Eigenschaft es besitze.
Wie die Hexen von dem Tischlein gehört haben, ist ihnen sogleich die Lust darnach gekommen, und sie haben es ihm wieder mit einem anderen vertauscht.
Wie er am anderen Morgen fortgegangen ist, hat er das falsche Tischlein zu sich gepackt und ist daheim wieder recht übel angekommen.
Kaum hat er sein Weib gesehen, so hat er angefangen zu erzählen von dem wunderbaren Tischlein und was für ein herrliches Leben sie jetzt haben werden. Die Alte aber hat ihm nichts geglaubt und hat gesagt: »Zeig mir nur einmal, was das Tischlein kann. Ich glaube nichts, bevor ich's nicht sehe.«
»Wirst schon glauben müssen«, hat der Mann gesagt, sein Tischlein hingestellt und gesagt: »Tischlein, richte dich!« Das Tischlein ist aber ruhig geblieben und hat sich nicht gerichtet. Jetzt ist das Wetter wieder los gebrochen. Geschimpft und gelästert hat die Bäuerin noch viel ärger als die ersten beiden Male, und der Bauer hat sich geschämt wie nie zuvor.
Er hat kein anderes Mittel gewußt, als wieder zu dem Händler zu gehen und ihn noch einmal um Hilfe zu bitten. Hart ist ihm das freilich angekommen, aber es war ihm doch lieber als nichts zu besitzen.
Wie er zum Händler hin gekommen ist, hat er ihm wieder seine Not geklagt und ihn wieder gebeten, er möchte ihm aus der Klemme helfen. Der Händler ist ein guter Kerl gewesen und hat gesagt: »Weil du's bist, will ich dir halt noch einmal helfen. Ich gebe dir jetzt ein Stück, womit du alle anderen zurückbekommen kannst, wenn du nur willst.
Sieh, da hast du einen Hammer, der heißt Schlegele-tummel-dich, und sooft du ihn beim Namen nennst, wird er jeden tüchtig durchhämmern, dem du etliche Prügel auf den Rücken wünschst.« Da hättest du hören sollen, wie der Mann gedankt hat für das Schlegele-tummel-dich und wie lustig er gesungen und gepfiffen hat auf dem Heimweg.
Er ist aber nicht lange gegangen, da hat ihn schon wieder die Kellnerin vom Hexenwirtshaus gepackt und ihm zugeredet, ein bißchen einzukehren. Diesmal hat er schleunig gefolgt, ist mit ihr in die Wirtsstube hineingegangen und hat gesagt: »Schlegele, tummel dich!« Da ist der Hammer herausgesprungen, hat zuerst die Kellnerin und dann den anderen Hexen die Köpfe tüchtig abgetrommelt, und der Bauer hat zugeschaut und gelacht.
Die Hexen haben freilich gejammert und um Hilfe geschrien, aber der Bauer hat gesagt: »Wenn ihr mir meine drei Stücke nicht zurückgebt, so werde ich euch mausetot schlagen lassen.« Die Hexen haben gleich versprochen, alles zurückzugeben, und der Hammer hat mit seiner Arbeit aufgehört. Richtig hat der Bauer von den Hexen den Esel, die Henne und das Tischlein bekommen und ist dann lustig nach Hause gegangen.
Wie ihm sein Weib begegnet ist, hat er geschrien: »Ja Alte, sei lustig, jetzt hab' ich alles bekommen, den Esel, der Geld furzt, die Henne, die Gold legt, und das Tischlein-richte-dich und noch dazu ein Schlegele- tummel-dich.«
Das Weib hat hellauf zu lachen angefangen und hat gesagt: »Du wohl, du Dummkopf, hast noch allemal etwas Sauberes heimgebracht. Wird diesmal schon auch etwas Rechtes sein.« Da ist dem Mann der Zorn aufgestiegen, und er hat gerufen: »Schlegele, tummel dich!«
Der Hammer ist sogleich auf das Weib hin geschossen und hat ihr den Kopf zusammen gedroschen, daß ihr ganz elend war. Wie der Mann geglaubt hat, daß es genug ist, hat er den Hammer wieder aufhören lassen, und seitdem ist die Alte friedlich und fügsam gewesen ihr Lebtag. Daß sie bei dem Goldesel, der Goldhenne, dem Tischlein-richte-dich und dem Schlegele-tummel-dich ein gutes Leben gehabt haben, das kannst du dir denken.
Jetzt erzähl' ich dir aber heut kein Geschichtlein mehr.
»O wohl, erzähl noch eins.«
Nein, heut keins mehr.
Jetzt aber sei still!
Sonst kommt der Putz von der Dill.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DER ESEL ...

Vor uralter Zeit war bei einem Grafen auf einem Schloß ein gar braves, stilles Mädchen im Dienst. Sie diente ihrer Herrschaft treu und redlich und lebte in Zucht und Sittsamkeit. Dies und ihre Schönheit gewannen ihr die Herzen aller, und die Gräfin liebte das Mädchen fast wie ihr eigenes Kind.
So lebte es schon manches Jahr auf dem Schloß vergnügt und glücklich, als ihr plötzlich ein unliebsames Ereignis die Ruhe störte. Es trug sich nämlich zu, daß sich in einer Nacht etwas, sie wußte nicht was, zu ihr in das Bett legte; es war ihr da ganz unheimlich zumute, und dies um so mehr, als sie auf ihre Fragen nie eine Antwort erhielt.
Es schien ihr, als ob der unheimliche Schalk, bevor er in das Bett stieg, etwas Schweres auf den Boden geworfen hätte, denn es hatte einen starken Klatsch getan. Das Mädchen konnte vor Angst und Furcht nicht schlafen und zitterte wie Espenlaub. Morgens, als es Ave-Maria läutete, verschwand das unheimliche Wesen.
Was sich in dieser Nacht zugetragen hatte, wiederholte sich von nun an in den folgenden Nächten, und das Mädchen konnte vor Furcht nicht mehr schlafen und sah gar blaß und traurig aus. Das merkte die Gräfin, und sie fragte die Magd, was ihr fehle. Da faßte sich das Mädchen ein Herz und erzählte ihrer Gebieterin haarklein, wie in jeder Nacht ein unbekanntes Ding komme und zu ihr ins Bett steige.
Als die Gräfin dies gehört hatte, sprach sie: »Sei getrost, mein Kind! Ich werde dir ein Steinchen geben, und wenn du da durchschaust, wirst du die Gestalt des unheimlichen Wesens, das deine Ruhe stört, sehen.« Nach diesen Worten ging sie zu einem Kästchen, langte einen glänzenden Karfunkel heraus und gab ihn dem Mädchen mit freundlicher Miene.
Die Gräfin dachte aber im Herzen, wenn du meinen verwunschenen Stiefsohn durch diesen Zauberstein anschaust, dann ist er aufs neue verzaubert und kann erst nach sieben Jahren wieder erlöst werden. Die Magd nahm den Karfunkel mit Dank an und versprach, ihn nach dem Rat der Gebieterin zu gebrauchen.
Als es wieder Nacht wurde und die Magd im Bett lag, kam wieder der unheimliche Besuch. Es klatschte etwas zu Boden, und dann stieg etwas in das Bett und legte sich neben die Magd. Diese hatte den Karfunkel und beobachtete damit das, was in das Bett gestiegen war. Sie staunte nicht wenig, als der schönste Jüngling neben ihr lag.
Er hatte lange, blonde Haare, und sein Gesicht war rot und weiß wie Milch und Blut. Kaum hatte sie aber angefangen, ihn zu betrachten, so fuhr er sie an: »Was hast du, verfluchte Hexe, mir getan! Jetzt muß ich wieder meine Eselshaut nehmen und an den Ort der Verwünschung zurückkehren, bis mich jemand erlöst.« Mit diesen Worten sprang er aus dem Bett, nahm die auf dem Boden liegende Eselshaut, hüllte sich in diese und verschwand in Eselsgestalt.
Die Magd hatte keinen Frieden mehr und konnte die ganze Nacht hindurch keine Viertelstunde schlafen. Beim ersten Hahnenschrei verließ sie ihr Bett, ging in die Kirche und klagte dem heiligen Georg ihre Not. Als sie auf das Schloß zurückgekehrt war und die Gräfin zu ihr kam und sie fragte, wie es in der Nacht gegangen wäre, erzählte sie ihr alles und fragte die Frau, wie der arme Esel erlöst werden könnte.
Die Gräfin wollte auf diese Frage keine Antwort geben und meinte, man sollte den Esel Esel sein lassen. Dem Mädchen kam aber der Esel nicht mehr aus dem Kopf, und es dachte bei Tag und bei Nacht daran. Da hörte es einmal, daß in dem Wald ein alter Einsiedler wohne, der ebenso durch Frömmigkeit wie durch Weisheit berühmt sei.
Bald hatte es sich entschlossen zu dem ehrwürdigen Mann seine Zuflucht zu nehmen, und an einem Feiertag ging es in den grünen Wald hinaus, um den Einsiedler aufzusuchen. Als es schon eine gute Strecke im Wald gegangen war, kam es endlich zur Klausnerhütte, vor der der Einsiedler saß.
Er hatte einen langen, weißen Bart und trug eine grobe, braune Kutte. Das Mädchen ging auf ihn zu, küßte ihm die Hand und teilte ihm ihr Anliegen mit. Als der Greis es gehört hatte, sprach er: »Mein liebes Kind, da kann ich dir nicht helfen. Geh aber noch eine Viertelstunde weiter, und dann wirst du wieder einen Waldbruder finden, der kann dir vielleicht in deiner Not guten Rat geben.«
Das Mädchen war mit dem Bescheid zufrieden, dankte dem frommen Alten und ging weiter in den Wald hinein, um den anderen Einsiedler auch zu sehen. Als sie eine Viertelstunde durch die hohen Tannen und die breit ästigen Buchen gegangen war, kam sie endlich zur zweiten Klausnerhütte, vor der der Einsiedler saß.
Er hatte einen noch längeren weißen Bart als der erste und sah noch ehrwürdiger aus. Das Mädchen ging auf ihn zu, küßte ihm die Hand und teilte ihm ihr Anliegen mit. Als der Greis es gehört hatte, sprach auch er: »Mein gutes Kind, da kann ich dir nicht raten. Geh aber noch eine Viertelstunde weiter, und dann wirst du wieder einen Waldbruder finden, der kann dir vielleicht in deiner Not guten Rat geben.«
Die Magd war mit dem Bescheid zufrieden, dankte dem frommen Alten und ging weiter in den Wald hinein, um den dritten Einsiedler aufzusuchen. Der Wald wurde immer dichter, und kein Weg führte durch die eng aneinander stehenden Buchen. Sie ließ sich aber dies nicht verdrießen und ging in gerader Richtung vorwärts.
Als sie eine Viertelstunde gegangen war, kam sie zur dritten Klausnerhütte, und davor saß der Einsiedler. Dieser war uralt und sah aus wie ein Waldmann. Sein Bart reichte ihm bis an die Füße, und seine Augenbrauen wölbten sich hoch und dicht. Das Mädchen ging auf ihn zu, küßte ihm die Hand und teilte ihm ihr Anliegen mit.
Als der Greis dies gehört hatte, sprach er mit tiefer Stimme: »Mein gutes Kind, da kann ich dir guten Rat geben. Eine halbe Stunde von hier liegt ein Teich, in dem alle Verwünschten sich aufhalten müssen. Geh du hin, und du wirst den Esel und noch viele andere, die dorthin verbannt sind, erlösen können. Um dies zu tun, brauchst du nur die verschiedenartigen Felle, die am Ufer liegen, schnell in den See zu werfen.«
Der greise Waldbruder zeigte der Magd dann den Weg, den sie nehmen sollte, und gab ihr seinen Segen. Sie war über diesen Rat hoch erfreut, dankte ihm und küßte ihm die Hand. Dann ging sie in der vom Einsiedler gezeigten Richtung vorwärts. Das war ein harter Weg.
Es ging durch dick und dünn, über Stock und Stein. Als das Mädchen so eine halbe Stunde sich vorwärts gearbeitet hatte, fing der Wald an lichter zu werden, bald stand es im Freien, und ein großer, blauer See lag vor seinen Füßen. Am Ufer lagen viele, viele Felle von verschiedenen Tieren. Sie sah sich ein bißchen um, und als sie die Eselshaut erblickt hatte, ergriff sie diese sogleich und warf sie in den See, und so machte sie es mit den übrigen Fellen, bis sie damit fertig war.
Sooft sie aber ein Fell in das Wasser geworfen hatte, tauchte ein erlöster Mann oder eine erlöste Frau auf und stieg an das Ufer. Als kein Fell mehr vorhanden und alle Verwünschten erlöst waren, trat der schöne Jüngling, den sie einst durch den Karfunkel gesehen hatte, an der Spitze der übrigen Erlösten zur Magd, verneigte sich vor ihr und dankte ihr für die Rettung in seinem und der anderen Namen.
Er erzählte ihr, wie er durch seine böse Mutter, die Gräfin, in einen Esel verwandelt worden war. Als er ihr alles erzählt hatte, fragte er sie, ob sie seine Frau werden wollte. Das Mädchen nahm den Antrag gerne an, und nachdem sie aus dem Wald zurückgekehrt waren, wurde die Hochzeit mit aller Pracht gefeiert.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Gnadenwald bei Absam
DAS KASERMÄNNLEIN ...
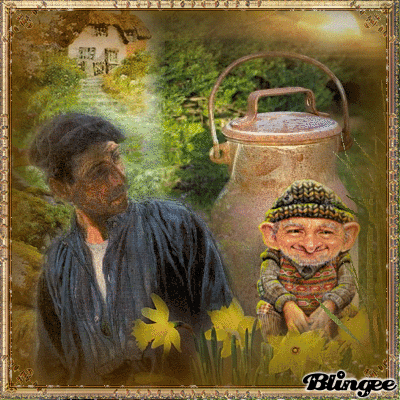
In alter Zeit ging einmal ein Bauernknecht auf das Bergmahd, um Heu herabzuholen. Auf dem Weg dahin kam er an einer Sennhütte vorbei, die leer stand. In diese schrie er mutwillig hinein: »Kasermandl, wenn ich zurückkomme, mußt du mir Buttermilch geben!«, und ging seinen Weg weiter.
Der Bursche war bald auf dem Heumahd droben, besorgte lustig und froh seine Arbeit und dachte nicht mehr an seinen Scherz. Als er nach vollbrachter Arbeit nach Hause zurückkehrte, dunkelte es schon. Er beschleunigte deshalb seine Schritte, um nicht auf dem Weg von der Nacht überfallen zu werden.
Wie er aber zur Kaserhütte kam, sprang plötzlich ein kleines, mageres Männchen heraus, das einen großen Kübel voll Buttermilch trug. Der kleine Knirps hielt ihn auf und sprach: »Du hast heute beim Vorbeigehen von mir Buttermilch verlangt, da hast du sie nun. Jetzt trink sie bis auf den letzten Tropfen aus, sonst wird es dir nicht gut gehen.«
Mit diesen Worten gab er dem zitternden Knecht das Gefäß und blieb stumm und unbeweglich wie eine Bildsäule vor ihm stehen. Der Knecht wußte sich nicht zu raten und zu helfen, denn es war augenfällig, daß er so viel Milch nicht austrinken konnte. Endlich fing er an zu trinken und trank, daß er zu bersten drohte.
Als er aber sah, daß er nicht mehr trinken könne und daß das Gefäß beinahe noch voll war, nahm er all seinen Mut zusammen und sagte zum Kasermännlein: »Für heute habe ich genug Milch getrunken. Die übrige werde ich nach Hause nehmen und sie dort trinken. Ich werde gewiß keinen Tropfen im Kübel lassen.«
Als das Männlein diese Rede gehört hatte, sprach es mit freundlichem Ernst: »Sei froh, daß du diese Ausflucht gefunden hast. Dies war das einzige Mittel, dich zu retten.« Und warnend setzte es bei: »Sei in Zukunft nicht mehr so leichtsinnig und mutwillig, du müßtest dafür büßen.«
Mit diesen Worten war der Kasergeist verschwunden. Der Knecht kehrte gewitzigt nach Hause, wohin er auch die Buttermilch schaffte, und erlaubte sich nie mehr einen ähnlichen Spaß.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Sellrain
EICHHÖRNCHEN, KÄFER, MAUS ...

Es lebte einmal ein reicher, mächtiger König; dieser hatte nur eine wunderschöne Tochter, die aber so ernst und so traurig war, daß sie noch nie in ihrem Leben gelacht hatte.
Da der König gerne einen Eidam und Nachfolger im Reich gehabt hätte, so fragte er seine Tochter, ob sie nicht heiraten wollte. »O ja«, war ihre Antwort, »aber nur jenen Jüngling, der mich zum Lachen bringt, damit ich Hoffnung habe, frohe Tage mit ihm zu verleben. Alle jene Freier aber, die dies nicht können, sollen sterben.«
Dies sagte sie, weil sie gerne frei geblieben wäre; denn sie hoffte, dadurch jeden Bewerber zurückzuschrecken. Der König suchte ihr diese grausame Bedingung auszureden, aber sein Bemühen war umsonst, so daß er den Entschluß seiner Tochter endlich bekanntmachte.
Kaum war dies geschehen, so strömten von nah und fern die Söhne der edelsten Ritter, Fürsten und Könige herbei, um die Hand der Königstochter samt dem Königreich zu erwerben. Ein jeder hoffte, durch verschiedene Streiche die ernsthafte Jungfrau zum Lachen zu bringen. Aber alles war vergebens; je mehr erschienen, desto mehr ließen unter dem Beil des Scharfrichters ihr Leben, bis es endlich ganz still und ruhig wurde, denn keiner wollte die gefährliche Probe nachmachen.
Da hörte in einem fernen Winkel des Reiches auch ein Bauer von der Bekanntmachung des Königs und erzählte das Ganze beim Essen. Er und die Seinigen lachten nach Herzenslust über die Torheit jener, die wegen einer schönen Jungfrau das Leben lassen wollten; der Bauer bemerkte aber nicht, daß jemand nicht seiner Meinung war. Dies war sein Sohn Hansl, ein rechter Tölpel, der nicht recht reden gelernt und nur zu wenigen Stücken zu brauchen war, weil er alles verkehrt machte.
Als dieser von der schönen Königstochter hörte und daß derjenige sie heiraten könnte, der sie zum Lachen brächte, ging ihm auf einmal ein Licht auf, und er dachte: Das muß ja mir am besten gelingen, weil ich andere Leute lachen machen kann, wenn ich nur will.
Nach dem Essen sagte er deshalb zum Vater: »Ich will es versuchen, ob ich nicht die Königstochter zum Lachen bringe und dann zum Weib erhalte.« Der Vater wollte ihm diesen Plan ausreden; denn so dumm auch Hansl war, so hatte er ihn doch so gern, weil er sein einziges Kind war; aber alles war umsonst. Dem Hansl lag die Königstochter so im Sinn, daß er darüber sogar erkrankte.
Da sagte endlich der Vater zu ihm: »Wenn ich dich nicht gehen lasse, so stirbst du mir doch, deshalb kannst du gehen, wann du willst, und die Königstochter erobern oder sterben, denn zur Arbeit bist du doch nicht mehr zu brauchen.« Bei diesen Worten sprang Hansl freudig aus dem Bett und war plötzlich gesund; er richtete seinen Schnappsack zurecht, schnitt sich einen Stock ab und machte sich noch am selben Tag auf, um die Königstochter zu erwerben.
Sein Weg führte ihn durch einen großen, großen Wald. Da hörte er auf einmal eine wunderschöne Musik; er lugte lange umher, bis er endlich auf dem Wipfel eines Baumes ein Eichhörnchen erblickte, das eine Flöte blies. Er wußte anfangs gar nicht, wie er etwa das liebe Tierlein fangen könnte. Nach langem hin und her Denken kletterte er endlich ganz leise den Baum hinan, ergriff das Eichhörnchen beim Schweif, zog es mit sich herab und steckte es dann samt der Flöte in den Schnappsack. Dann ging er fröhlich weiter.
Wenn ihm unheimlich war, so ließ er das Eichhörnchen, das er an ein Schnürlein angebunden hatte, aus dem Sack heraus spazieren, teilte mit ihm sein Stücklein Brot, und dafür blies es ihm die herrlichsten Stücke vor. Auf der Wanderung kam Hansl endlich aus dem Wald auf eine breite Straße. Da hörte er von Ferne ein Hackbrett so schön klingen, wie er es zu Hause noch nie gehört hatte; er wunderte sich darob, weil er keinen Menschen sah.
Nach langem Herumblicken und Suchen gewahrte er endlich einen großen Käfer, der auf einem Brett herum hüpfte, so daß es einen allerliebsten Ton gab. Er erhaschte den Käfer und schob ihn samt dem Brett in den Sack zum Eichhörnchen. Froh und munter setzte er seinen Weg fort, denn er hoffte, bald die Stadt zu erreichen. Er kam durch schöne Felder und Wiesen.
Wie er so dahin schlenderte, da klang ein gar wunderbarer Ton an sein Ohr; so was hatte er noch nie gehört. Neugierig blickte er nach allen Seiten herum und sah endlich unter einem Baum eine Maus, die auf einer Maultrommel spielte. Nach langem Jagen und Springen erhaschte er sie endlich, und sie mußte samt ihrem Instrument zu den anderen beiden Genossen in den Sack spazieren, wo sie sich um die Wette mit dem Eichhörnchen um die letzten Brotkrumen des Hansl stritt.
Nach einigen Tagen kam er in der Königsstadt an. Er fragte sogleich nach dem König und dessen Tochter und klopfte dann mit aller Gewalt an die Tore der Burg. Wie der Pförtner sein Anliegen hörte, wollte er ihm schnell die Tür weisen; aber Hansl ließ nicht nach mit Lärmen und Bitten, bis ihn der Pförtner meldete. Sogleich durfte Hansl erscheinen.
Wie er mit seinem Schnappsack in den Saal trat, wo ihn die Königstochter mit ihrem Vater und dem ganzen Hofstaat erwartete, wäre er auf dem glatten Boden bald gefallen; er nahm aber ohne alle Umstände den Stock vom Rücken, leerte den Inhalt auf den Boden und ließ seine lieben Tierlein musizieren, während er selbst die sonderbarsten Gesichter und Sprünge machte.
Diese Erscheinung war so neu, Hansl gebärdete sich so toll, daß die sonst so finstere Prinzessin sich des Lachens nicht enthalten konnte. Wie dies der König sah, erschrak er sehr. Erzürnt ließ er den Hansl in den Kerker werfen, und in wenigen Tagen wollte er ihn töten; nur die drei unschuldigen Tierlein ließ man ihm.
Die Königstochter hatte aber eine große Liebe für den Hansl und verlangte ihn zum Gemahl; sie hoffte, daß er bei einigem Unterricht schon recht werden würde. Der König schlug ihr die Bitte aber immer ab. Er wolle einen Prinzen, nicht einen Bauernburschen zum Eidam, war die gewöhnliche Antwort.
Da wurde sie traurig, und noch am selben Tag mußte sie sich zu Bett legen und wurde ernsthaft krank. Wie sie so einsam und klagend im Bett saß und an ihren lieben, lustigen Hansl dachte, erschien dessen Maus mit einem Zettelchen, worauf geschrieben stand, ob sie ihn wohl liebe; wenn nicht, so müsse er sterben, denn nur sie könne ihn retten.
Die Königstochter war darüber sehr erfreut und schrieb auf die andere Seite des Zettelchens, das sie der Maus um den Hals band: »Ich liebe nur dich allein, und ohne dich muß ich sterben.« Hansl war bei dieser Nachricht sehr erfreut und hoffte auf ein gutes Ende.
Die Königstochter wurde aber täglich schlechter und schlechter, weil ihr der Vater die Bitte immer abschlug. Alle Ärzte gaben sie auf, und die ganze Stadt wurde traurig, denn alle liebten sie sehr. Als nun eines Tages der Kerkermeister dem Hansl die Speise brachte, fragte ihn dieser, warum er so traurig und in der Stadt alles so ruhig sei.
»Ja«, sagte dieser, »die Tochter des Königs wird bald sterben.« Da sprach Hansl: »Sag zum König, daß ich ein Kraut weiß, von dem die Tochter gewiß gesunden wird.« Der König ließ den Hansl also gleich kommen, und die kranke Prinzessin wurde schnell gesund.
Wie dies der König sah, willigte er endlich in die Bitte seines Kindes; er gab dem Hansl einen Lehrer und ließ ihm nach wenigen Wochen seine Tochter zur Gemahlin. Unter großem Jubel feierten beide die Hochzeit.
Nachdem sich Hansl in seine neue Rolle hinein gearbeitet hatte, beschlich ihn die Sehnsucht, seine Eltern zu besuchen und ihnen die Schwiegertochter zu zeigen. Er machte seiner Gemahlin diesen Vorschlag. Freudig ging sie darauf ein, und schnell wurden Anstalten zur Reise getroffen.
Von einer zahlreichen Dienerschaft begleitet, kamen sie im väterlichen Dorf an. Hier ließ er die Gemahlin mit der Dienerschaft bleiben. Er selbst zog seine alte Bauernkleidung an und eilte der Heimat zu, nachdem er gesagt hatte, was er tun werde und was sie tun sollte.
Die Eltern waren hoch erfreut, als sie den Sohn erblickten, und lachten in einem fort, als er ihnen erzählte, wie er in die Stadt gekommen war, dort durch seine Tierlein die Königstochter zum Lachen gebracht hatte, wie man ihm aber die Braut und die Tierlein mit vielem Geld und schönen Worten abgeschwatzt hatte.
Als er aber sagte, daß er das Geld, das gar so schwer gewesen war, für zwei Striezel einem Bäcker gegeben hatte, damit er auf dem Weg nicht verhungere, da schalten sie ihn den einen Tölpel hin, den anderen her.
Nicht lang danach, während die Mutter noch fort donnerte, kam die Königstochter wie verabredet vorgefahren. Sie sagte zu den erstaunten Leuten, daß sie gekommen sei, die Eltern des Hansl zu besuchen, der sie lachen gemacht hatte, und sie wolle auch hier zu Mittag speisen, Hansl solle bald erscheinen.
Als Hansl hörte, daß man ihn verlange, bat er die Mutter in einem fort, daß er doch die Speisen hineintragen dürfe, um alles zu sehen. Die Mutter gestattete ihm endlich, die Knödel aufzutragen. Wie er nun behutsam trippelnd zur Türschwelle gelangte, stolperte er, und die Knödel rollten auf dem Boden herum und zu den Füßen der Königstochter hin.
Diese lachte hellauf. Hansl kroch zwar emsig auf dem Boden herum, sammelte die Knödel wieder ein und legte sie auf den Tisch; aber seine Mutter zerrte ihn fort und sperrte ihn in den Schweinestall, damit er in Gegenwart so hoher Gäste keine Dummheit mehr anstellen könnte.
Nach dem Essen besah die Königstochter die ganze Wirtschaft; wie sie aber in die Nähe der Ställe kam, da polterte und stürmte Hansl, daß es ein Greuel war. Auf die Erkundigung, was denn so herumpoltere, sagte die Bäuerin, daß es ein wildes Schwein sei; man dürfe aber nicht einmal die Tür öffnen.
Auf der Königstochter Verlangen jedoch öffnete man, und es stürzte zum Erstaunen aller Hansl heraus und eilte auf Umwegen dem Wirtshaus zu. Dort kleidete er sich um und fuhr in der Kutsche vor das Haus seiner Eltern. Die Königstochter ging ihm entgegen und stellte den Bauersleuten in ihrem Gemahl den Hansl vor, der vor kurzem die Knödel auf den Boden geworfen hatte.
Nachdem die guten Leute vor Verwunderung kaum zu Atem gekommen waren, erzählte ihnen die Königstochter, wie Hansl ihr Gemahl geworden war. Da fand die Freude der Bauersleute kein Ende, und die Mutter des Hansl ging in die Küche und kochte, daß es eine Art war. Dann wurde gegessen und getrunken.
Abends fuhren dann alle mit Hansl und der Königstochter in die Stadt, wo sie gar glückliche Tage verlebten.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
DIE DRUDE ...
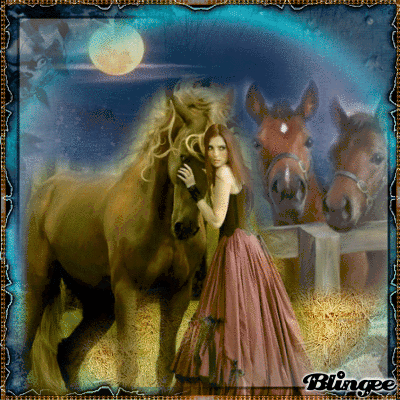
Es war einmal ein steinreicher Herr, und dieser hatte eine absonderliche Magd. Sie ging jede Nacht aus und kam oft erst am frühen Morgen zurück, weil sie eine Drude (Druckgeist) war und einen großen Trieb in sich fühlte, andere zu drücken. Um dies zu tun, schlich sie in dunkler Nacht in die Schlafzimmer und drückte die Schläfer so, daß sie nicht mehr imstande waren, sich zu bewegen.
Dies nächtliche Ausgehen blieb dem Herrn nicht lange geheim, er ließ die Magd vor sich kommen und fragte sie, warum sie nachts immer fortgehe. Sie solle es nur offen eingestehen, denn eine Lüge würde ihr doch nichts nützen.
Da nahm sich die Magd kein Blatt vor den Mund, gestand alles offen ein und sprach: »Haben Sie Erbarmen mit mir, gnädiger Herr! Ich gehe nicht aus freier Wahl zur Nachtzeit aus, sondern weil ich muß. Denn ich wurde in einer unglücklichen Stunde geboren und bin deshalb eine Drude. Es drängt und treibt mich, etwas Lebendiges zu drücken, und mir kann nicht geholfen werden, bevor ich nicht etwas Lebendiges tot drücken darf.«
Als der Herr dies hörte, hatte er Mitleid mit der aufrichtigen Magd und sprach: »Wenn dir so geholfen werden kann, dann sei getrost. Du sollst geheilt werden. Du kannst mein bestes Pferd, das ich im Stall habe, erdrücken.« Die Magd war mit dieser Erlaubnis sehr zufrieden und dankte für die Gnade. In der folgenden Nacht ging sie wirklich in den Stall und kam erst morgens wieder zurück. Man fand das Pferd tot im Stall, sie aber war von ihrem Drang erlöst.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Reutte
DER BAUERNBURSCHE ...

Ein Bauernbursche ging an einem Sonntagabend von seiner Heimat weg, um zu einem Mädchen heimgarten zu gehen. Er hatte ziemlich weit bis zum Haus des Mädchens, und sein Weg führte ihn über einen Bach und dann durch einen pechfinsteren Wald.
Da stand mitten zwischen den riesigen Bäumen eine Kapelle, und dort erblickte der Bursche einen großmächtigen Kerl, den er nicht kannte. Er glaubte aber, daß er in der gleichen Absicht dieses Weges sei, wie er selbst. Er redete ihn an, und sie hatten noch nicht viele Worte gewechselt, da ging es ans Streiten. Vom Streiten kam es zum Raufen, und der Bauernbursche mußte sich lange Zeit mit dem Fremden herumbalgen, bis er ihn endlich zu Boden warf. Da kam es ihm vor, als wenn er einen Kohlsack niedergeworfen hätte.
Der Unbekannte, der unter ihm auf dem Boden lag, erhob seine Stimme und sagte: »Laß mich sogleich auf, oder ich zerreiße dich wie Sonnenstäubchen.«
Da merkte der Bursche, mit wem er es zu tun hatte, ließ den Kerl auf und machte sich aus dem Staub. Als er nach Hause kam, merkte er erst, daß er die Sohlen so durch gerannt hatte, daß die
Stiefelröhren bis zu den Knien herauf geschoben worden waren.
Er ging sogleich zum Vater in die Kammer, weckte ihn auf und erzählte, wie es ihm ergangen war. Der Vater richtete sich im Bett auf, hörte sich seine Erzählung an und gab ihm dann einen tüchtigen Verweis, wie es sich für einen vernünftigen Vater gehört.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DIE VERWUNSCHENE PRINZESSIN ...

Es ist schon lange her, da hatte einmal ein mächtiger Kaiser eine Heerschau angeordnet. Die Soldaten mußten von nah und fern zusammen kommen und sich auf einem weiten Feld in zwei Reihen aufstellen. Da ritt nun der Kaiser mit seiner goldenen Krone auf dem Haupt mitten durch und besah sich die Krieger.
Unter anderen bemerkte er einen sehr alten Veteranen, dessen Haare schon schneeweiß waren. Der Kaiser hielt bei ihm an und fragte ihn: »Wie lange hast du schon gedient?« »Vierzig Jahre, Herr
Kaiser«, erwiderte ehrerbietig der Alte.
»Gut«, sprach der Kaiser, »du hast deine Zeit nun voll und sollst der Mühen nun enthoben sein. Stelle dich morgen um neun Uhr im Audienzsaal.«
Nach diesen Worten ritt der Kaiser wieder weiter und erblickte einen wunderschönen, noch blutjungen Mann, der mutig dreinschaute. Er hielt bei ihm an und fragte ihn: »Wie viele Dienstjahre zählst du?« Der Jüngling trat ehrerbietig vor und antwortete etwas verlegen: »Nur zwei, Eure Majestät. Ich habe aber doch auch den letzten Krieg mitgemacht, und mein Mut hat mich nicht verlassen.«
Der Kaiser fand Wohlgefallen an dem schönen, mutigen Burschen und sprach: »Du scheinst ein braver Mann zu sein. Stelle auch du dich morgen um neun Uhr im Audienzsaal.« Der Kaiser ritt wiederum weiter und bemerkte bald einen greisen Veteranen, den er fragte: »Wie lange dienst du bei der Armee?«
Der alte Krieger antwortete: »Achtundvierzig Jahre, Herr Kaiser. Ich habe in dieser Zeit viele Kriege mitgemacht und manche Wunde davon getragen. So hat mir in der letzten Schlacht so ein Türkenhund eine Kugel ins Bein gejagt, die mir noch oft Schmerzen macht. Aber der Kerl mußte es teuer bezahlen, denn er wurde gleich darauf von unseren Kugeln zu Boden gestreckt.«
Dem Kaiser gefiel der alte Mann, der noch so feurig erzählte. »Stelle dich morgen um neun Uhr im Audienzsaal«, sprach der Fürst, ritt weiter und musterte die übrigen Soldaten.
Am anderen Tag putzten sich die drei beorderten Soldaten aufs beste heraus und stellten sich Schlag neun Uhr im kaiserlichen Audienzsaal. Sie wurden vom Kaiser sehr freundlich empfangen, und dann sprach er zu ihnen: »Ihr habt euch wacker gehalten und verdient einen Lohn. Weil ihr eure Pflicht so treu erfüllt habt, enthebe ich euch der ferneren Kriegspflicht und will euch würdig beschenken.
Zwischen zwei Dingen könnt ihr wählen, entweder könnt ihr hier bleiben und hier eure lebenslängliche Versorgung haben, oder ihr könnt weiter ziehen, und wenn ihr dies tun wollt, so werde ich jedem von euch eintausend Gulden zum Abschied geben.«
Als die drei diesen Vorschlag gehört hatten, wurde ihnen die Wahl nicht sauer. Einstimmig baten sie um die tausend Gulden und wollten in die Weite wandern. Der Kaiser ließ, als er dies sah, sogleich den Reichskassier holen und befahl ihm, jedem der drei Soldaten eintausend Gulden auf der Stelle auszubezahlen.
Die drei empfingen sogleich ihr Geld und zogen, nachdem sie dem Kaiser mit gerührtem Herzen gedankt hatten, miteinander fort. Sie waren noch nicht weit gewandert, als sie in einen großen, dunklen Wald kamen, durch den eine Straße führte. Ehe sie noch das Ende des Waldes erreichten, überfiel sie die Nacht, und sie mußten unter den Bäumen ihr Lager halten.
Am folgenden Tag kamen sie endlich ins Freie, und eine wunderschöne Gegend lag vor ihnen ausgebreitet. Am Ausgang des Waldes prangte auf einem Wiesenhügel ein herrliches Schloß, an dessen Fuß ein freundliches Dorf sich hinzog.
»Seht da das Schloß! Gehen wir doch hinauf, um es anzusehen«, sprach da der junge Soldat. »Was werden wir da droben tun?« entgegneten die zwei alten.
»Wir haben Hunger und Durst und gehen lieber ins Dorf und suchen dort eine Schenke.« Gesagt, getan! Sie lenkten ihre Schritte dem Dorf zu, während der junge Bursche den Weg zum Schloß
nahm.
Bald stand er vor dem großen Tor, das weit geöffnet war. Als er sah, daß kein Wächter da war und daß sich keine lebende Seele im Hof zeigte, trat er mutig ein und stieg die marmorne Treppe hinauf. Er kam dann auf einen Gang, aber auch da zeigte sich kein lebendes Wesen. Endlich gelangte er in einen herrlichen Saal, in dem eine große Tafel stand, auf der die kostbarsten Speisen dufteten. In der Mitte war aber ein großer leerer Teller.
Er sah sich noch einmal um, ob sich nirgends jemand zeige, und da er sich allein glaubte, setzte er sich nieder und aß von all den Gerichten nach Herzenslust, bis er satt war. Als er noch dasaß
und sich gütlich tat, klopfte es plötzlich an die Tür.
»Herein!« rief der Bursche aus Leibeskräften.
Da öffnete sich die Tür, und eine Schlange kroch herein und auf den Tisch hinauf, wo sie im leeren Teller Platz nahm und sich zusammenrollte. Obwohl dem jungen Soldaten Furcht fremd war, gruselte es ihn doch ein wenig, als er mit der unheimlichen Schlange ganz allein im weiten Saal war. Sein Staunen und seine Furcht wurden noch größer, als die Schlange plötzlich zu reden begann.
»Fürchte dich nicht«, sprach sie, »und tue, was ich dir sage. Wenn du meinen Worten folgst, kannst du sehr glücklich werden. Ich bin eine verwunschene Prinzessin. Du kannst mich erlösen, wenn du nur willst, und dann bin ich mit allen meinen Schätzen dein. Sag mir also, ob du alles, woran meine Erlösung geknüpft ist, tun willst.«
Da besann sich der Soldat nicht lange und sprach: »Potz Hagel und Donnerwetter! Ich habe dem Tod so oft in den Rachen geschaut, darum werden mich diese Dinge auch nicht erschrecken!« Da sprach die Schlange: »Gut, so höre deine Aufgaben.
Es werden drei Nächte nacheinander um die zwölfte Stunde viele, viele Soldaten mit ihrem König ins Schloß kommen. Sie werden dich an allen Ecken und Enden des Schlosses suchen, bis sie dich finden. Dann wirst du vor den König geführt werden, der alles mögliche aufbieten wird, um von dir eine Antwort heraus zu kriegen. Du mußt dich aber nicht bewegen lassen, auch nur ein Wort zu sprechen.
Fasse nur Mut und bleibe trotz aller Versprechungen und Drohungen stumm wie ein Fisch; denn wenn du nur eine Silbe sprichst, sind wir beide verloren. Du wirst mißhandelt und gemartert werden, laß dir aber dadurch kein Wort entlocken. Mögen sie dich auch noch so quälen, am folgenden Morgen wirst du dich besser befinden als früher, und alle diese Martern werden dir zum besten gereichen.
In der dritten Nacht werden sie dir sogar den Kopf abschlagen, aber am folgenden Morgen wirst du frisch und gesund sein. Wenn du im Schweigen ausharrst, wirst du mich erlösen und uns beide glücklich machen.« Mit diesen Worten war die Schlange verschwunden.
Der Soldat dachte über die wunderbare Geschichte nach und faßte, da er sein Herz nicht in den Hosen hatte, sogleich den Entschluß, die Schlange zu erlösen. Er blieb deshalb mutig am Tisch sitzen, aß und trank, und als ihm die Zeit zu lang wurde, zündete er ein Licht an und las in einem Buch, das auf einem Tisch lag. So trieb er's, bis es zwölf Uhr schlug.
Da hörte er plötzlich im Hof einen Lärm, daß fast das Schloß erbebte. Rossegetrampel, Waffengeklirr und Geschrei hallten bis zum Saal herauf. Bald kam der Lärm näher, die Tür flog auf, und sieben Soldaten stürzten in den Saal und auf den Jüngling los. Sie nahmen ihn in ihre Mitte und führten ihn in ein Zimmer, wo ihr König auf dem Thron saß.
Als dieser den hereingeführten Soldaten sah, rollte er zornig die Augen und fragte ihn: »Elender Wicht, was tust du hier, und warum störst du den Frieden des Schlosses?« Der junge Soldat verlor seinen Mut nicht und blieb stumm wie ein Stein. Der König fragte zum zweiten und zum dritten Mal, und sein Gesicht rötete sich immer mehr vor Grimm. Der junge Soldat aber ließ sich nicht schrecken und verlor keine Silbe.
Da kam der König fast außer sich vor Wut, befahl, eine Bank zu holen und den halsstarrigen Burschen zu prügeln. Es geschah, und doch, wie auch die Hiebe prasselten, der junge Soldat war und blieb stumm. Da schlug es ein Uhr, und der König zog mit seinen Kriegern ab. Der Soldat blieb aber auf der Bank liegen und schlummerte bald ein.
Als er spät am Morgen erwachte, war er frischer und wohlgemuter als je, und ihm kam alles, was er in der Nacht gesehen und gehört hatte, nur wie ein Traum vor. Er besichtigte nun ein wenig das Schloß, und dann ging er in den Speisesaal, denn seine Magenuhr zeigte schon auf Mittag. Er fand den Tisch wieder herrlich bestellt, setzte sich nieder und aß nach Herzenslust.
Wie er dasaß, klopfte es wieder an die Tür, und auf das »Herein!« des Soldaten kam die Schlange, kroch wieder auf den Tisch und legte sich in den leeren Teller.
Doch diesmal hatte sie schon einen schönen Mädchenkopf, der übrige Leib aber war der einer Schlange. Sie lächelte dem Soldaten freundlich zu und sprach: »Du hast dich brav gehalten und die erste
Nacht glücklich überstanden. Fahre nur so fort und rede keine Silbe. Folgst du mir, werden wir beide glücklich werden.«
Der Soldat versprach ihren Rat zu befolgen, und gleich war die Schlange wieder verschwunden. Er trieb es nun wieder wie am ersten Tag, trank und aß und griff dann aus Langeweile zu dem Buch. Darin las er, bis es zwölf Uhr schlug. Da lärmte es wieder im Schloßhof wie in der ersten Nacht, und Soldaten kamen wieder in den Saal und holten den jungen Eindringling. Dann wurde er wieder vor den zornigen König geführt und befragt, was er hier im Schloß tue.
Er antwortete aber keine Silbe, und darob ergrimmte der König so sehr, daß er ihn von den Soldaten aufs ärgste mißhandeln und peinigen ließ. Der junge Soldat blieb aber bei seinem Vorsatz, sprach keine Silbe, und wie es ein Uhr schlug, zog der König mit seinen Soldaten ab. Der Bursche legte sich wieder auf eine Bank, schlief süß und gut, bis er am späten Morgen frisch und munter erwachte.
Er vertrieb sich die kurze Zeit des Vormittags mit allerlei Dingen, und dann ging er wieder in den Speisesaal, um dort sein Mittagsmahl zu nehmen. Er fand wieder den Tisch herrlich gedeckt, und die köstlichsten Speisen dampften darauf. Er setzte sich nieder und tafelte, daß es eine Lust war. Da klopfte es wieder an die Tür, und als er »Herein!« gesagt hatte, kam die Schlange, aber jetzt war sie schon halb Jungfrau. Sie begab sich wieder auf den Tisch und nahm im leeren Teller ihren Platz.
Sie war diesmal gar freundlich, lächelte dem Soldaten zu und sprach: »Bisher hast du meine Worte treulich befolgt, und ich danke dir dafür. Harre aber mutig aus und bestehe auch die künftige Nacht. Diese wird die letzte und gefährlichste Probezeit sein. Wirst du dieses Mal auch kein Wort reden, dann ist dein Glück gemacht.« Er versprach es ihr, und dann verschwand sie wie die zwei vorigen Male.
Der Soldat saß nun wieder allein da, ließ es sich wohlschmecken und wartete auf die letzte Nacht. Es fing ihn gar nicht an zu gruseln, als diese näher rückte, denn er dachte, die wird mich auch nicht umbringen. Als es wieder Mitternacht war, fing es an zu trommeln und zu pfeifen, und der König mit seinen Leuten kam. Sieben Mann kamen wieder und holten den jungen Soldaten und führten ihn vor den König. Dieser versuchte wieder auf jede Weise, von ihm ein Wort herauszubringen, aber umsonst.
Als alle Versuche sich nutzlos erwiesen, erzürnte er so heftig, daß er befahl, ihm den Kopf abzuschlagen. Der Soldat vertraute auf die Worte der Schlange und ließ dies ruhig geschehen. Als der Schlag geführt wurde, fiel der Soldat in einen so tiefen Schlaf, daß er erst spät am Morgen wieder erwachte. Da war das erste, daß er nach dem Kopf griff, um zu erfahren, ob er ihn noch habe.
Als er fühlte, daß der Kopf noch auf dem alten Fleck saß, war er herzlich froh und stand auf. Wie staunte er aber, als ganze Scharen von Bedienten kamen, ihm Wäsche und neue Kleider brachten und ihn ihren Herrn nannten. Nachdem er angekleidet war, geleiteten sie ihn zum Frühstück, und dann führten sie ihn durch das Schloß und zeigten ihm all die Pracht und Herrlichkeiten.
Da kamen sie unter anderem auch an einer Tür vorbei, die zierlich gearbeitet war. Der junge Soldat wollte hineingehen, um das Gemach zu sehen. Da antworteten die Bedienten, ihre Herrin hätte dies verboten. Der Soldat ließ sich aber von seinem Wunsch nicht abbringen und sprach endlich: »Jetzt bin ich euer Herr, und ich befehle euch, die Tür zu öffnen und mich hineinzuführen.«
Da öffneten sie die Tür und führten ihn ins Zimmer. Darin war die Jungfrau, die ihn mit zornigen Blicken vom Kopf bis zu den Füßen maß. Dann sprach sie: »Dein Stolz hat dir geschadet. Weil du so eigensinnig und herrisch bist, kann ich noch nicht deine Braut werden. Deines Stolzes wegen muß ich dich aus dem Schloß entlassen. In drei Wochen werde ich dir aber kundtun, ob ich deine Frau werde oder nicht.« Mit diesen Worten gab sie ihm einen Beutel und entließ ihn.
Dieser Beutel hatte aber eine gar absonderliche Eigenschaft, denn so oft man hinein fuhr, konnte man eine Handvoll Dukaten herausholen. Der Soldat war darüber froher Dinge, verließ das Schloß und ging ins Dorf hinunter. Dort fand er in einer Kneipe seine zwei Kameraden, die auf ihn gewartet hatten und es sich kreuzwohl sein ließen.
Als sie ihren Kameraden wiedersahen, hatten sie große Freude, und alle drei fingen nun um die Wette zu zechen an. Da erzählten sie sich auch dies und das, und der jüngste machte aus seinen Erlebnissen auch kein Geheimnis und prahlte mit seinem Glück.
Seine zwei Genossen wurden darüber neidisch und verabredeten sich, als sie zu Bett gegangen und allein waren, wie sie ihn um sein Glück bringen konnten. Sie beschlossen, den Wirt zu überreden, dem jüngsten an jenem Tag, an dem die Jungfrau kommen sollte, einen Schlaftrunk zu geben. Am folgenden Tag bestachen sie den Wirt, und dieser erklärte sich zur Tat bereit.
Als die drei Wochen vergangen waren und die Prinzessin kommen sollte, mischte der Wirt einen so starken Schlaftrunk in den Wein, daß der jüngste Soldat sogleich betäubt zu Boden fiel und in einen tiefen Schlaf sank. Er war noch nicht lange in diesem Zustand da gelegen, als eine prächtige Kutsche, von zwei Schimmeln gezogen, daher fuhr.
Darin saß die Jungfrau, ganz weiß gekleidet, und ein weißer Schleier bedeckte ihr Haupt. Sie fragte nach dem jüngsten Soldaten. Als sie aber hörte, daß er schlafe, sprach sie, sie werde morgen wiederkommen, und fuhr von dannen. Am Abend tat der Wirt wieder einen Schlaftrunk in den Wein des jungen Soldaten, und dieser betäubte sich wieder ganz und gar.
Als er noch schlief, kam wieder eine herrliche Kutsche daher gefahren. Sie war rot, und zwei stolze braune Pferde zogen sie. Die Prinzessin, die im Wagen saß, war auch ganz rot gekleidet. Als sie hörte, daß der Soldat noch schlafe, gab sie den Bescheid, sie werde morgen wiederkommen, und fuhr von dannen.
Gegen Abend erwachte der Soldat wieder und war, als er sah, daß er die Ankunft der Jungfrau verschlafen habe, sehr betrübt. Aus Verdruß darüber fing er wieder an zu trinken und war bald wieder vom Schlaftrunk betäubt. Bald schnarchte er im tiefsten Schlaf und schlief bis spät in den folgenden Tag hinein.
Zur bestimmten Stunde kam wieder eine schwarze Kutsche, zwei feurige Rappen waren davor gespannt. Im Wagen saß die Jungfrau, auch sie war schwarz gekleidet. Als sie hörte, daß ihr Erlöser wieder schlafe, ging sie in sein Zimmer, zog sein Schwert aus der Scheide, schnitt sich damit in den kleinen Finger und schrieb mit ihrem Blut folgende Worte auf das Schwert: »Wenn du morgen in Residia bist, heirate ich dich.« Dann ging sie leise fort, denn wecken durfte sie ihn nicht, und fuhr von dannen.
Als er aus seinem schweren Schlaf erwachte und die Worte las, wurde er sehr bestürzt und traurig, denn er wußte gar gut, daß dies nur durch ein Wunder geschehen könnte. Er beschloß aber dennoch sich aufzumachen und gegen Residia zu wandern. Wie er so traurig seinen Weg ging, kam er in einen dunklen Wald.
Er war noch nicht lange gegangen, als ein Bär auf ihn zutrottete und ihn fragte, warum er so traurig sei. Da faßte sich der Soldat ein Herz, und schilderte dem Bären seine traurige Lage haargenau. Als er seine Erzählung beendet hatte, sprach der Bär: »Wenn es nur das ist, so ist dir leicht zu helfen. Setz dich nur auf meinen Rücken, halte dich fest und dann will ich dich noch heute nach Residia bringen.«
Der Soldat folgte dem Rat, setzte sich auf den Bären, und dieser flog brummend über Berg und Tal, daß sie in drei Stunden in Residia waren, obwohl diese Stadt von dem Dorf zehntausend Meilen entfernt war. Da sprach der Bär: »Siehst du, diese Stadt ist Residia!« Der Soldat sprang nun vom Rücken des Bären herunter, bedankte sich und wollte in die Stadt gehen. Der Bär stellte sich aber vor ihn und bat, er möchte ihm mit seinem Schwert den Kopf abschlagen.
Der Soldat war durch diese Bitte ganz überrascht und rief aus: »Gott bewahre mich davor, daß ich meinen größten Wohltäter morde!« Allein der Bär hörte nicht auf zu bitten und sprach: »Die größte Wohltat, die du mir erweisen kannst, tust du mir, wenn du mir den Kopf abhaust.«
Als der Soldat sah, daß der Bär nicht aufhörte zu bitten, zog er sein Schwert und hieb ihm den Kopf ab. Dann machte er sich auf die Füße und ging auf die Stadt zu. Wie er aber noch einmal umblickte, sah er an der Stelle, wo er den Bären geköpft hatte, einen schönen, weißen Jüngling stehen, und dieser rief ihm seinen Dank zu.
Der Soldat eilte in die Stadt und begegnete dort einigen Soldaten. Er fragte sie: »Wo ist das beste Wirtshaus?« Die Soldaten glaubten, der Bursche sei nicht bei Sinnen oder er wolle sie foppen, spotteten ihn deshalb aus und sagten: »Du Narr, was willst du blutarmer Schlucker in einem Wirtshaus? Du hast ja keinen roten Pfennig, geschweige so viel, um ins vornehmste Gasthaus zu gehen.«
Er sagte kein Wort darauf, sondern griff in seinen Zaubersäckel und schenkte jedem eine Handvoll Dukaten. Da machten sie große Augen, wurden freundlich und führten ihn zum besten Gasthaus. Er ging hinein, setzte sich nieder und ließ sich zu essen und trinken geben. Wie er so dasaß, fragte er den Wirt, was es Neues gebe.
Dieser antwortete: »Das Neueste ist dies, daß gestern die Königstochter, die vor vierzig Jahren spurlos verschwunden ist, wiedergekommen ist. Morgen wird sie sich auch einen Bräutigam wählen und deshalb auf dem Altan erscheinen und jene mustern, die darunter vorbeifahren. Aus diesen wird sie sich den Bräutigam suchen.«
Als dies der Soldat gehört hatte, bestellte er sich bei dem Wirt eine weiße Kutsche, mit zwei Schimmeln bespannt, und schaffte sich für den folgenden Tag ein weißes Kleid an. Am folgenden Morgen fuhr er zur bestimmten Stunde, als die Prinzessin auf dem Altan stand, in der weißen Kutsche am Ende der übrigen Freier langsam vorbei.
Die Prinzessin wählte aber diesmal noch keinen Bräutigam, sondern ließ durch einen Herold kundtun, die Bewerber um ihre Hand sollten am folgenden Tag noch einmal vorüberfahren, und dann werde sie wählen. Da ging der Soldat guten Mutes in das Gasthaus zurück, aß und trank und bestellte sich für den morgigen Tag eine rote Kutsche, die mit zwei braunen Pferden bespannt sein sollte. Zugleich ließ er sich ein rotes Kleid machen.
Am folgenden Tag bestieg er ganz rot gekleidet die rote, mit zwei braunen Pferden bespannte Kutsche und fuhr zur festgesetzten Stunde vor die Königsburg. Dort schloß er sich dem Zug der Werber an und fuhr wieder zuletzt und sehr langsam unter dem Altan vorbei.
Die Prinzessin wählte aber auch diesmal noch keinen Bräutigam, sondern ließ durch einen Herold kundtun, die Freier sollten am folgenden Tag noch einmal kommen, und dann wolle sie wählen. Da kehrte der Soldat wieder ins Gasthaus zurück und trank und aß frohen Mutes. Dann bestellte er sich für den morgigen Tag eine schwarze Kutsche mit schwarzem Gespann und ließ sich ein schwarzes Kleid machen.
Als am folgenden Tag die von der Prinzessin festgesetzte Stunde anrückte, bestieg er, schwarz gekleidet, den schwarzen Wagen und fuhr auf den Burgplatz. Dort schloß er sich dem Zug der Freier an und fuhr zuletzt und langsam unter dem Altan vorbei.
Als die Königstochter ihn diesmal in schwarzer Kleidung und in der schwarzen Kutsche sah, war es ihr klar, daß dieser Freier ihr Erlöser sein müsse. Sie ließ ihn deshalb zu sich holen, und als sie in ihm ihren Retter wirklich erkannte, fiel sie ihm um den Hals und hieß ihn ihren Bräutigam.
Nun gab es eine große Freude im Schloß, und noch am gleichen Tag wurde die Hochzeit gefeiert. Da hing ihnen der Himmel voller Geigen, und das Brautpaar blieb auch in Zukunft glücklich wie am ersten Tag.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Sellrain
SAUERKRAUT UND TOTENGEBEINE ...
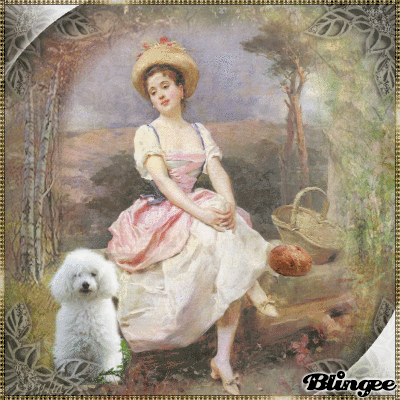
Vor langer Zeit lebte ein armes Bäuerlein, das drei Töchter hatte. Die beiden älteren waren schön und gescheit, die jüngste konnte eben nicht mit ihrer Schönheit prahlen, und auch am Verstand schien es ihr zu fehlen.
Die zwei stolzen Dinger taten über die Maßen groß und nobel und mußten immer schöne Kleider haben, um den reichsten Bauerntöchtern nicht nachzustehen. Wenn sie dann so geputzt waren, lachten sie ihre jüngste Schwester aus und taten nicht anders, als ob sie ihr Stubenmädchen wäre.
Dieser Staat, den sie führten, kostete aber viel Geld, und das arme Bäuerlein sah, daß er bei dieser Wirtschaft trotz allem Sichabschinden auf die Gant kommen müßte. Deshalb sagte er eines Tages zu seinen Töchtern: »Meine Kinder, die Sache wird mir bald zu arg, wenn ich alle drei länger kleiden und nähren soll. Ihr seid so alt, daß ihr euch selbst das Brot verdienen könnt, und deshalb meine ich, soll eine von euch in einen Dienst gehen.«
Damit war die älteste sogleich einverstanden, denn sie glaubte, sie werde wegen ihrer Schönheit in der Stadt ein gutes Unterkommen finden. Sie packte ihre Kleider und Habseligkeiten zusammen und verließ voll schöner Hoffnungen die väterliche Hütte. Sie schlug den nächstbesten Weg ein und kam bald in einen großen, stockfinsteren Wald, der sich viele Stunden ausdehnte.
Als sie einige Stunden im Forst fortgegangen war, fühlte sie Müdigkeit in ihren Gliedern und Hunger in ihrem Magen. Sie setzte sich deshalb auf einen Stein, der am Weg lag, und zog ein Stück Brot aus ihrem Kittelsack, um sich zu laben. Kaum hatte sie aber zu essen angefangen, als ein schneeweißer Pudel kam und sich ihr gegenübersetzte.
Es war ein abgemagertes Tier, und der Hunger sah aus seinen Augen. Er winselte und bat um ein Stücklein Brot, aber die Hartherzige dachte sich, Selbstessen macht fett, und kümmerte sich um den Pudel blutwenig. Nachdem sie sich gestärkt hatte und weitergehen wollte, fing der Hund plötzlich an zu reden und sprach:
»Wenn du weiter in den Wald kommst, wird dir ein graues Männlein begegnen, das dich fragen wird, ob du nicht bei ihm in Dienst treten möchtest. Du wirst bei ihm zwar nur Sauerkraut und Totengebeine zu essen bekommen, ich rate dir aber, sein Angebot gleich anzunehmen.« Nach diesen Worten war der Pudel verschwunden.
Darüber verwunderte sich das Mädchen nicht wenig, noch mehr aber über das graue Männlein und seine sonderbare Kost. Sie sah gar wohl ein, daß es hier nicht mit gewöhnlichen Dingen zugehe, und beschloß den Dienst anzunehmen. Gefaßten Mutes ging sie weiter durch den Wald und wünschte sich nach Hause zurück.
Sie war noch nicht weit gegangen, da begegnete ihr wirklich ein kleines Männlein, dem ein eisgrauer Bart bis auf die Füße reichte, und fragte sie, ob sie bei ihm in Dienst treten wolle; zu essen bekäme sie aber nur Sauerkraut und Totengebeine. Das Mädchen sagte ohne Bedenken zu und folgte dem graubärtigen Männlein.
Dieses führte sie lange, lange Zeit fort über Stock und Stein, bergauf, bergab, bis sich endlich ein großes, altes Schloß zeigte. Er führte die Magd hinein, die gar müde und schläfrig war und alsbald ihr Bett aufsuchte.
Am anderen Tag zeigte ihr das Männlein die Arbeiten, die sie besorgen sollte, gab ihr Sauerkraut und Totengebein und verließ dann mit dem weißen Pudel, den sie am vorigen Tag im Wald gesehen hatte, das alte Schloß.
Sie ging an ihre Arbeit und hatte sie bald verrichtet, denn viel hatte sie nicht zu tun. Dann setzte sie sich zu Tisch und aß das Sauerkraut; die Totenknochen verbarg sie aber im Tischtuch. Nachdem sie ihren Hunger gestillt, vertrieb sie sich durch allerlei Dinge die Zeit, bis der Abend ins Tal sank.
Dann kam wieder das graue Männlein mit dem weißen Pudel nach Hause und fragte sogleich, ob sie die Totengebeine gegessen habe. Sie besann sich nicht lange und sagte gleich ja. Da wandte sich das Männlein an seinen Pudel und sprach: »Weißer, mach deine Künste!«
Alsogleich machte sich der weiße Pudel auf und schnupperte und witterte lange Zeit in der Stube umher, bis er endlich die Tischlade herauszog, die Totenknochen darin fand und sie dem grauen Männlein vor die Füße legte. Wie das Zwerglein die Gebeine sah, wurde es ganz wütend, lief in die Küche, holte sich dort ein Beil und schlug damit die Magd tot.
Als nach vielen Wochen die älteste Tochter noch nie zu den Ihrigen zurück gekommen war und sie keine Kunde von ihr erhalten hatten, dachte die zweite Tochter des Bäuerleins bei sich: Meine älteste Schwester muß ein rechtes Glück gehabt haben, daß sie uns so ganz und gar vergißt. Dabei stieg ihr der Gedanke auf, auch in die Stadt zu gehen und dort das Glück zu versuchen.
Gedacht, getan. Sie packte ihre Kleider und Habseligkeiten zusammen, nahm einen Laib Brot und ein Stück Käse mit und machte sich, nachdem sie von ihrem Vater Abschied genommen hatte, auf den Weg in die Stadt. Als sie eine Strecke gegangen war, kam sie zum großen, stockfinsteren Wald, in dem sie sich auch, als sie müde und hungrig war, niederließ und sich mit Brot und Käse laben wollte.
Da kam auch wieder der weiße Pudel und setzte sich ihr gegenüber und blickte so lüstern auf das Brot, als ob er ihr jeden Bissen weg schnappen wollte. Das Mädchen hatte aber ein steinhartes Herz, aß sich selbst satt und warf dem bettelnden Hund kein Bröslein vor. Dann stand sie auf und wollte ihres Weges weiter gehen.
Da fing der weiße Hund plötzlich zu reden an und sprach: »Wenn du tiefer in den Forst kommst, wird dir ein graues Männlein begegnen. Das wird dich fragen, ob du nicht in seine Dienste treten möchtest. Du wirst bei ihm zwar nur Sauerkraut und Totengebeine zu essen bekommen, und die Kost wird schmal sein. Ich rate dir aber, sein Angebot gleich anzunehmen.« Nach diesen Worten war der Pudel verschwunden.
Das Mädchen konnte sich über den redenden Pudel und seinen Rat nicht wenig wundern, verlor jedoch nicht den Mut und dachte sich, da kann ich vielleicht mein Glück finden. Guter Dinge wanderte sie nun weiter in den dichten, dunklen Forst hinein und hing ihren Gedanken nach.
Als sie ein gutes Stück Weges gegangen war, stand plötzlich das kleine Männlein mit dem langen, eisgrauen Bart vor ihr und fragte sie, ob sie nicht bei ihm als Magd dienen wollte; zu essen bekomme sie aber nur Totengebeine und Sauerkraut. Sie ließ sich jedoch dadurch nicht abschrecken und nahm das Angebot an.
Das graue Männlein führte sie nun über Stock und Stein, bergauf, bergab durch den finsteren Wald, bis sie endlich in der schauerlichsten Wildnis das alte Schloß sahen. In dieses gingen das Männlein und die Magd, die gar müde und schläfrig war und alsbald ihr Bett aufsuchte.
Am anderen Tag wies das Männlein der neuen Magd ihre Arbeit an, zeigte ihr dies und das und gab ihr die besagte Kost. Dann verließ er mit dem weißen Pudel das Schloß und verschwand im wilden Wald.
Die Magd besorgte ihre Arbeiten, und als sie beendet waren, setzte sie sich auf die Küchenbank, nahm das Tellerchen mit der ekelhaften Kost, suchte die Totengebeine heraus und verbarg sie unter der Asche. Dann nahm sie das Kraut und stillte damit ihren Hunger.
Später schaute sie sich im Schloß um und schaffte dies und das, bis es Abend wurde. Nun kam auch das graue Männlein mit seinem weißen Pudel heim und fragte alsbald, ob sie Kraut und Totengebeine gegessen habe. Sie bejahte ohne Zaudern seine Frage.
Da wandte sich das Männlein an seinen Pudel und sprach: »Weißer, mach deine Künste!« Sogleich sprang der Pudel auf und schnupperte und stöberte in allen Ecken und Enden der Küche, bis er schließlich zum Aschenhaufen kam und darin die gesuchten Knochen fand. Wie das Zwerglein die Gebeine sah, schäumte es vor Wut, griff nach dem Beil und köpfte damit die lügnerische Magd.
Indessen war auch das arme Bäuerlein gestorben, und das verschuldete Anwesen fiel den Gläubigern anheim. Da blieb der jüngsten Tochter auch keine Wahl, und sie mußte ihr Brot in der weiten Welt suchen. Sie schnürte deshalb ihr Bündel und machte sich auf den nächstbesten Weg, der nach ihrer Meinung in die Stadt führte.
Da kam auch sie in den großen Wald, und als sie eine lange Strecke darin gegangen war, fühlte sie Müdigkeit an ihren Gliedern und Leere in ihrem Magen. Sie setzte sich deshalb auf einen alten, bemoosten Baumstamm, um ein wenig auszurasten und sich zu stärken.
Als sie so da saß und ihr hartes Brot kaute, kam wieder der weiße Pudel und setzte sich ihr gegenüber. Da schaute er so unverwandt und lüstern nach dem Stücklein Brot in ihrer Hand, daß sie gleich wußte, was er haben wollte. Sie hatte nun das größte Mitleid mit ihm und gab ihm all ihr Brot, obwohl sie erst wenig davon gegessen hatte.
Da aß der Pudel, daß es eine Freude war, und hernach fing er zu reden an und sprach: »Dir wird im Wald ein graues Männlein begegnen und dich fragen, ob du etwa bei ihm dienen möchtest. Zu essen wirst du bei ihm jedoch nichts bekommen als Sauerkraut und Totengebeine. Willige aber nur in den Antrag, denn die Knochen kannst du ja in den Garten hinunter werfen, dort werde ich sie schon verscharren.« Nach dieser Rede war der Pudel aus ihren Augen verschwunden.
Obwohl ihr die Geschichte mit diesem Tier nicht geheuer vorkam, fürchtete sie sich doch nicht, nahm ihr Bündel wieder auf und setzte ihren Weg fort. Als sie wieder ein Stück Weges zurückgelegt hatte, begegnete ihr das Männlein mit dem eisgrauen Bart und fragte sie, ob sie in seinen Dienst treten möchte. Sie hätte nicht viel zu arbeiten, aber zu essen werde sie nur Sauerkraut samt Totengebeinen bekommen.
Das Mädchen dachte an die Worte des Pudels, sagte gleich zu und folgte dem kleinen Zwerg, der sie lange, lange durch den dichten Wald führte, bis sie endlich zum alten, großen Schloß kamen. Nun war das Mädchen aber müde und matt, daß ihm die Augen zufielen, und suchte bald sein Bettchen auf, wo es ruhig und sanft bis zum folgenden Morgen schlief.
Als die Sonne hinter den Bergen emporstieg, stand auch die neue Magd auf und ging an ihre Arbeit. Das Männchen wies ihr das Tagwerk an, gab ihr die ekelhafte Kost und verließ dann mit dem weißen Pudel das Schloß. Das Mädchen tat nun gewissenhaft die Arbeit, und als es diese beendet hatte, nahm es sein Schüsselchen, stillte mit dem Sauerkraut seinen Hunger und warf die Gebeine in den Garten hinab, wo sie der Pudel vergrub.
Als die Sonne untergegangen war und es Nacht wurde, kam das graue Männlein nach Hause und fragte das Mädchen, ob es Kraut und Knöchlein gegessen habe. Da sagte die Magd ja, obwohl ihr dabei das Herz pochte. Das Männlein wandte sich nun an den Pudel und sprach: »Weißer, mach deine Künste!« Doch dieser machte keine, und die vergrabenen Gebeine kamen nicht an das Licht.
Darob schien das Männlein froh und munter zu sein, und es sprach zur Magd: »Danke Gott und steh heute um elf Uhr auf und bete bis zwölf Uhr, dann wird dir nichts geschehen. Fürchte dich nur nicht vor dem Löwen und den Untieren, die dich zu verschlingen drohen werden. Wenn du ausharrst, sollst du glücklich werden.«
Die Magd folgte den Worten des Zwergleins genau. Sie ging nach vollendeter Arbeit in ihre Kammer, warf sich auf die Knie und betete mit größter Andacht. Kaum begann es aber auf dem Schloßturm elf Uhr zu schlagen, entstand ein so schreckliches Lärmen und Poltern im Schloß, daß alle Mauern zitterten.
Türen flogen auf und zu, und es schien, als ob die wilde Fahrt los sei. Bald flog auch die Kammertür auf, und Schreck erregende Ungetüme kamen herein gesprungen und drohten unter ohrenzerreißendem Geheul, das Mädchen zu verschlingen. Doch dieses ließ sich im Beten nicht irremachen, sondern flehte nur noch inbrünstiger zu Gott, bis es zwölf Uhr schlug. Da wurde es aber wieder mäuschenstill, und die müde Magd legte sich ins Bett und schlief bis der Morgen graute.
Wie war sie aber überrascht, als sie morgens ihre Augen öffnete, denn sie befand sich nicht in ihrer kleinen, düsteren Kammer, sondern in einem großen, herrlichen Zimmer. Sie ruhte in einem seidenen Bett anstatt auf ihrem elenden Strohsack, und die Wände waren mit den herrlichsten Spiegeln geschmückt.
Sie konnte sich an all dieser Pracht und Herrlichkeit nicht satt sehen, stand auf und wollte sich ankleiden. Da waren die schönsten Kleider für sie bereitet, und ihr früheres Gewändlein war nicht mehr zu finden.
Nachdem sie sich angekleidet hatte, trat ein wunderschöner Jüngling in das Zimmer und dankte ihr innigst für seine und seines Vaters Rettung. Denn sie beide waren verzaubert gewesen, er in den weißen Pudel und sein Vater in das alte Männlein, und waren nun wieder erlöst.
Zum Dank für die Rettung machte er das brave Mädchen zu seiner Frau und hielt noch am selben Tag seine Hochzeit. Da schmetterten Pauken und Trompeten, und die Gläser klangen, als ob Kirchweih wäre. Sie und der Ritter blieben auch ihr Lebtag so glücklich wie am Hochzeitstag und erreichten ein hohes Alter.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
DIE SCHLEIFERSÖHNE ...
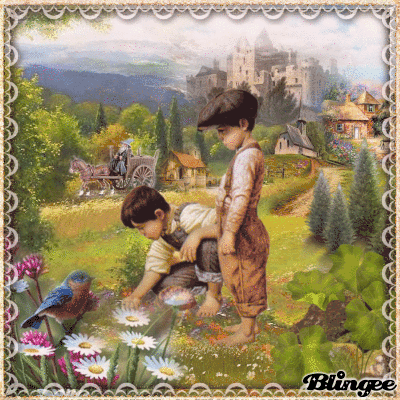
Ein Scherenschleifer, der zwei Söhne hatte, wollte in eine Stadt fahren, wo er immer viele Arbeit fand und sich deshalb jährlich längere Zeit aufzuhalten pflegte. Der Weg dahin führte durch einen Wald. Der Schleifer zog seinen Karren, und die zwei Knaben schoben das elende Fahrzeug, wie sie es gewöhnlich taten.
Aber heute wollte die Fahrt nicht vorwärts gehen, denn der Weg war schlecht, und der Karren blieb ein über das andere Mal im Kot stecken. Mit Mühe und Schweiß kamen sie zwar weiter, doch nahmen die Kräfte des alten Schleifers immer mehr und mehr ab, bis er müde und matt zu Boden sank.
Da befahl er seinen zwei Knaben, in die Stadt zu rennen und ihm Speise und Trank zu holen. Die Burschen rührten sogleich hurtig ihre Beine und liefen schnurstraks gegen die Stadt. Als sie an das Ende des Waldes gekommen waren und schon die Stadt sahen, erblickten sie plötzlich im Farnkraut nahe am Weg einen seltsamen, wunderschönen Vogel. Da war aber auch der arme Vater vergessen, und ihr Sinnen und Trachten ging nur darauf, den schönen Vogel zu bekommen.
Allein dieser ließ sich nicht einfangen und flog weiter, und wenn sie oft schon glaubten, ihn unter der Kappe zu haben, war er schon wieder entkommen und flog eine Strecke weiter, wo er dann wieder still saß. Die zwei Knaben liefen ihm über Stock und Stein nach und entfernten sich immer mehr vom Weg. Nach langem Laufen und Jagen gelang es ihnen endlich doch, des Vogels habhaft zu werden.
Nun liefen die zwei Knaben freudig zu ihrem Vater zurück und zeigten ihm den herrlichen Fang. Der Vater war aber voll Zorn und Ärger, daß sie ihm keine Speise brachten, zankte seine Kinder aus und wollte den Vogel fort fliegen lassen. Da sah er auf dem Kopf des Vogels folgende Worte geschrieben: »Wer meinen Kopf brät und ißt, findet täglich einen Sack voll Gold.«
Kaum hatte er diese Worte gelesen, verwahrte er den Vogel ganz sicher, ließ sich dann auf den Karren heben und von seinen Söhnen in die Stadt ziehen. Dort angekommen, begaben sie sich ins Wirtshaus, in dem der Schleifer gewöhnlich Herberge nahm. Er trug dann den schönen Vogel sogleich in die Küche und befahl der Köchin, ihn zu braten und auf ihn gut achtzugeben, denn er habe ihn um sündteures Geld gekauft, und sein Fleisch solle ihm das Kopfweh vertreiben. Dann stärkte er sich vorläufig mit Brot und Wein und ging einstweilen seinem Geschäft nach.
Die Köchin tat nach seinen Worten, rupfte und putzte den Vogel sorgfältig und stellte ihn ans Feuer. Die zwei Knaben standen am Herd und sahen ihr zu. Da mußte die Köchin einmal die Küche verlassen, und die zwei Schleiferbuben blieben allein zurück. Das war für diese eine gemähte Wiese, denn sie waren hungrig wie Raben, und der Duft des Bratens kitzelte ihre Nasen gar sehr.
Sie nahmen nun den Vogel, machten sich damit aus der Küche und teilten ihn dann unter sich, doch so, daß der ältere, der ein schlauer Patron war, dem jüngeren nur den Kopf des Vogels ließ. Dann aßen sie den Braten auf und ließen sich ihn gut schmecken.
Der alte Schleifer blieb aber auch nicht lange aus und verlangte seinen Braten. Die Köchin antwortete ihm, daß er verschwunden sei und sie nicht wisse, wohin. Seine Knaben seien in der Küche gewesen und müßten es wissen, wohin er gekommen sei. Da der Vater dies gehört hatte, ging ihm ein Lichtlein auf, er nahm eine Gerte, suchte die zwei Söhne in der Kammer auf und wichste den älteren durch, daß der Staub aufflog.
Der Knabe gestand ihm aber kein Sterbenswörtchen. Als der Vater sah, daß an diesem Hopfen und Malz verloren war, nahm er den jüngeren beim Schopf und gerbte ihn gehörig durch. Da wurde es dem Knaben doch zu arg, und er gestand, daß er bloß den Kopf des Vogels gegessen habe, während sein Bruder alles übrige davon aufgezehrt habe.
Wie der Vater dies hörte, dachte er sich, wenn das so ist, kann mir das Gold doch nicht entgehen, und ließ den Knaben laufen. Seine Mutmaßung bestätigte sich auch, denn er fand täglich unter dem Kopfkissen des jüngeren Sohnes einen schweren Beutel Goldes.
Der Schleifer gab nun sein früheres Gewerbe auf, kaufte sich Hof und Haus, Roß und Wagen und spielte den großen Herrn. Die Leute aber vergaßen nicht, was er früher war, und nannten ihn nur den Schleifer, und seine Söhne hießen überall die Schleiferbuben. Dies und das Betragen des Vaters, der ihnen nie sagte, woher er das viele Geld bekomme, verdroß die Knaben so sehr, daß sie eines Morgens auf und davon gingen und beschlossen, bei einem Müller in den Dienst zu treten.
Sie waren schon eine gute Strecke gewandert, als sie zu einer Mühle kamen und dort um einen Dienst anfragten. Der Müller hätte wohl einen Knecht angenommen, aber er wollte von zwei nichts wissen. Da sich die Brüder nicht trennen wollten, blieb ihnen keine Wahl, als weiterzuwandern und anderswo ihr Unterkommen zu suchen.
Am folgenden Tag kamen sie wieder zu einer Mühle und traten dort in den Dienst. Sie arbeiteten fleißig und dienten ihrem Meister treu und redlich. Da sagte einmal die Magd zu ihnen: »Glaubt ihr denn, ich sei eine Diebin, daß ihr jeden Morgen einen Beutel Gold unters Kopfkissen legt, um meine Redlichkeit zu prüfen?« Mit diesen Worten warf sie ihnen einige Beutel Gold vor die Füße und verließ sie.
Die zwei Schleifersöhne schauten ungläubig darein, nahmen das Gold und machten sich aus dem Staub, denn sie getrauten sich nicht länger zu bleiben. Als sie schon eine große Strecke gewandert waren und nirgends einen Dienst fanden, wo sie beisammen bleiben konnten, kamen sie zu einer riesigen Eiche, bei der sich der Weg teilte.
Da sprachen sie: »Es geht so nicht, wir müssen uns trennen.« Dann nahmen sie voneinander Abschied und versprachen sich, nach einem Jahr hierher zurückzukehren, um zu erfahren, wie es jedem von ihnen ergangen war. Nun steckten sie ihre Messer tief in den Stamm der Eiche. Sollte eines davon rostig befunden werden, so sei das ein Zeichen, daß es dem Eigentümer schlecht ergehe, und dann sollte der andere sich aufmachen, um den Bruder aus dem Unglück zu retten.
Sie umarmten sich dann und schieden voneinander, worauf der ältere den Weg zur Rechten, der jüngere den zur Linken einschlug. Jeder ging ganz einsam seinen Weg, nur eine Flinte und einen Säbel hatte er bei sich.
Der ältere, der Hans hieß, kam bald in einen dichten Wald. Er war darin noch gar nicht lange fort gegangen, als er in der Nähe einen großen, schönen Fuchs erblickte. Das ist ein schöner Fang, dachte sich Hans, nahm die Flinte von der Schulter und wollte auf das schöne Tier anlegen. Da begann aber der Fuchs plötzlich zu reden und sprach. »Schone mein Leben, und ich will dir in Treue folgen. Vielleicht kann ich dir noch nützlich sein.«
Hans hatte Mitleid mit dem Tier und schenkte ihm das Leben. Der Fuchs kam nun ganz nahe heran und folgte dem Schleifersohn wie ein Hündchen seinem Herrn. Bald darauf kam ein Wolf aus dem Gehölz
und wollte über den Weg gehen. Da nahm Hans wieder seine Flinte und wollte das Tier erlegen; aber der Wolf rief: »Laß mich leben, und ich will dir immer folgen und dir dankbar sein.«
Hans war es zufrieden und schenkte dem Wolf das Leben. Das Tier schritt nun herzu und begleitete den Schleifersohn.
Nach einer Weile trabte ein zottiger Bär aus dem Dickicht hervor, da legte der Hans auf ihn an, aber der Bär brummte: »Laß mich leben, und ich werde dir dankbar folgen.« Der Schleifersohn war damit einverstanden und ließ den Bären am Leben. Nun hatte der Hans einen Fuchs, einen Wolf und einen Bären zu seinen Begleitern und Dienern und kam bald aus dem dunklen Wald ins Freie.
Von da gingen sie noch einen Tag lang und erreichten dann eine große, schöne Stadt. Darin sah es aber gar trüb und traurig aus, und die Leute waren niedergeschlagen, als ob ihnen ein großes Unglück geschehen wäre. Da fragte Hans ein altes Mütterchen, das ihm begegnete, was die tiefe Trauer und Totenstille zu bedeuten habe.
Das Mütterlein antwortete: »Weil morgen des Königs einzige Tochter sterben muß«, und helle Tränen rollten über die abgemagerten Wangen der Alten. Hans fragte: »Warum soll sie sterben? Ist sie todkrank?« Das alte Mütterlein sprach: »Nein, aber der siebenköpfige Drache, der alljährlich einmal kommt und dem man eine Jungfrau geben muß, wird heute noch daher fliegen, und dieses Mal hat das Los die Königstochter getroffen. Morgen wird sie zur Kapelle geführt, wo sie der Drache in Empfang nimmt.«
Hans fragte: »Aber warum tötet man nicht den Drachen?« Da sprach das Mütterchen: »Mein Kind, du hast leicht reden. Der König hat dem, der das Untier erlegt, die Hand seiner schönen Tochter versprochen, aber niemand will sein Leben gerne verlieren.«
Da dachte sich der Schleifersohn, vielleicht kannst du dir die Königstochter erwerben, und fragte, wo die Kapelle sei. Das alte Mütterlein beschrieb ihm den Weg zur Kapelle, und Hans bedankte sich dann und nahm von der Alten Abschied. Er wartete nicht lange und stieg mit seinen drei Tieren auf den Drachenberg, wo die Kapelle stand.
Es dauerte nicht lange, und das Untier brauste schon durch die Luft daher und schoß auf die Kapelle zu. Dort war aber Hans mit den drei Tieren, und er hetzte diese auf den Drachen los. Doch dieser spie Feuer aus und wollte ihn mit seinen scharfen Krallen packen. Da waren aber auch die drei Tiere nicht faul und sprangen auf das Höllentier los und Hans führte so gewaltige Streiche, daß der geflügelte Wurm einen Kopf nach dem anderen verlor.
Dann trabte der Bär auf dem Drachen herum und zertrat das Ungetüm. Hans aber schnitt aus den sieben Drachenköpfen die Zungen, wickelte sie in sein Sacktuch und ging in die Kapelle. Er war vom Kampf so müde und matt geworden, daß er sich kaum aufrecht halten konnte und sehr nach Schlaf begehrte. Dann wollte er in die Stadt gehen und den Kampfpreis holen.
Kaum hatte sich aber der Schleifersohn in der Kapelle niedergesetzt, kam die Königstochter. Sie war ganz schwarz gekleidet, und ihr Gesicht war bleich wie eine Mauer, denn sie fürchtete den Tod sehr. Wie groß war da ihre Freude, als sie den Drachen in seinem Blut liegen sah. Sie kannte kein Maß und kein Ende ihres Jubels und ging in die Kapelle, um dort Gott für ihre Rettung zu danken. Darin fand sie aber Hans mit seinen drei Tieren, an dem sie gleich den Drachentöter erkannte.
Sie fiel vor ihm auf die Knie nieder, dankte ihm unter Tränen und wollte ihn gleich zu ihrem Vater in die Stadt führen. Hans war aber so matt, daß er ihren Wunsch nicht erfüllen konnte, wohl aber bald nachzukommen versprach. Sie gab ihm deshalb ihr goldenes Ringlein, Halskettlein und seidenes Halstuch zum Andenken und sprach: »Du darfst diese Stücke nur in der Stadt vorzeigen, und man wird dich zum König führen, der dich für meine Rettung reich belohnen wird.« Dann dankte sie noch einmal und eilte freudig und in der Hoffnung, daß ihr Retter bald nachkommen werde, in die Stadt hinab.
Hans schlummerte vor Müdigkeit bald ein. Da beschlossen seine drei Tiere, ihn zu bewachen, und losten, wer von ihnen wach bleiben und den Herrn hüten müsse. Das Los traf den Fuchs, und Wolf und Bär legten sich nun auch nieder, denn auch sie waren müde und schläfrig und schnarchten bald mit ihrem Herrn um die Wette. Aber auch der Fuchs hatte den Kampf mitgemacht, und ihm fielen die Augen ein über das andere Mal zu, bis der Schlummer ihn vollends übermannte und er trotz allen Widerstrebens einschlief.
Unterdessen hatte der König einen Diener ausgeschickt, ob die Prinzessin gerettet worden sei oder nicht. Wie aber der Diener vor das Stadttor gekommen war, begegnete ihm die Königstochter mit freudestrahlendem Gesicht und erzählte ihm, wie sie gerettet worden sei und daß ihr Retter in der Kapelle droben schlafe.
Als der böse Diener dies hörte, faßte er einen schändlichen Plan, setzte der Prinzessin, die vor Schrecken kreideweiß wurde, einen Dolch auf die Brust und sprach: »Schwöre, daß du mich als deinen Retter überall ausgeben und meine Frau werden willst, sonst bist du ein Kind des Todes!«
Da hatte die arme Königstochter keine Wahl, sie mußte schwören, mochte sie wollen oder nicht, wenn sie nicht auf der Stelle gemordet sein wollte. Der Diener ging aber hinauf zur Drachenkapelle, wo er Hans noch schlafend fand, und hieb diesem das Haupt ab. Dann nahm er die sieben Köpfe des Drachen und nahm sie mit in die Stadt hinunter, um seine Aussage beweisen zu können.
Nach einer Weile erwachten allmählich die drei Tiere. Als sie ihren Herrn ermordet sahen, erhoben sie großen Jammer, und der Wolf wollte durchaus über den pflichtvergessenen Fuchs herfallen und ihn zerreißen. Doch der Bär hielt den Wolf von seinem Vorhaben ab und sagte, er sollte den Fuchs leben lassen. Dieser müsse aber ein Kräutlein holen, mit dem man dem Herrn seinen Kopf wieder anheilen könne.
Der Fuchs war froh, daß er mit heiler Haut davonkam, und machte sich gleich auf den Weg, um das Kräutlein des Lebens zu suchen. Er lief bergab, bergauf, über Stock und Stein, konnte aber das wunderbare Kräutlein nicht finden. Als er schon die Hoffnung aufgegeben hatte, des Kräutleins jemals habhaft zu werden, begegnete ihm eine weiße Hirschkuh, und diese fragte ihn, was er denn so eifrig suche. Der Fuchs teilte ihr ohne Umschweife sein Anliegen mit.
Da sagte die weiße Hirschkuh: »Ich will dir dieses Kräutlein bringen, wenn du dich auf diesen Stein hier setzen und hier warten willst, bis ich komme.«
Der Fuchs setzte sich nun auf den Stein und wartete lange, lange Zeit, bis die weiße Hirschkuh wiederkam und ihm das Kräutlein des Lebens brachte. Da war der Fuchs seelenfroh, dankte seiner
Wohltäterin aufs beste und lief über Wiesen und Felder zur Drachenkapelle zurück, wo er fast atemlos ankam.
Der Bär zerdrückte nun dies Kraut, bestrich mit dem Saft den Rumpf des Herrn und setzte den Kopf darauf, der sogleich festhielt. Das Herz des Schleifersohnes schlug wieder, und er wollte schon erwachen.
Da sah aber der Bär zu seinem großen Schrecken, daß er seinem Herrn den Kopf verkehrt aufgesetzt habe, so daß das Gesicht nach rückwärts schaute. Er riß deshalb den Kopf wieder herab und befahl dem Fuchs, noch einmal das Kräutlein des Lebens zu holen. Dieser lief und lief, bis er wieder die weiße Hirschkuh fand und von ihr das Wunderkräutlein erhielt.
Dann lief er über Stock und Stein zurück, bis er zur Drachenkapelle kam. Da nahm ihm der Bär das Kräutlein ab, zerquetschte es und heilte damit dem Herrn das Haupt glücklich an. Nun erwachte Hans aus seinem schweren Schlaf, sah nach, ob er die sieben Drachenzungen und die Geschenke habe, und ging dann in die Stadt, um sich dem König vorzustellen und seine Belohnung zu verlangen.
Die drei Tiere sprangen lustig und munter hinterdrein. So kam er in die Stadt, wo die größte Freude und der lauteste Jubel herrschte. Hans fragte, was das zu bedeuten habe, und man sagte ihm, daß die Königstochter mit einem Diener, der sie vom Drachen gerettet habe, die Hochzeit feiere.
Hans machte zu dieser Nachricht große Augen, faßte sich aber sogleich und ließ von seinem Verdruß nichts merken. Sobald er sich allein sah, nahm er das Ringlein von seinem Finger, gab es dem Fuchs und sprach: »Lieber Rotpelz, bring das Ringlein der Königstochter!« Der Fuchs ließ sich das nicht zweimal sagen und schlich an den Ecken und durch die Winkel der Gassen zum Königsschloß hin.
Dort ging er in ein Gemach, wo die Prinzessin war, und legte ihr das Ringlein vor. Die Königstochter hatte die größte Freude, küßte das Ringlein und gab dem Überbringer einen Honigkuchen. Der Fuchs kehrte, mit seinem Botenlohn zufrieden, zu seinem Herrn zurück. Dann gab Hans das goldene Halskettlein dem Wolf und sprach: »Lieber Wolf, bring das Kettlein der Königstochter.« Der Wolf ließ sich das nicht zweimal sagen und trug das Kettlein zur Königstochter, die ihm ein großes Stück Fleisch gab. Zufrieden damit kehrte der Wolf zu seinem Herrn zurück.
Hans gab nun dem Bären das seidene Halstuch und sprach: »Lieber Bär, bring das Tüchlein der Königstochter.« Der Bär trottete sogleich in das Schloß des Königs und brachte der Prinzessin das seidene Tüchlein. Daran sah nun die Königstochter, daß ihr Retter noch lebte und in der Nähe war. Sie war deshalb ganz selig, bediente den Bären mit Zuckerbrot und gab ihm dann ein Brieflein folgenden Inhalts an seinen Herrn mit: »Komm schnell hierher, wenn ich nicht die Gemahlin eines schändlichen Betrügers werden soll!«
Als Hans das Brieflein erhalten hatte, ging er auf der Stelle mit seinen drei Begleitern in die Königsburg, wo es gar festlich und freudig zuging. Überall machte man ihm aus Furcht vor den drei Tieren Platz, und er kam bis zum Saal, wo der König, seine Tochter und ihr vermeintlicher Retter bei der Tafel saßen. Als Hans die Saaltür öffnete, stürzten die drei Tiere wütend auf den schändlichen Diener los und zerrissen ihn in kleine Fetzen.
Die Königstochter eilte aber, als sie den Hans sah, ihrem Retter entgegen, führte ihn zu ihrem Vater und erzählte nun, wie sie durch einen Eid gebunden gewesen sei, den falschen Diener für ihren Retter auszugeben. Der König hatte die größte Freude, gab dem Hans seine Hand und hieß ihn, sich zu seiner Rechten setzen.
Hans setzte sich zur Tafel, und das Fest wurde zum Hochzeitsfest. Die drei Tiere saßen auch an der Tafel, bekamen Speise und Trank und erzählten jetzt, wie sie ihren Herrn gerettet hätten. Da wurde nun getrunken und gezecht, gesungen und musiziert bis spät in die Nacht. Als sich dann Hans mit seiner königlichen Braut im Schlafzimmer befand, schaute er, weil der Mond so hell schien, in den Garten hinunter.
Da sah er einen großen, schönen Rehbock, der mitten in den Beeten graste. Hans sagte zu seiner Braut: »Den muß ich haben«, griff nach seinem Gewehr und eilte mit seinen Tieren die Stiege hinab und in den Garten. Alles Rufen und Bitten der Prinzessin, er möchte doch bleiben und den Rehbock Rehbock sein lassen, war vergebens.
Hans sprengte über Stock und Stein dem flüchtigen Rehbock nach, und die Tiere folgten ihm. Als er das schöne Wild lange verfolgt hatte, verschwand es plötzlich. Hans sah sich in einer unwirtlichen Gegend, und dazu versteckte sich der Mond hinter den Wolken. Endlich erblickte Hans in der Ferne ein kleines Licht.
Er ging darauf zu und kam zu einer niedrigen, halb zerfallenen Hütte. Darinnen fand er ein kleines, altes Mütterchen, das zwischen vielen Steinen saß und sich kämmte. Als sie den stattlichen Jüngling mit den drei Tieren sah, lächelte sie und fragte Hans, ob sie die Tiere streicheln dürfe. »Oh, vom Herzen gerne«, sagte Hans, »sie sind ganz heimisch und beißen nicht.«
Da langte die Alte nach einem Stäbchen, berührte damit die Tiere - und sogleich waren sie in Stein verwandelt. Dann verhexte sie auch den Hans, denn es war eine böse Zauberin, die in Gestalt eines schönen Rehbocks viele Tiere und Menschen in ihre Hütte lockte und sie in Stein verwandelte.
Die Königstochter wartete umsonst auf ihren Gemahl und weinte und jammerte, daß es einen Stein hätte rühren mögen. Allein all ihr Klagen und Trauern war vergebens, denn niemand konnte ihren Gemahl finden. Da zog sie Trauerkleider an und lachte nie mehr.
Unterdessen war das Jahr zu Ende gegangen. Der jüngere Schleifersohn hatte sich auch in der Welt herumgetrieben und war ein leidenschaftlicher Jäger geworden. Auf seinen Jagden hatte er sich auch drei Tiere, einen Fuchs, einen Wolf und einen Bären, zu Begleitern erworben, die ihm in allen Gefahren beistanden.
Er dachte oft an seinen Bruder und kehrte, als das Jahr um war, zur großen Eiche an der Gabelung des Weges zurück. Da fand er nicht den Bruder, wohl aber das Messer, das rostig im Baum stak. Er lenkte deshalb, ohne sich lange zu besinnen, auf den Weg zur Rechten ein und kam am zweiten Tag in die Stadt, wo sein Bruder die Königstochter befreit hatte.
Als die Einwohner der Stadt ihn und seine drei Tiere sahen, glaubten sie, es sei der vermißte junge König, und an allen Ecken und Enden wurde gejubelt: »Der junge König ist wieder da!« Alsbald war die Freudenbotschaft auch ins Schloß gedrungen. Da eilten der König und seine Tochter ihm voll Freude entgegen, empfingen ihn aufs freundlichste und bestürmten ihn mit Fragen, wo er so lange gewesen sei.
Der Schleifersohn gab für jetzt ausweichende Antworten und war nur darauf bedacht, auf kluge Weise Nachrichten über seinen Bruder einzuholen. Er ließ sich deshalb für seinen Bruder ansehen und behandeln und folgte der Königstochter und ihrem Vater auf das Schloß. Dort wurde ein Freudenmahl angerichtet und das Wiederfinden des jungen Königs auf festliche Weise gefeiert. Die Tafel dauerte bis spät in die Nacht. Dann ging man erst zu Bett.
Als der Schleifersohn mit der Königstochter im Schlafzimmer war, blickte er, weil der Mond so hell schien, in den Garten. Da sah er einen herrlichen Rehbock in den Beeten grasen. Sogleich erwachte in ihm die Jagdlust, und er sagte zur Königstochter, er müsse diesen Rehbock haben, sonst könnte er nicht schlafen. Da bat ihn die Prinzessin doch zu bleiben, sonst gehe es ihm wie früher und er müßte vielleicht wieder ein ganzes Jahr fortbleiben.
Nun wußte der vermeintliche König genug, nahm seine Flinte und rief die drei Tiere. Dann schwang er sich aufs Roß und verfolgte durch dick und dünn, über Stock und Stein das flüchtige Tier. Wie er endlich nach langem Jagen das Wild auf Schußweite erreicht hatte, war es auch verschwunden, und er befand sich in einer wüsten, unbekannten Gegend.
Da erblickte er auch bald die Hütte, ging auf sie zu und fand darin das alte Mütterchen zwischen den sonderbaren Steinen. Sie lächelte ihm zu, aber ihm wurde ganz unheimlich zumute, als er sie näher betrachtete und sah, wie sie nach ihrem Stäbchen langte, herum trippelte und sich den Tieren nähern wollte. Da wurde ihm die Sache klar, und er rief der Unholdin mit donnernder Stimme zu: »Wo ist mein Bruder, verfluchte Hexe? Wenn du es mir nicht sagst, haue ich dir Hände und Füße ab.«
Sie tat aber, als ob sie gar nichts wüßte, stellte sich sehr unschuldig und versuchte, die Tiere zu berühren. Darob wurde der Jüngling zornig, zog seinen Hirschfänger und hieb der Alten Hände und Füße ab. Jetzt begann sie zu flehen und zu wimmern und gelobte, alles zu gestehen. Sie sagte zum Jäger, er solle aus dem Schrank eine Salbe nehmen und die Steine bestreichen, dann würde sein Wunsch erfüllt werden.
Er tat, was sie geraten hatte, nahm vorsichtig die Salbe, bestrich die Steine, und bald stand Hans lebend mit den drei Tieren vor ihm. Er bestrich noch die übrigen Steine, und viele edle Herren wurden da erlöst. Diese fielen nun über die böse Hexe her und töteten sie vollends. Die zwei Brüder machten sich dann mit ihren Tieren auf den Weg in die Stadt.
Auf dem Weg aber entspann sich ein Streit, wer von ihnen die Prinzessin zur Frau haben sollte. Hans glaubte, das meiste Recht habe er, weil er sie von dem Drachen befreit habe. Der jüngere verlangte sie aber für die Erlösung des Bruders. Während sie so stritten, kamen sie zu einem Fluß, den sie in einem Nachen übersetzen mußten.
Da sie aber statt des Ruderns sich zankten und einander in den Haaren lagen, verlor der Nachen das Gleichgewicht, und beide Brüder fielen in das Wasser, wo sie jämmerlich ertranken.
Die Königstochter wartete diesmal vergebens auf die Rückkehr ihres Gemahls, und wenn sie nicht gestorben ist, wartet sie noch heute.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
DIE VERSTORBENE GERECHTIGKEIT ...

Vor langer Zeit lebte ein gewaltig reicher und mächtiger Graf, dem alles nach seinem Kopf gehen mußte. Er fragte nicht nach Recht und Billigkeit, sondern schaltete und waltete nur nach Willkür.
Da kam er einmal auf einem Spazierritt zu einem großen, schönen Landhaus, das ihm gar sehr in die Augen stach. Er besichtigte deshalb das ganze Gehöft und ritt dann vor das Haus hin, wo eben der Bauer, dem das Anwesen gehörte, unter der Haustür stand. Der Graf grüßte ihn freundlich, stieg vom Roß und sprach: »Guter Freund, möchtest du mir nicht deinen Hof zu kaufen geben? Ich würde ihn sehr gut bezahlen.«
Der Bauer aber bedachte die Frage nicht lange und antwortete: »Euer Gnaden, nichts für ungut. Aus dem Handel wird nichts, denn auf diesem Hof saßen meine Voreltern schon, und ich will auch darauf meine alten Tage zubringen. Also nichts für ungut!« Da sagte der Graf: »Ich will dir bis morgen Bedenkzeit lassen. Überleg es dir gut.« Dann stieg er auf sein Pferd und sprengte von dannen.
Der Bauer blieb aber bei seinem Vorhaben, schüttelte den Kopf und dachte sich: Daraus wird nun einmal nichts. Am folgenden Tag kam der Graf schon in aller Frühe daher geritten und fragte, ohne abzusteigen, den Bauern, was er jetzt beschlossen habe. Da antwortete der Bauer: »Ich habe, Euer Gnaden, meinen Entschluß nicht aufgegeben. Ich bleibe auf meinem Hof, und aus diesem Handel wird nichts.«
Da wurde der Graf wild und sprach: »Ich frage dich noch einmal, ob du dein Anwesen gutwillig hergeben willst. Wo nicht, so bekomme ich es doch!« Der Bauer schüttelte jedoch seinen Kopf und erwiderte: »Dabei bleibt es, ich verkaufe meinen Hof nicht.« Nun wurde der Graf ganz wild vor Zorn und sprengte mit seinem Roß auf und davon.
Er ritt spornstreichs zu einem Advokaten, bestach ihn mit vielem Gold und ließ dem Landmann einen Prozeß anhängen. Die Richter wußten, daß der Graf ein steinreicher Mann war und bei dem Handel Geld herausschaute. Deshalb hielten sie zu dem Grafen und versprachen ihm, das Bäuerlein mürbe zu machen. Sie ließen nun den Bauern durch den Gerichtsdiener herbeiholen und fragten ihn, ob er seinen Hof verkaufen wolle oder nicht.
Als er ein entschiedenes Nein erwiderte, wurde ihm eine Klageschrift vorgelesen, und es wurde ihm gesagt, wenn er den Hof behalten wolle, so müsse er mit dem Herrn Grafen einen Prozeß führen. Der einfältige Bauer, der sich nicht zu helfen wußte, ging darauf ein und ließ sich die Sache gefallen. Der Graf hatte einen pfiffigen Advokaten, der Bauer hatte aber keinen, weil er sparen wollte.
Da wurde nun hin und her prozessiert und der Bauer so oft in die Stadt gerufen und übertölpelt, bis er ganz verschuldet war. Die Richter entschieden auch gegen ihn, so daß er vom Hof mußte und ihm nur mehr hundert Gulden blieben. Er fügte sich in die traurige Geschichte, machte aber den Richtern bittere Vorwürfe und sprach: »Wenn auf Erden keine Gerechtigkeit mehr ist, so lebt droben noch ein Richter, der euch finden wird.«
Da lachten die Herren, und einer sagte: »Ja, die Gerechtigkeit ist lange gestorben; die kann dir nicht helfen.« Der betrogene Bauer ging dann schweigend aus der Kanzlei hinaus und begab sich geradewegs zum Kirchenvater. Als dieser den ihm wohlbekannten Bauern kommen sah, rief er ihm freundlich zu: »Grüß dich Gott, Hans! Kommst du auch einmal in die Stadt, mich zu besuchen?«
»Ja«, antwortete Hans, »aber in einer sehr traurigen Lage.« Dann erzählte er dem Kirchenvater die Geschichte und schloß: »Jetzt habe ich noch hundert Gulden, und die gebe ich dir. Es ist gerade so viel Geld, wie man bei euch in der Stadt da zahlen muß, wenn man die große Glocke für einen Verstorbenen läuten läßt. Da hast du das Geld, und jetzt läute schnell der Gerechtigkeit, weil sie gestorben ist, zu ihrem Hinscheiden. Aber läute recht lang.«
Der Kirchenvater nahm das Geld, ging mit seinem Knecht in den Turm und läutete die große Glocke, und zwar länger als gewöhnlich. Da gab es nun in der Stadt ein Gefrage und Gerede, wer gestorben sei, für wen man so lange läute. Doch niemand wußte Bescheid darauf, und die Neugierde wurde immer größer.
Auch der König, der in der selben Stadt seine Residenz hatte, erkundigte sich, wer gestorben sei, konnte aber keine Auskunft erhalten. Da schickte er einen Läufer zum Kirchenvater und ließ ihn fragen, für wen man so lange geläutet habe. Der Kirchenvater sprach: »Für die Gerechtigkeit.«
Der Läufer eilte mit dieser Antwort zum König zurück. Wie der König dies hörte, wurde er rot vor Zorn und rief: »Die Gerechtigkeit ist nicht gestorben. Sie schläft nur, und ich will ihr neues Leben einhauchen.« Dann ließ er den Kirchenvater holen und frage ihn, wer die große Glocke für die verstorbene Gerechtigkeit habe läuten lassen.
Dieser sprach: »Eure Majestät, der Schauferle - Hans, der früher Schauferle -Bauer war.« Wie der König dies erfahren hatte, ließ er sogleich den Schauferle-Hans herbeiholen und fragte ihn, warum er die Glocke habe läuten lassen. Da erzählte Hans, wie er des Grafen wegen von Haus und Hof gekommen war, weil die Gerechtigkeit nicht mehr lebe.
Der König war über die Richter ganz ergrimmt, machte kurzen Prozeß und gab dem Bauern sein Eigentum zurück. Dann ließ er den Grafen, den pfiffigen Advokaten und die bestochenen Richter rufen, die Sache untersuchen und verurteilte allesamt zum Tod.
Sie wurden in Gestalt einer Glocke aufgehängt, und in ihrer Mitte zappelte der Graf. Seitdem aber kam die Gerechtigkeit wieder zum Leben, und die Richter sprachen Recht, wie es sich geziemt.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, bei Reutte
KUGERL ...
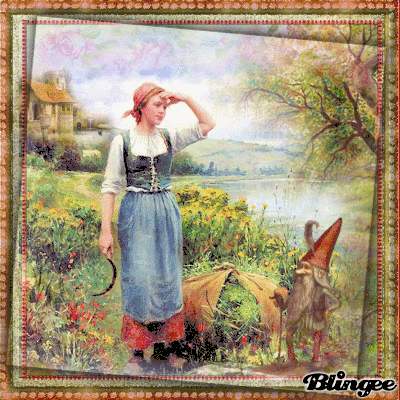
Beim Sandhügel droben hauste vor langer Zeit ein Wichtlein. Es war kaum drei Spannen groß und lief immer nur im Hemd umher, so daß sich die Leute oft darüber ärgerten. Sonst legte aber das Zwerglein den Menschen nichts in den Weg, sondern tat ihnen manchen Dienst. Es hackte ihnen Streu, hütete die Kühe und half bei Arbeiten zu Hause und auf dem Feld. Auch gab er den Kranken heilsame Kräuter und rettete manches Kind vor dem Tod.
Einmal wurde eine schöne Bauernmagd von einem Stier gestoßen, und sie erhob darob ein großes Geschrei und rief um Hilfe. Da kam alsbald das freundliche Wichtlein herbei, tröstete sie und versprach ihr Hilfe und Rettung, wenn sie seine Braut werden und mit ihm in das Wichtleinreich kommen wolle. Da blieb ihr keine Wahl, sie sagte ja, und auf diese Zusage wurde sie vom Wichtlein gerettet.
Sie hätte nun mit dem Zwerglein in den Berg kommen sollen, allein dazu hatte sie gar keine Lust. Sie bat deshalb das Wichtlein, es möchte sie doch loslassen, und versprach ihm dafür ein schönes, rotes Röcklein. Da sprach das Zwerglein: »Rotes Röcklein entbehre ich leicht. Wenn du aber meinen Namen binnen dreier Tage errätst, sollst du deines Versprechens frei und ledig sein.«
Das Mädchen war mit diesem Bescheid zufrieden und ging nach Hause. Es dachte nun die ganze Nacht über den Namen des Zwergleins nach, konnte ihn aber nicht finden. Am folgenden Tag ging die Magd hinauf zum Sandhügel, wo sich das Wichtlein aufhielt. Da sagte sie allerlei Namen her, allein keiner war der richtige, und das Zwerglein sagte: »Geh nun nach Hause und denk besser nach.«
Die Magd kehrte heim und dachte Tag und Nacht daran, wie etwa das Männlein heiße. Am folgenden Tag ging sie wieder hinauf zum Sandhügel, wo sie das Zwerglein fand. Dann sagte sie viele, viele
Namen, doch keiner war der wahre.
Das Zwerglein sprach: »Geh nach Hause und denk besser nach, sonst bist du morgen mein Weib.«
Da ließ die Magd ihr Köpfchen hängen und kehrte traurig und betrübt heim. Sie hatte die Hoffnung, den Namen des Zwergleins je zu erraten, aufgegeben. Doch wo die Not am höchsten, ist die Hilfe am nächsten. Ein Bauernbursche arbeitete auf dem Feld nahe bei dem Sandhügel und legte sich, als die Mittagstunde da war, hinters Gesträuch, um sich auszuruhen.
Da kam das Wichtlein, das niemanden in der Nähe wähnte, aus seinem Erdloch heraus, patschte in die Hände und tanzte im Hemdchen herum. Dabei sang es gar lustig:
»Gott sei Lob und Dank,
Daß meine Braut nicht weiß,
Daß ich Kugerl heiß.«
Dann hüpfte es auf, juchzte und sang von neuem:
»Gott sei Lob und Dank,
Daß meine Braut nicht weiß,
Daß ich Kugerl heiß.«
Dem Bauernburschen gefiel dieses Treiben des Zwergleins, und als er abends in das Haus der Magd zum Heimgart kam, erzählte er lachend, was er heute auf der Wiese beim Sandhügel gesehen und gehört hatte. Da war die Magd über die Maßen froh und hatte keine Angst und Sorge mehr. Am folgenden Tag ging sie früh morgens zum Sandhügel hinauf und nahm auch ein rotes Röcklein für das Zwerglein mit, denn sie wollte ihm für ihre Rettung doch etwas geben.
Als das winzige Männlein sie kommen sah, hatte es die größte Freude und fragte: »Jetzt sag mir, wie ich heiße!« Die Magd sprach: »Putzli.« Da lachte das Zwerglein und fragte noch einmal. Die Magd sagte: »Rudi.« Da lachte das Wichtlein, daß es zitterte, und sprach: »Rat noch einmal!« Da erwiderte das Mädchen: »Heißt du etwa Kugerl?« und gab ihm das rote Röcklein.
Da fing das Zwerglein an zu weinen und zu jammern und ging mit dem Röcklein in den Wald hinaus. Seit jener Stunde ließ es sich nie mehr sehen, und niemand weiß, wohin es gekommen ist.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Höttingen
GRISELDELE ...
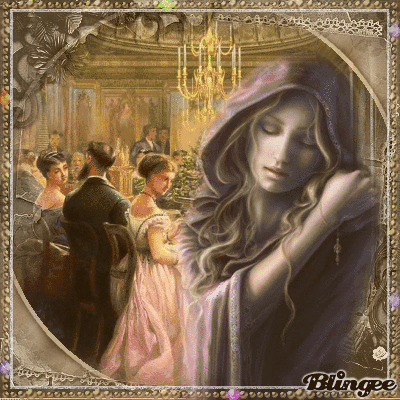
Es war einmal ein armes, altes Bäuerlein, das hatte drei Töchter, die jüngste davon hieß Griseldele. Das Griseldele war weit schöner als seine zwei Schwestern und war auch so brav und fleißig, daß jeder Mensch darüber staunte. Sie mußte immer auf den Berg gehen und hüten, war aber mit dem Hüten allein nie zufrieden, sondern nahm sich immer noch eine andere Arbeit mit, um ja nie müßig zu sein.
Unten am Berg stand ein Grafenschloß, darin lebte ein junger Graf, der noch unverheiratet war und eben daran dachte, wen er etwa zur Gräfin ausersehen sollte. Er sah das Griseldele alle Tage auf den Berg fahren und wunderte sich nicht nur über ihre Schönheit, sondern noch viel mehr über ihren Fleiß und ihre Sittsamkeit. Da kam ihm denn einmal in den Sinn: Das fleißige, sittsame Mädchen sollst du zur Gemahlin nehmen; denn eine bessere findest du nicht, soweit der Himmel blau ist.
Dieser Gedanke setzte sich immer mehr in seinem Kopf fest, und er war bald entschlossen, das Griseldele zu seiner Frau zu nehmen. Er ließ alles zur Hochzeit zurechtmachen, sagte aber keinem Menschen etwas, wer diejenige sei, die er zur Braut ausersehen habe. Als alles in Ordnung war und zur Hochzeit nichts mehr mangelte als die Braut, da befahl er seinen Bedienten, in den Stall zu gehen und die Rosse zurechtzurichten, damit er seine Braut abholen könnte.
Als der Wagen zur Abfahrt bereitstand, hieß er alle weg gehen, denn er wollte nicht, daß jemand mit ihm fahre und darauf komme, daß die Braut nur von gemeinem Stand sei. Als alle weg waren, trug er schöne Frauenkleider, die er in der Nähe versteckt hatte, in den Wagen, setzte sich auf und fuhr von dannen. Er kam bald in die Gegend, wo das Bäuerlein mit den drei Töchtern wohnte.
Das Haus selbst aber stand nicht an dem Weg, sondern ein ziemliches Stück abseits. Da bog er nun von der Straße ab und fuhr zu dem Haus hin.
Das Bäuerlein, das eben vor dem Haus Holz spaltete, wunderte sich über die Kutsche, die daher kam, und dachte: Der hat schön den Weg verfehlt, da muß ich ihm doch entgegenlaufen und sagen, daß er
umkehrt.
Augenblicklich legte er die Hacke beiseite und lief der Kutsche entgegen. Schon von weitem deutete er mit dem Arm, daß der Fuhrmann umkehren sollte, und als er nahe kam und den Herrn sah, sagte er: »Fahren Sie nur gleich zurück, Sie sind ganz auf dem falschen Weg; da kommen Sie ja nirgends hin als zu meiner Hütte hinüber.«
Der Herr lächelte und sagte kurz: »O nein, Vaterle, ich bin schon auf dem rechten Weg.« Hiermit gab er den Rossen einen leichten Schlag und fuhr noch viel lustiger dahin als früher. Das Bäuerlein kehrte auch wieder um und lief der Kutsche nach. Als der Herr beim Haus ankam, wartete er auf das Männlein und fragte es dann, ob es nicht etwa drei Töchter habe.
»Drei Töchter habe ich wohl«, antwortete das Männlein. »Nun, so heiße sie herausgehen.« Das Bäuerlein wunderte sich sehr, warum der Graf die drei Töchter begehre, aber zu fragen getraute er sich nicht, und er mußte nun einmal seinen Willen tun, wenn er auch nicht wußte, warum. Er ging hinein und holte die Töchter.
Da kamen die älteren zwei heraus in ihrem grauen Gewand, das sie immer anhatten. Der Graf sah, daß die rechte nicht darunter war, und fragte das Bäuerlein: »Hast du nicht noch eine? Du hast ja gesagt, daß du drei hast? Wo ist denn die dritte, daß sie sich nicht sehen läßt?«
Das Bäuerlein entschuldigte sich und sagte: »Das Griseldele habe ich auch gebeten, herabzugehen, es ist mir aber um alles in der Welt nicht gegangen, weil es sich gerade so viel geschämt hat.« »Heiße sie nur doch herausgehen«, sagte der Herr, »und sage ihr, ich möchte sie durchaus sehen, und sollte sie so schlecht gekleidet sein, wie sie wollte.«
Das Bäuerlein ging hinein, um sie zu holen, und endlich kam das Griseldele im grauen Kittel heraus. Sie scheute sich so vor dem fremden Herrn, daß sie brennrot war im ganzen Gesicht, aber dem Grafen gefiel es so weit besser, als wenn sie recht frech und keck vor ihn getreten wäre. Er erkannte sogleich, daß es die jenige war, die er sich schon lange gewünscht hatte, und fragte sie, ob sie seine Frau werden möchte.
Man weiß wohl, daß sie anfangs meinte, es sei nur Spaß und der gräfliche Herr habe sie zum besten. Wie er aber zwei-, dreimal die selbe Frage wiederholte und ihr hoch und teuer versicherte, daß es sein voller Ernst sei und die Leute schon auf die Hochzeit warteten, da fing sie an, es nach und nach zu glauben, und stotterte ein verschämtes Ja.
Der Graf dankte ihr, gab ihr die schönen Kleider aus dem Wagen und sagte, sie sollte jetzt das graue Kittele weg werfen und das seidene Gewand dafür anziehen. Da ging das Griseldele in seine Kammer, und als es in den seidenen, Gold gestickten Kleidern herauskam, da leuchtete seine Schönheit erst recht, und der Graf sah wohl ein, daß er nicht nur die bravste, sondern auch die schönste Braut gefunden habe.
Er gab nun ihrem Vater und den zwei Schwestern reiche Geschenke, damit sie doch zufrieden seien, weil er sie nicht zur Hochzeit laden wollte. Dann hieß er das Griseldele einsteigen, kehrte um und fuhr lustig in sein Schloß. Als er in den Hof kam, lief alles an den Wagen, um die unbekannte Braut zu sehen. Jedermann wunderte sich über die Schönheit der Jungfrau, aber kein Mensch getraute sich, den Grafen zu fragen, wo er sie geholt habe.
Das Griseldele wußte nicht, wie ihm war unter den vielen vornehmen Leuten, und wenn es nicht den Grafen sogleich lieb gewonnen hätte, so hätte es sich über neunundneunzig Meilen hinweg gewünscht. Es wurde nun die Hochzeit mit aller erdenklichen Pracht gefeiert, und der Graf und das Griseldele lebten von nun an als Mann und Weib in Frieden und Liebe beisammen.
Es dauerte ein Jahr, da schickte ihnen der Herr ein Kindlein zu, und das war ein Mädchen. Kaum war es auf der Welt, ging der Graf zum Griseldele hin, bemühte sich, ein finsteres Gesicht zu machen, und sagte: »Jetzt gib mir nur sogleich das Kind, ich will es in den Abgrund werfen, damit die Leute nichts davon erfahren. Ich muß mich ja lange schon schämen, daß ich dich zur Frau genommen habe, wie müßte mir erst zumute sein, wenn ein Kind aus dieser Ehe mein Erbe werden sollte.«
Wie weh die Rede und das Verlangen des Grafen dem Griseldele taten, das kann man sich wohl denken. Sie sagte aber kein Wort, unterdrückte dem Gemahl zuliebe ihren Schmerz, bekreuzigte und küßte das Kind und gab es ihm. Er nahm es, setzte sich damit in eine Kutsche und fuhr weit fort zu braven Leuten. Diesen gab er das Kind und trug ihnen auf, es vor allem zu taufen und in der Taufe Maria zu nennen.
Dann sollten sie es fleißig ernähren und erziehen, er werde schon alles gut bezahlen und von Zeit zu Zeit nachsehen kommen, wie es seinem Töchterlein ginge. Als er alles in Ordnung hatte, fuhr er wieder heim, ging zu seiner Gemahlin und sagte: »Jetzt wird wohl kein Mensch mehr etwas erfahren davon, weil ich es heimlich in den Abgrund hinab geworfen habe.«
Dem Griseldele ging bei diesen Worten wieder ein tiefer Stich durch das Herz, und sie hätte bittere Tränen weinen mögen, unterdrückte aber ihren Schmerz gewaltsam und ertrug alles voll Demut und aus Liebe zu ihrem Herrn.
Nach einem Jahre bekam sie wieder ein Kind, und das war ein Knabe. Kaum war er auf der Welt, so kam der Graf zur Gräfin, machte ein finsteres Gesicht und sagte: »Jetzt gib mir sogleich den Buben, damit ich ihn in den Abgrund werfen kann. Ich bin so vor den Leuten nimmer sicher, weil ich dich geheiratet habe, was würden sie erst sagen, wenn ich ein Kind, das dir so gut angehört wie mir, als meinen Erben aufziehen wollte?«
Griseldele sagte wieder kein Wort, nahm das Knäblein, bekreuzigte und küßte es und reichte es ihm hin. Er ging damit fort, setzte sich in eine Kutsche und fuhr damit zu den nämlichen Leute, zu denen er auch das Mädchen gebracht hatte. Diesen übergab er das Kind, trug ihnen auf, ihm in der Taufe den Namen Johann zu geben und es ordentlich zu erziehen.
Dann fuhr er heim, ging zur Gräfin und sagte: »Ist gut, daß der Bub jetzt im Abgrund liegt, damit doch die Leute davon nichts erfahren.« Griseldele sagte wieder nichts, so tief ihr auch diese Rede in der Seele weh tat.
Der Graf fuhr öfter hin, zu sehen, wie es den Kindern ginge, sagte ihnen auch, als sie es verstehen konnten, daß er ihr Vater sei, und hatte eine große Freude, als er sah, daß sie recht kräftig heranwuchsen und von den fremden Leuten so tugendhaft erzogen wurden, daß er wegen ihres Wohles nicht die geringste Sorge zu haben brauchte.
Griseldele aber erfuhr nie etwas von ihren Kindern und dachte oft mit Schmerz daran, wie fein sie es jetzt hätte, wenn die zwei Kinder noch am Leben wären. Sie ließ aber nie ein Wort der Klage hören, sondern ergab sich geduldig und demütig in ihr Geschick.
Siebzehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes kam der Graf einmal zum Griseldele und sagte: »Jetzt hilft es nichts mehr, du mußt aus dem Schloß. Die Leute wundern sich schon alle, daß ich dich so lange hier leiden mochte, und sind wild über mich, weil ich mein Geschlecht so verunehrte. Geh du wieder heim, leg dein graues Kittele an und schicke das gräfliche Gewand zurück.« Griseldele erschrak über diesen Befehl, wurde aber nicht zornig, sondern nahm Abschied von ihrem Gemahl, als ob er ihr immer nur Gutes getan hätte.
Schweigend verließ sie das Schloß und machte sich auf den Weg, der Heimat zu. Da hatte sie allerlei schwere Gedanken und fürchtete sich, der Vater werde vielleicht lange schon tot sein. Und was werden erst meine Schwestern sagen, dachte sie, wenn ich erzähle, daß mich der Graf verjagt hat. Sie werden mich auslachen und mir mein Unglück gönnen, weil ich mich früher so hoch über sie erheben wollte.
Mit solchen Gedanken ging sie der Heimat zu und kam endlich in dem Bauernhäuslein an. Da hatte sie doch eine Freude, weil sie den Vater noch am Leben traf und ihm ihr tiefes Herzeleid klagen konnte. Sie bat ihn dann, er möge sie wieder bei sich behalten, sie wolle gern alle Arbeit tun und sich gar nicht anmerken lassen, daß sie einmal etwas anderes gewesen sei als das arme Griseldele.
Der Vater erbarmte sich über sie, sprach ihr Trost zu, hieß sie bleiben und sagte: »Leg nur an das graue Kittele,
Und iß mit mir ein Überschüttele.«
Griseldele zog nun wieder ihr graues Kittele an und schickte die kostbaren seidenen Kleider dem Grafen ins Schloß zurück. Sie lebte wieder wie früher, bei bäurischer Arbeit und ländlicher Kost, und wenn sie auch mit Liebe und Sehnsucht an ihren Gemahl zurückdachte, so hoffte sie doch nicht, jemals wieder in das Grafenschloß zurückzukehren.
Da bekam sie einmal von ihrem Gemahl einen Brief, darin hieß es, sie solle so gleich in das Schloß kommen und alle Böden spülen, denn es müsse im Schloß alles gesäubert werden, weil er aufs neue Hochzeit halten und sich mit einer Braut vermählen wolle, die so schön sei wie die Sonne. Griseldele besann sich keinen Augenblick, ging in das Schloß, rutschte dort im grauen Kittele auf allen Böden umher und spülte den ganzen Tag wie die gemeinste Bauernmagd.
Als sie alle Böden im ganzen Schloß gespült hatte, kam einmal der Graf zu ihr und sagte: »Ich will jetzt gehen, meine Braut zu holen, du kannst während der Hochzeit in der Küche abspülen oder sonst tun, was man dir anschafft.« Griseldele sagte kein unwilliges Wort, wünschte ihm Glück zur Reise und blieb in dem Schloß.
Daraufhin fuhr der Graf mit einer schönen Kutsche zu seinen Kindern und führte sie in das Schloß. Er verbot ihnen aber so lange, ihn Vater zu nennen, bis er wieder die Erlaubnis dazu geben würde. Auch gab er ihnen sonst Weis' und Lehre, wie sie sich zuerst im Schloß zu benehmen hätten, und sagte besonders der Tochter, sie solle gerade so tun, als ob sie seine Braut wäre.
Sie kamen nun in das Schloß, und jedermann staunte über die Schönheit der neuen Braut. Der Graf hieß Griseldele kommen, stellte ihr die schöne Jungfrau vor und sagte: »Nicht wahr, diesmal
habe ich eine schöne und vornehme Braut?«
Griseldele antwortete wenig und dachte bei sich: Schön und vornehm ist sie wohl, aber ich wünsche ihr Glück zu einer solchen Ehe.
Nun sollte vor allem der Handschlag gefeiert werden, und von nah und fern kamen die geladenen Gäste herbei. Während der Mahlzeit sagte der Graf auf einmal: »Sagt zum Griseldele, jetzt soll sie einmal auftragen, und zwar frisch vom Abspülen weg im schmutzigen Gewand und grauen Kittele.«
Die Bedienten gingen hinaus und sagten das dem Griseldele. Sie erschrak über diesen Befehl und ließ den Grafen bitten, er sollte ihr doch das nachsehen. Er aber schickte noch einmal hinaus und befahl ihr, sie solle nur so gleich mit der nächsten Speise hereinkommen. Da gehorchte sie ohne weitere Widerrede und trug in ihrem schmutzigen Gewand und grauen Kittele ein Gericht herbei.
Da sah sie nun den Grafen neben der schönen Jungfrau sitzen, und auf seiner anderen Seite saß ein schöner Jüngling, den sie aber eben so wenig erkannte wie die vermeintliche Braut. Als sie wieder hinausgegangen war, sagte der Graf zu seinen Kindern:
»Jetzt dürft ihr mich Vater heißen, und die eben aufgetragen hat, sollt ihr beim nächsten Eintreten als eure Mutter begrüßen. Sie hat ihre Probe ausgehalten und lange Zeit gelitten; jetzt aber soll des Leidens ein Ende sein, und wir wollen alle zusammen ein freudiges Leben führen.«
Sobald sie das nächste Mal hereinkam, hörte sie, wie die Braut und der Jüngling den Grafen ihren Vater nannten, und als sie die Schüssel auf den Tisch gestellt hatte, da sprangen ihr alle drei entgegen und nannten sie und begrüßten sie als Gemahlin und Mutter.
Der Graf hieß sie nun ihre gräflichen Kleider wieder anziehen und sich zu ihnen an den Tisch setzen. Jetzt wurde die Hochzeit mit Ernst gefeiert, und Griseldele hatte von nun an keine schlimmen Tage mehr, sondern nur frohe und glückliche.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, von einer Passeierin in Meran
DER WURM ...
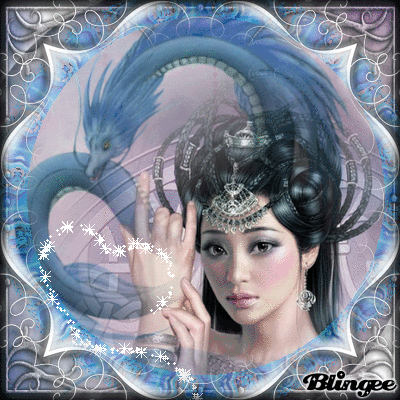
Es war einmal ein Jäger, der hatte ein Weib und viele Kinder, aber dabei eine sparsame Schüssel. Die Wirtschaft machte ihm viele Sorgen, und er hätte gern alles selbst getan, was es von Männerarbeit in und außer dem Hause zu tun gab; allein er machte es doch nicht recht und mußte bei seinem schmalen Einkommen auch noch einen Knecht halten.
Mit der Jägerei ging es ihm, wie es jedem geht; heute bekam er etwas, morgen wieder nichts, und wenn er sich den ganzen Tag müde gelaufen hatte, so mußte er oft abends mit leerer Tasche heimgehen. Nicht weit von seinem Haus war ein großmächtiger Berg, und auf diesem jagte er am häufigsten und am liebsten, weil er da doch am leichtesten ein Wild zu sehen bekam.
Da sah er einmal, als er auf diesem Berg jagte, oberhalb des Fußsteigs einen Menschen liegen. Der Hund sprang hinzu, rannte mit lautem Bellen um den Liegenden herum und tat so wild, als ob er ihn zerreißen wollte. Der Jäger hatte genug zu tun, ihn zurückzuhalten, es kam ihm aber ganz sonderbar vor, daß der Hund, der sonst niemandem etwas zuleide tat, mit solcher Wut über diesen Menschen herfiel.
Während der Hund um ihn herumbellte, erhob sich der Liegende ein wenig und sagte zum Jäger: »Sei doch so gut und gib mir diesen Hund zu kaufen.« »Nein«, sprach der Jäger, »diesen Hund brauche ich selbst, und kann ihn dir nicht geben. Ich habe aber noch einen zu Hause, den kannst du bekommen, wenn es dir um einen Hund gerade zu tun ist.«
»Ist schon recht«, sagte der Liegende, »gib mir nur den anderen zu kaufen. Aber morgen gerade um diese Zeit mußt du ihn herbringen, dann wollen wir den Handel schließen. Hast du gehört - gerade um diese Zeit.« Der Jäger gab sein Wort darauf, ging dann mit seinem Hund davon und jagte noch eine Weile auf dem Berg. Weil er aber gar nichts bekam, so ließ er das Herumlaufen gut sein und machte sich auf den Heimweg.
Als er nach Hause kam, ging er vor allem, seine Frau zu grüßen, und erzählte ihr, daß er den Hund, den er doch nie auf die Jagd mitnehme, verschachert habe. Die Jägersfrau war froh darüber und sagte: »Hättest ihm den anderen schon auch lassen können; wir geben unser Brot besser den Kindern zu essen, als daß wir damit die Hunde füttern.«
Am anderen Tag, als es gegen die bestimmte Zeit ging, sagte der Jäger: »Ich muß jetzt mit dem Hund hinausgehen, sonst könnte der Mensch nicht warten, und mit dem Handel wäre es nichts.« Er lockte den Hund, den er dem Menschen versprochen hatte, und wollte gehen.
Da lief sein dreizehnjähriges Töchterlein herbei und schrie: »O Vater, laßt mich auch mitgehen!« »Aber warum willst du denn gerade heute mitgehen?« fragte der Jäger. Das Mädchen wußte darauf keine Antwort zu geben, hörte aber nicht auf zu bitten, daß es mitgehen dürfe. Inzwischen kam auch die Jägerin herbei und half dem Mädchen, so daß der Vater endlich einwilligte und es mitgehen ließ.
Sie gingen nun hinaus auf den Berg und kamen zu dem Steig, an welchem der Mensch gestern gelegen hatte. Heut lag aber dort ein unbändiger Wurm, so daß dem Jäger bang wurde und er sich gleich dachte, mit dem Menschen, den gestern der Hund angebellt hatte, sei es nicht richtig gewesen. Er nahm sein Töchterlein an der Hand und sagte: »Geh, wir wollen umkehren. Mir ist schon gestern der Mensch nicht richtig vorgekommen, und heute liegt anstatt seiner ein Wurm da.«
Das Mädchen fürchtete sich auch, reichte ihm gerne die Hand, und sie wollten gehen. Da regte sich der Drache, schoß auf das Mädchen los, umschlang es mit dem Schweif und fuhr damit in den Berg hinein. Der Jäger war völlig starr geworden vor Schreck und schaute dem Ungetüm nach. Jetzt reute es ihn, daß er keine Büchse mitgenommen hatte; denn wäre er bewaffnet gewesen, so hätte er dem Drachen wohl doch was Gesalzenes auf die Haut gebrannt.
Das bloße Nachschauen half aber nichts, und er mußte sich endlich entschließen, nach Hause zu gehen und die traurige Botschaft zu bringen. Als er heimkam und mit dem verstörten Gesicht seiner Frau begegnete, fragte diese sogleich: »Wo hast du denn das Mädel gelassen, daß du es nicht mitbringst?«
Da kamen dem Jäger die Tränen in die Augen, und er erzählte weinend, was ihm begegnet war. Als die Jägersfrau das hörte, erschrak sie sehr, jammerte im ganzen Haus herum und sagte in einem fort: »Wir haben das Kind viel zuwenig gesegnet, sonst hätte es ihm nicht so übel ergehen können.«
Am anderen Tag ging der Jäger wieder hinaus auf den Berg, durchstreifte ihn den ganzen Tag nach allen Richtungen und meinte, er müsse eine Spur seines Kindes entdecken. Allein er fand nicht einmal ein Stücklein Gewand und mußte abends unverrichteterdinge wieder heimgehen. Allein er ließ sich nicht abschrecken, sondern ging noch oft und oft hinaus, suchte alle Winkel und Löcher durch und dachte auch beim Schießen immer an seine Tochter.
Aber kein Suchen wollte etwas helfen, und es vergingen sieben Jahre, ohne daß er nur die mindeste Spur des Mädchens entdeckt hätte. Nach sieben Jahren trug es sich zu, daß der Jäger mit seinem Knecht auf den Berg jagen ging. Da sahen sie ein schönes Wild vorüber rennen, setzten ihm nach und meinten es bald zu bekommen.
Das Wild aber war immer gerade so weit von ihnen, daß sie nicht zu Schuß kamen, verlor sich aber nie ganz aus ihren Augen. Sie meinten, das Wild müßten sie heute noch kriegen, möchte es gehen, wie es wollte. So liefen sie ihm lange Zeit vergebens nach und merkten nicht, daß es schon zu dämmern anfing. Erst als es völlig Nacht war, hielten sie an, und der Jäger sagte zum Knecht: »Jetzt haben wir uns schön verspätet, es ist schon Nacht, und wir kommen nimmer heim.«
»Das ist mir gleich«, sagte der Knecht, »es ist ja nicht kalt, und wir können auf dem Boden hier eben so gut schlafen wie daheim im Bett.« »Nein«, sprach der Jäger, »auf den Boden hier lege ich mich nicht. Es ist ja gerade heute sieben Jahre her, daß der Wurm mein Töchterlein weg getragen hat, und wenn wir da auf dem Boden lägen, so könnte es uns wohl auch passieren, daß ein Wurm oder sonst eine Bestie über uns herfällt und uns zerreißt.«
»Wart ein bißchen«, erwiderte der Knecht, »ich will da auf einen Baum hinauf steigen und herumschauen, ob ein Haus in der Nähe ist.« Da lachte ihn der Jäger aus und sagte: »Jawohl, ein Haus in der Nähe! Ich kenne den ganzen Berg von oben bis unten und weiß ganz gewiß, daß hier herum kein Haus ist.«
Der Knecht ließ sich aber nicht abhalten, stieg auf den Baum und schaute umher. »Siehst du«, rief er auf einmal, »gerade ein bißchen ober uns sehe ich ein Licht, da oben ist gewiß ein Haus, wo wir über Nacht bleiben können.« Dem Jäger kam das sonderbar vor, weil er nur gar zu gut wußte, daß in dieser Gegend weit um keine menschliche Seele ihre Wohnung hatte.
Der Knecht stieg schleunig vom Baum herab und sagte: »Jetzt wollen wir hinauf gehen zu dem Licht und schauen, ob uns die Leute droben ein Obdach geben.«
Der Jäger hatte keinen Schneid, mitzugehen, weil aber der Knecht nicht nachgab und ihn auslachte, entschloß er sich endlich, und sie stiegen beide den Berg hinauf.
Sie waren kurze Zeit gegangen, da funkelte das Licht ganz hell zwischen den Ästen durch, und der Jäger sah jetzt wohl, daß der Knecht richtig gesehen hatte. Allein es wurde ihm nur desto banger, weil er gewiß wußte, daß hier sonst niemals ein Haus stand, und seine Angst wurde noch größer, als sie einige Schritte vorwärts gegangen waren und ein herrliches Schloß vor ihnen stand, aus dem ihnen das Licht entgegen strahlte.
Der Knecht blieb stehen und sagte: »Jetzt siehst du, wer von uns beiden recht gehabt hat. Das habe ich mir gleich gedacht, wenn ein Licht am Berg ist, so ist ein Haus auch dabei. Wir wollen nun hinaufgehen und die Leute um Unterkunft bitten.« Der Jäger riet ihm davon ab und sprach: »An diesem Platz bin ich oft gewesen, aber da ist niemals ein Schloß gestanden. Glaub mir, das ist nichts Rechtes. Wir wollen lieber umkehren und auf einem Baum übernachten.«
Der Knecht ließ sich nicht abhalten und sagte, er wolle einmal hineingehen, und sei es, was es wolle. Dann muß ich halt auch mitgehen, dachte sich der Jäger und stieg mit dem Knecht zur Tür hinauf. Sie gingen hinein, der Knecht mutig voraus, der Jäger verzagt hinten nach. Da kam ihnen eine wunderschöne Jungfrau entgegen und fragte sie, was sie wollten.
Der Knecht nahm das Wort und sagte: »Wir haben uns im Wald verspätet und kommen nimmer nach Hause. Dürften wir nicht um eine Nachtherberge bitten?«
»O ja«, erwiderte die Jungfrau, »über Nacht bleiben könnt ihr genug, aber nur eins sage ich euch: Ihr dürft euch weder grausen noch fürchten.« »Wenn es weiter nichts ist«, sagte der Kecht,
»dann können wir wohl über Nacht bleiben, denn grausen und fürchten tun wir uns gar nicht.«
Das konnte der Knecht wohl von sich sagen, aber der Jäger hinter ihm dachte ganz anders, obwohl er jetzt den Mund hielt und sich in das Schicksal fügte. Die Jungfrau führte nun die beiden hinauf in ein Zimmer. Sie hieß sie da nieder setzen, ging dann in die Küche und brachte ihnen zu essen. Die zwei aßen mit gutem Appetit, und es kam ihnen gar kein Grausen.
Während sie aßen, brachte die Jungfrau einen Bottich und stellte ihn im Zimmer nieder. Dann ging sie um Wasser und trug so lange Wasser herein, bis der Bottich voll war. Die zwei wußten nicht, was das zu bedeuten habe, und der Jäger fürchtete sich noch immer im stillen.
Da kam auf einmal ein abscheulicher Wurm zur Tür herein und stürzte sich in den Bottich, daß das Wasser hoch aufspritzte. Der Jäger fürchtete sich jetzt noch mehr, denn soviel er ausnehmen konnte, war das der nämliche Wurm, der ihm vor sieben Jahren die Tochter geraubt hatte.
Jetzt ging die Jungfrau zum Bottich und fing an, den Wurm fleißig zu waschen. Je länger sie wusch, desto roter wurde das Wasser, und zuletzt war es so rot, als ob lauter Blut in dem Gefäß wäre. Da mußten sich die zwei am Tisch stark zusammen nehmen, daß ihr Herz nicht anfing zu flattern.
Als die Jungfrau den Wurm sauber gewaschen hatte, half sie ihm heraus. Da hub er an zu reden und sprach: »Jungfrau, möchtest du mich nicht heiraten?« »Nein«, sagte sie, »das kann ich nicht, du bist ja ein Wurm, und ich bin ein Mensch.« Er fragte sie noch einmal: »Jungfrau, tätest du mich nicht heiraten?« Sie aber sagte wieder: »Nein, das kann ich nicht, du bist ja ein Wurm, und ich bin ein Mensch.« Da fragte er sie zum dritten Male: »Jungfrau, möchtest du mich denn gar nicht heiraten?«
Da konnte sie es ihm nicht mehr abschlagen, sondern erbarmte sich über ihn und sagte: »Weil du nicht nachgibst, so will ich dich halt nehmen. Ich habe dich sieben Jahre gewaschen, nun werde ich dich wohl noch eine Weile waschen können.«
Kaum hatte sie das gesagt, war der Wurm verschwunden, und es stand anstatt seiner ein wunderschöner Jüngling vor ihr, der ihr als Bräutigam die Hand bot und sagte: »Du hast mich jetzt erlöst, zum Dank dafür will ich dich wirklich zur Frau nehmen und dir ein angenehmes Leben bereiten. Zeug und Sachen haben wir in dem Schloß genug, und das Schloß selbst wird auch nicht mehr verzaubert sein, wie es bisher war.«
Dann führte er die Jungfrau vor den Jäger und fragte ihn: »Kennst du dieses Mädchen?« Der Jäger sagte: »Wie sollte ich sie kennen?« »Schau sie einmal gut an«, sprach der Jüngling, »und sage, ob es nicht etwa deine Tochter ist. Sieben Jahre, bevor sie auf die Welt kam, war ich schon verbannt. Dreizehn Jahre mußte ich warten, bis ich sie auf mein Schloß brachte, und sieben Jahre hat sie mich täglich waschen müssen.
Jetzt ist der Zauber aus, und ich nehme sie zu meiner Gemahlin. Ihr alle braucht jetzt keine Not mehr zu leiden, und auch wenn du noch mehr Kinder hättest, als du wirklich hast, würde mein Gut wohl ausreichen, für sie zu sorgen.«
Der Jäger wußte nicht, wie ihm geschah, als er dies alles mit anhörte, er schaute bald die Jungfrau, bald den Jüngling an und konnte es fast nicht glauben, daß die Frau sein Kind, der andere sein künftiger Schwiegersohn sein sollte. Aber wenn er seinen Augen trauen wollte, so mußte er doch glauben, daß seine Tochter wirklich vor ihm stehe, und warum er dem Jüngling nicht glauben sollte, das wußte er auch nicht.
Er war völlig außer sich vor Freude, sprang auf, umarmte beide und dankte lange Zeit, daß alles so gut abgelaufen war. Am anderen Tag gingen sie alle miteinander ins Jägerhaus und stellten sich der Jägersfrau vor und erzählten ihr die ganze Geschichte. Diese hatte eine solche Freude, daß es gar nicht zu sagen ist, und beeilte sich, die Anstalten zur Hochzeit zu treffen. Wie alles in Ordnung war, wurde die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert.
Von nun an hatten die Jägersleute bei dem Gemahl ihrer Tochter das beste Leben, und alle miteinander waren fein bis an ihr Ende.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DIE ZWEI BEUTELSCHNEIDER ...
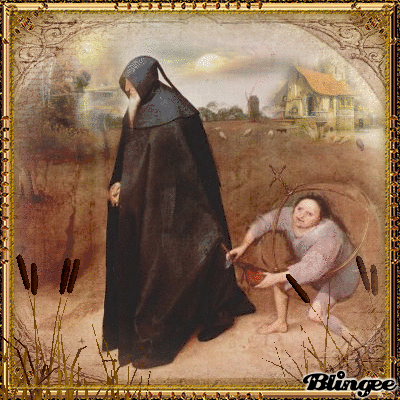
Es waren einmal zwei Beutelschneider, die beide in ihrer Kunst etwas Rechtes verstanden. Der eine von ihnen wohnte in Preußen und der andere in Polen. Die zwei hörten oft voneinander, und es bekam jeder Begierde, den anderen zu sehen. Sie dachten beide: Wenn der andere seine Kunst so gut versteht, so tun wir uns zusammen; wir richten zu zweit mehr aus, als wenn jeder sein Handwerk allein betreibt.
Jeder ging nun aus, den anderen zu suchen. Nach einiger Zeit begegneten sie sich, ohne einander zu kennen. Da rief zuerst der Pole: »Woher, guter Freund?« »Aus Preußen; und woher denn
du?« »Ich aus Polen. Was ist denn dein Handwerk?«
»Ich bin Beutelschneider; und was bist denn du?« »Ich bin auch Beutelschneider.«
Da merkte jeder, daß er zum Rechten gekommen war, und sie machten aus, mitsammen zu gehen und einander aus zu helfen, wo einer allein nicht ausreichen würde. Sie verabredeten vor allem eine Probe, woran jeder erkennen sollte, daß er am anderen einen guten Gehilfen habe.
Sie machten aus, zu einem Barbier zu gehen, und während dieser den einen von ihnen rasiere, sollte ihm der andere die Eisen vom Absatz des Stiefels reißen, ohne daß er es merke, und während er den anderen rasiere, solle ihm der eine die Eisen wieder annageln, auch ohne daß er es merke. Sie versprachen einander, wenn jeder diese Probe vollbringe, so wollten sie beieinander bleiben und einander beistehen im Guten und Schlechten.
Sie gingen also zum Barbier, ließen sich den Bart abnehmen, und richtig, während er den einen rasierte, stahl ihm der andere die Eisen von den Stiefeln, und während er den anderen rasierte, schlug sie ihm der eine wieder an. Er merkte aber von allem nichts und rasierte so sicher, als ob mit seinen Stiefeln gar nichts vorginge.
Die Beutelschneider gingen nun hinaus, lobten einander und versprachen, als gute Freunde beisammen zu bleiben. Und zwar ging der Preuße mit dem Polen und blieb bei ihm. Dieser hatte aber eine Schwester, die gab er dem Preußen zur Ehe, und sie führten jetzt eine Wirtschaft, so ehrlich, wie man sie bei Beutelschneidern finden kann.
Ihr Gewerbe betrieben sie nur, wenn sie nichts mehr zu essen hatten, außerdem ließen sie die Säcke der Leute in Ruhe und genossen, was sie sich früher zusammen getragen hatten.
Nun erfuhren sie, daß ein Herr in einem Turm haufenweise Geld habe, daß aber nur eine einzige, eiserne Tür sei, durch die man hinein kommen könne. Das machte aber den Beutelschneidern nichts, denn sie wußten schon andere Schliche, mit denen sie in den Turm hinein zu kommen gedachten.
Sie gingen aus, nahmen Haue und Schaufel mit sich und gruben einen unterirdischen Gang in den Turm. So kamen sie von unten leicht hinein und beschauten sich einmal das viele Geld. Da lagen die Kornsäcke in Menge, aber anstatt des Kornes war überall Geld drinnen und so fest gepackt, daß sich kein Stück bewegte, wenn man den Sack aufhob.
Sie nahmen einen schweren Sack, krochen wieder in ihr Loch zurück, machten es oben ein wenig zu und kamen dann glücklich ins Freie. Den Sack trugen sie in der Nacht heimlich nach Hause und freuten sich, daß ihnen dieser Streich so gut gelungen war.
Da kam eines Tages der Herr in seinen Turm, zählte die Säcke und fand, daß einer abhanden gekommen sein mußte. Er wunderte sich, wie das zugegangen war, und er konnte sich nicht erklären, wie jemand bei verschlossener Tür in den Turm hinein-, geschweige denn samt dem großen Sack hinaus gekommen war.
Aber wenn er auch selbst nicht wußte, was er bei der Sache denken sollte, so wußte er dafür einen anderen, der sich in solchen Dingen prächtig auskannte und um einen klugen Rat nicht verlegen war. Er hatte nämlich schon früher einmal einen Beutelschneider gefangen, diesem hatte er, anstatt ihn der Obrigkeit zu überliefern, die Augen ausgestochen und ihn bei sich behalten.
Er meinte nämlich, ein Beutelschneider, wenn es ein rechter sei, müsse den Kopf am rechten Fleck haben und könne auch anderen mit seinen Pfiffen zu gelegener Zeit aushelfen. Zu diesem ging er nun hin, erzählte ihm von der Beraubung seiner Schatzkammer und fragte ihn, wie man etwa den Schelmen auf die Spur kommen könnte.
»Oh, die sind gewiß durch den Boden herauf gekommen«, sagte der blinde Beutelschneider. »Grabe nur ein bißchen hinab, und wenn du ein Loch findest, so brauchst du nichts anderes zu tun, als ein Schlageisen aufzustellen, das seine sechs bis sieben Zentner wiegt. Dann werden die Spitzbuben hineingehen.«
Der Herr dankte ihm für den klugen Rat, ging hin, ließ ein bißchen hinab graben, und richtig kamen sie gleich zu einem Loch, durch das die Schelme herein gekommen waren. Er war herzlich froh über diese Entdeckung, ging so gleich zum Schmied und bestellte ein schweres Schlageisen. Als der Schmied fertig war, ließ er es in den Turm tragen und auf das Loch legen.
Jetzt, dachte er, brauche ich nicht weiter zu sorgen. Die Spitzbuben kommen gewiß noch einmal, und dann gehen sie gewiß in die Falle. Er ging mit seinen Leuten aus dem Turm, schloß ihn gut zu und freute sich schon auf den baldigen Fang.
Als die zwei Beutelschneider eine Zeit lang von dem gestohlenen Geld gezehrt hatten und voraussahen, daß der Sack mit der Zeit einschrumpfen würde, sprachen sie zueinander: »Das Loch haben wir schon einmal gemacht, es ist nun schade, wenn wir es nicht fleißiger benützen. Wir müssen doch noch einmal hingehen und dem reichen Kerl wieder einen Sack wegtragen!«
Sie machten sich als bald auf, kamen zu dem Turm und krochen durch das Loch hinein. Der Preuße kroch voraus, der Pole hinterdrein. Als sie eben meinten, in den Turm hinauf zu gelangen, da tat es einen Schlag, und der Preuße schrie: »O weh, ich bin gefangen!«
Der Pole erschrak darüber und fragte, was ihm denn geschehen wäre.
Der Preuße sagte: »Jawohl, ich bin in ein Schlageisen geraten. Jetzt mach nur ja schnell und schneide mir den Kopf ab. Loskommen tu ich doch nimmer, und dann ist der Kopf ohnedies weg.«
Der Pole sagte: »Nein, Kamerad, dir den Kopf abzuschneiden bringe ich nicht übers Herz. Und was würde erst dein Weib dazu sagen, wenn ich ihr die Nachricht brächte, daß ich selber dir den Garaus gemacht habe?«
Der Preuße hob aber wieder an zu bitten und sagte: »Mach nur nicht lange Umstände. Es soll nicht aufkommen, wer hier eingebrochen hat, du schneidest mir daher den Kopf ab und nimmst ihn mit dir. Tust du es nicht, so muß ich schändlich auf dem Galgen sterben, und du selber bist auch noch in Gefahr, aufzukommen.«
So redete und bat er noch eine Weile fort, bis der Pole endlich nachgab, hinaufkroch und ihm den Kopf abschnitt. Er nahm den Kopf mit sich, kroch zum Loch hinaus und trug ihn heim. Da hättest du hören sollen, wie das Weib des Preußen lärmte, als sie den Kopf ihres Mannes sah und hörte, wie es ihm ergangen war.
Nicht lange Zeit, nachdem der Preuße in die Falle gegangen war, kam der Herr in den Turm, um nachzusehen, ob das Falleisen einen erwischt habe. Zu seiner großen Freude bemerkte er sogleich, daß es zugefallen war, und ging sogleich hin, um zu schauen, wer der Spitzbub sei.
Wie er aber in die Nähe kam, sah er, daß bloß ein Rumpf da war ohne Kopf, und kam gleich auf den Gedanken: Holla, da muß noch einer im Spiel sein, der hätte sich nicht selber den Kopf abschneiden und ihn fort tragen können. Er ging sogleich wieder zu seinem blinden Beutelschneider, erzählte ihm die ganze Sache und verlangte seinen Rat.
»Das ist gewiß, daß da noch einer übrig ist«, sagte der Beutelschneider, »aber warte nur, den wollen wir schon auch kriegen. Nimm den Rumpf aus dem Turm, laß ihn an den Galgen hängen und stelle eine ausreichende Wache dazu. Es ist eines Beutelschneiders Pflicht, keinen Toten über Nacht hängen zu lassen. Kommt nun der andere, seinen Kameraden abzuknüpfen, so wird ihn die Wache schon fassen, und das ganze Spiel hat ein Ende.«
Der Herr dankte für diesen Rat, ging hin, ließ den Rumpf aus dem Turm tragen und an den Galgen hängen. Dazu stellte er zwölf Mann Soldaten und trug ihnen auf, denjenigen, der herbei käme und den Leichnam herunternehmen wollte, zu fangen und vor ihn zu bringen. Die Soldaten versprachen, das zu tun, und umstanden aufmerksam den Galgen.
Der polnische Beutelschneider ging zufällig in der Nähe des Galgens vorbei, sah den Rumpf droben hängen und unten die Soldaten Wache halten. Er dachte sich: Den Toten sollte ich eigentlich über Nacht nicht droben lassen, um so mehr, weil er mein Kamerad ist. Aber so auf geradem Weg werde ich ihn nicht kriegen, denn die Soldaten stehen gewiß nicht umsonst dort. Er dachte ein bißchen nach, wie er es anfangen sollte, und es kam ihm bald ein pfiffiger Einfall.
Er ging in die Stadt, kaufte vom besten Wein, dazu auch Schnaps und andere gute Getränke, schüttelte alles durcheinander und tat auch eine gute Portion Schlafpulver hinein. Dann nahm er ein Rößl und ein Wägele, legte zuerst zwölf Kapuzinerkutten auf, bedeckte sie aber gut, daß sie niemand sah, und obendrauf kam dann das Fäßchen.
Jetzt fuhr er aus der Stadt hinaus und kam in die Nähe des Galgens. Da fing er auf einmal an, zu lamentieren und zu schreien: »Das ist ein schönes Ding, kommt mir denn niemand zu Hilfe, der Wein rinnt alle aus, wie werde ich es kriegen, wenn ich heimkomme.«
Solches Zeug schrie er durcheinander, so laut, daß die Soldaten beim Galgen es hörten. Sie schauten hinab und sagten zueinander: »Seht, da drunten kommt einer mit einem Weinfäßchen. Er schreit und lamentiert gar so, es rinnt ihm gewiß der Wein aus. Gehen wir hinab und helfen wir ihm, vielleicht gibt er uns dafür ein Maul voll zu trinken, dann halten wir das Wachen auch leichter aus.«
Hierauf liefen alle zwölfe hinab, um dem Fuhrmann zu helfen. Als sie der Pole herab kommen sah, zog er schnell einen kleinen Bohrer heraus und bohrte mehrere Löchlein in das Fäßchen. Die Soldaten waren da, hielten zu, wo es heraus rann, schnitzten Späne, verstopften die Löcher und meinten, es müsse bald aufhören zu rinnen. Während sie aber auf der einen Seite zumachten, bohrte der Beutelschneider auf der anderen, so daß es nie aufhörte und alle Arbeiten umsonst waren.
Endlich sagte der Fuhrmann: »Ich sehe schon, den Wein muß ich euch nun lassen. Nehmt das Fäßchen mit euch und trinkt es aus, ich will schnell zurückfahren, damit ich von diesem Wein noch bekomme. Denn brächte ich einen anderen nach Hause, so würde ich gleich aus dem Dienst gejagt.«
Die Soldaten dankten ihm für das Geschenk, faßten das Fäßchen, trugen es zum Galgen hinauf und gingen schleunig, damit nicht viel ausrinne. Dann setzten sie sich herum, waren guter Dinge und tranken, soviel die Gurgel nur schlucken wollte. Sie meinten, einen so guten, starken Wein hätten sie ihr Lebtag nicht getrunken, und zogen darum nur desto besser.
Der Beutelschneider fuhr mit seinem Wagen ein bißchen zurück, machte dann halt und schaute zu, was der Wein für Wirkung tue. Er brauchte nicht lang zu warten, da sah er schon, wie die Soldaten anfingen, die Köpfe sinken zu lassen, und dann einer nach dem anderen sich ins Gras legte. Als sie alle wie tot da lagen, fuhr er hin, nahm die Kapuzinerkutten und legte jedem von ihnen eine an. Dann nahm er den Leichnam vom Galgen, packte ihn auf den Wagen und fuhr damit heim.
Die Soldaten wachten erst auf, als es schon heller Morgen war, sahen einander an und wußten nicht recht, was sie denken sollten. Anstatt der Soldaten waren lauter Kapuziner herum, neben ihnen wohl gar ein Galgen, aber kein Toter daran, kurzum - die Sache kam ihnen so sonderbar vor, daß sich ihre nebligen Köpfe nicht sogleich auskannten.
Als sie aber das Fäßchen sahen und sich recht auf den gestrigen Abend besannen, da wurde es ihnen wohl klar, daß sie des Trankes wegen das Wachen vergessen hatten und daß es der Fuhrmann sein müsse, der den Leichnam vom Galgen gestohlen hatte. Es half aber nichts, sie mußten sich endlich doch entschließen heimzugehen, stellten sich vor den Herrn, erzählten ihm, wie es ihnen ergangen war, und baten ihm hundertmal ab.
Der Herr wurde zornig, schimpfte sie eine Zeit lang aus, dachte aber dann doch wieder: Ja, was will ich ihnen denn machen? Sie sind halt auch hintergangen worden, und man kann es den armen Teufeln nicht gar so verargen, wenn sie sich bei einem guten Tropfen Wein nicht lange besinnen. Er ließ sie laufen, und ging nun wieder zu seinem Ratgeber, dem blinden Beutelschneider. Diesem erzählte er die Sache und bat ihn noch einmal um seinen Rat.
Der Beutelschneider machte ein bedenkliches Gesicht und meinte: »Das ist noch ärger, da kann es sein, daß ich mit meiner Kunst nicht mehr auslange. Aber ein Mittel gibt es noch. Laß einem Hirsch die Hörner vergolden und jage ihn durch die Stadt. Wenn ein Beutelschneider einen Hirsch mit vergoldeten Hörnern sieht, den kann er nicht lassen und ließe lieber sein Leben als den Hirsch.«
Der Herr dankte für diesen Rat, ließ einen Hirsch bringen und ihm die Hörner vergolden und jagte ihn hinaus auf die Gassen der Stadt. Die Stadttore aber wurden gesperrt, daß das Tier nicht fort laufen könnte. Der Pole schaute eben zum Fenster hinaus und sah den Hirsch mit den goldenen Hörnern. Da kam ihm große Lust, ihn zu haben, und er sann sogleich auf Mittel, wie er ihn unbemerkt erwischen könnte.
Es fiel ihm ein, daß sein Keller unter den Weg hinausreichte, so daß man von unten herauf den Boden der Straße leicht dünner machen könnte. Er ging in den Keller, grub so lange nach oben, bis nur mehr ein ganz dünner Boden übrig blieb, ging dann auf die Straße und streute Salz auf. Dann lief er wieder in den Keller hinab und schaute zum Kellerloch herauf, ob der Hirsch nicht bald käme.
Er wartete nicht lange, da kam das Tier heran gerannt, stand aber beim Salz still und begann es aufzulecken. Da nahm der Beutelschneider einen Prügel und stieß ihn von unten herauf, so daß der Boden einbrach und der Hirsch drunten lag. Dann machte er den Boden sogleich wieder zu, und das alles geschah, ohne daß jemand etwas merkte.
Der Herr erfuhr, daß der Hirsch auf den Gassen nicht mehr zu sehen war, und ließ Kundschaft einziehen, wer ihn gefangen habe. Allein niemand wußte etwas zu sagen, und kein Mensch hatte jemanden beobachtet, der dem Hirsch nachstellte. Sie sagten alle: »Ja, da und da habe ich den Hirsch zum letzten Male gesehen, er lief allein durch die Gassen, und ich bemerkte niemanden, der ihn verfolgte.«
Da sah der Herr wohl, daß das Nachfragen nichts helfe, und ging wieder zu seinem blinden Ratgeber. Diesem erzählte er die Sache und fragte, was etwa weiter zu tun sei. Der Beutelschneider schnitt ein noch bedenklicheres Gesicht als das vorige Mal, meinte aber, es gebe doch noch ein Mittel, dem Spitzbuben auf die Spur zu kommen.
Er sagte: »Ich will morgen von Haus zu Haus gehen und um Suppe betteln; bekomme ich dann irgendwo eine Hirschsuppe, so rieche ich das gleich, und der Schelm ist erwischt.« Dem Herrn gefiel diese List, und er bat den Beutelschneider, er sollte morgen nur fleißig herumgehen und kein Haus auslassen.
Am anderen Tag machte sich der Blinde auf den Weg, tappte straßauf, straßab, ging überall hinein, wo er eine Haustür griff, und bettelte bei allen Leuten um Suppe. Er roch allemal fleißig, merkte aber niemals einen Hirschgeruch. Als es gegen Abend ging, kam er auch in das Haus des polnischen Beutelschneiders und bat um Suppe.
Der Pole aß gerade einen Hirschbraten, und der Duft stieg dem Blinden gleich in die Nase. Der Pole merkte sogleich, daß der Bettler ein Beutelschneider war, dachte aber: Du bist ja blind, wie willst du mich übertölpeln. Er ließ ihm Suppe geben, lud ihn dann auch zum Braten ein und erzählte ihm während des Essens die ganze Geschichte von dem Hirsch, den er gefangen und heute gebraten habe.
Der Blinde aß mit großem Appetit, und als er genug hatte, dankte er wie jeder ordentliche Lotter. Während er hinausging, dachte er: Ich muß aber doch auch das Haus markieren, und als er zur Tür kam, schrieb er mit einem Rötel drei Striche oberhalb der Haustür.
Der Pole schlich ihm nach, sah die drei Striche und wischte sie ab. Dafür ging er, als es ganz finster war, zu dem Haus des Herrn und schrieb dort die drei roten Striche über die Tür.
Der Blinde kam nach Hause und erzählte seinem Herrn mit Freuden, daß er jetzt den Spitzbuben wohl ausfindig gemacht habe. »Aber weißt du wohl auch das Haus noch, wo du das Hirschfleisch gegessen hast?« fragte der Herr. »O ja, das Haus habe ich schon gezeichnet, schicke nur morgen, wenn es Tag wird, herum, und wo über der Tür drei rote Striche stehen, da wohnt der Schelm.«
Der Herr meinte jetzt, alle Sorgen los zu sein, freute sich sehr und dankte dem Blinden für seine Dienste. Am anderen Tag schickte er Leute aus, die das Haus mit den roten Strichen aufsuchen sollten. Sie gingen in der ganzen Stadt herum, schauten fleißig oberhalb jeder Haustür und meinte, jetzt müßten sie die roten Striche sehen. Sie fanden sie aber nirgends und kehrten unwillig wieder heim.
Als sie ins Haus hinein gehen wollten, erstaunten sie nicht wenig, als sie da die drei Striche erblickten. Sie gingen zu dem Herrn und meldeten ihm, daß das gesuchte Zeichen sonst nirgends stünde als über seiner eigenen Haustür. Er ging hinaus und sah wirklich die drei Striche. Da merkte er, daß er es hier mit einem ärgeren zu tun habe, dem der Blinde nicht gewachsen war.
Er ließ daher bekanntmachen, jener, der den Sack aus dem Turm gestohlen, den Leichnam vom Galgen genommen und den Hirsch in sein Haus gebracht habe, solle sich melden, er werde für seine Geschicklichkeit eine große Belohnung empfangen.
Der polnische Beutelschneider hörte diesen Aufruf, stellte sich vor den Herrn und sagte, daß er derjenige sei, der die drei Stücke vollbracht habe. Weil sich kein anderer meldete, so glaubte ihm der Herr und gab ihm eine große Belohnung und fragte ihn, ob er nicht als Ratgeber bei ihm bleiben möchte.
Der Pole war sogleich bereit dazu, und seitdem ist er statt des Blinden der Ratgeber des reichen Herrn.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Tscheggelberg
DER BLINDE ...
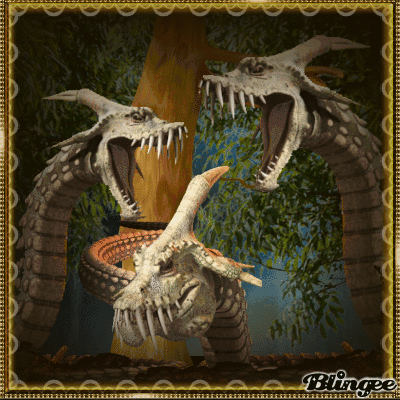
Es war einmal ein reicher, reicher Herr, der hatte aber das Augenlicht verloren und sah höchstens einen matten Schein, wenn das Tageslicht kam oder bei der Nacht ein Licht herbei getragen wurde. Er hatte zwei Kameraden, die mit ihm umher gingen und ihn in die Wirtshäuser führten und anstatt seiner mit den anderen Gästen spielten. Zahlen tat allemal der Blinde, und es war ihm gleich, wie viel er einem blechen mußte, wenn es nur recht lustig herging.
Die zwei meinten es aber nicht redlich mit ihm und redeten eines Tages unter sich ab: »Wie wäre es, wenn wir ihn einmal recht viel Geld mitnehmen hießen und ihn tief in den Wald hinein führten. Wir nehmen ihm dann das Geld und laufen davon, ihn werden die wilden Tiere auffressen, und kein Mensch weiß etwas davon.«
Dieser Plan gefiel beiden über die Maßen, und sie gingen als bald zu ihm hin und sagten: »Da draußen im Wald ist ein neues Wirtshaus, da stellen die Wirtsleute allerlei Lustbarkeiten an, um Gäste hinauszulocken. Weil es gar so lustig hergeht, müssen wir schon auch dabei sein; nimm nur tüchtig Geld mit, und wir wollen uns gut unterhalten.«
Dem Blinden war diese Nachricht erwünscht, er sagte, sie sollten zur beliebigen Zeit kommen und ihn abholen. Die zwei kamen also und holten ihn ab, fragten ihn aber vorher, ob er wohl viel Geld bei sich habe. »Ja, Geld habe ich genug«, sagte er, »geht nur und führt mich hinaus.« Da faßten sie ihn unter den Armen, führten ihn hinaus und taten noch freundlicher mit ihm als andere Male.
Als sie aber im Wald waren, führten sie ihn ins dichteste Gesträuch, fielen über ihn her, nahmen ihm das Geld und rannten davon. Jetzt stand der Blinde allein und verzagt im Wald und wußte nicht, was er in seinem Elend anfangen sollte. Er grabbelte nach allen Seiten herum, erreichte aber nichts als Fichten und Hecken.
Bald verschwand aller lichte Schein vor seinen Augen, und er merkte, daß die Nacht herankam. Da ergriff ihn Furcht, und er dachte, wenn er so auf dem Boden bliebe, so würden ihn die wilden Tiere auffressen. Er wünschte darum, auf einen Baum zu kommen, in der Hoffnung, daß nach glücklich überstandener Nacht vielleicht am anderen Tag jemand kommen würde, ihn zu retten.
Nach kurzem Herumtasten erreichte er einen Baum, faßte ihn und schwang sich hinauf. Er stieg noch ein Stück empor, setzte sich auf einen Ast und hielt sich am Stamm fest. So wartete er ab, was kommen würde, und er brauchte auch nicht lange zu warten, da erhob sich ein schreckliches Geräusch und Getöse. Der Lärm kam immer näher, bis an den Baum, auf dem der Blinde saß.
Am Fuß des Baumes lagerten sich die drei Würmer, die so ungestüm daher gepoltert waren, und fingen nun miteinander zu reden an. Der Linkwurm sagte zum Rechtwurm: »Rechtwurm, was weißt du heute Neues?« Der Rechtwurm antwortete: »Ich weiß, heute Nacht wird ein Tau fallen, und wenn die Blinden es wüßten und sich damit waschen würden, so könnten sie alle ihr Augenlicht wieder bekommen.«
Da sagte der Rechtwurm zum Linkwurm: »Linkwurm, was weißt du?« Der Linkwurm antwortete: »Ich weiß, heute Nacht haben die Hexen dem Bauern da drüben das Vieh krank gemacht. Aber wenn der Bauer wüßte, daß oberhalb des Hauses ein Wasser entspringt, gäbe er dem Vieh davon zu trinken, und es würde wieder gesund.«
Da sprach der Linkwurm zum Haselwurm: »Haselwurm, was weißt du heute Neues?« Der Haselwurm antwortete: »Ich weiß nur, in der ganzen Stadt ist das Wasser ausgeblieben, die Leute müssen weit gehen, wenn sie eins haben wollen, und in der Stadt ist das Wasser teurer als der Wein. Wüßten sie aber, was ich weiß, so wäre ihnen bald geholfen. Mitten durch die Stadt fließt ein Bach, so groß wie ein Mühlbach, und sie brauchten gar nicht tief zu graben, um es zu erreichen.«
Diese Reden der Würmer merkte sich der Blinde gut und er konnte es kaum erwarten, bis er herab steigen und sich mit dem Tau die Augen waschen konnte. Endlich erhob sich am Fuß des Baumes wieder ein Geräusch, und die Würmer entfernten sich mit dem gleichen Lärm, wie sie gekommen waren.
Bald darauf merkte der Blinde einen matten Schein, und er spürte, daß der Tag anzubrechen beginne. Nun grabbelte er wieder mit Händen und Füßen in den Ästen herum und stieg, so schnell als es nur gehen wollte, vom Baum herab. Sobald er drunten war, griff er mit beiden Händen zu Boden, um zu erfahren, ob wirklich ein Tau gefallen war.
Er fühlte sogleich, daß Gras und Gesträuch von reichlichem Tau befeuchtet waren, benetzte damit tüchtig die Hände und bestrich sich die Augen. Da wurde es schon heller vor seinen Blicken, und er konnte allerlei Gegenstände ausnehmen. Er griff wieder in den Tau, wusch sich noch einmal, und als bald sah er so gut, als ob er gar nie blind gewesen wäre.
Es war gerade ein glasklarer Morgen, und er konnte sich an dem blauen Himmel und der grünen Erde beinahe nicht satt sehen. Nun besann er sich ein wenig, was er vor allem tun sollte. Er dachte sich, meine zwei Kameraden will ich einstweilen in Ruhe lassen. Sie sollen mein Geld nur verprassen, ich will schon anderswo einen vollen Beutel kriegen.
Am gescheitesten gehe ich jetzt zum Bauern, dem die Hexen das Vieh krank gemacht haben. Wie gedacht, so getan. Er machte sich auf und ging zu dem Haus des Bauern. Der Bauer begegnete ihm und machte ein mürrisches Gesicht. Er aber grüßte ihn mit einem freundlichen »Guten Morgen!«
»Jawohl, guten Morgen«, gab ihm der Bauer zurück, »woher denn ein guter Morgen, wenn das Vieh krank ist?« »Dein Vieh ist krank?« fragte der Herr, »oh, wenn es nichts weiter ist, so kann ich helfen.« »Ja, wenn du helfen kannst, so will ich dir zahlen, was du begehrst.« Der Herr begehrte eine große Summe und versprach noch einmal, das Vieh gesund zu machen.
Er ging nun ein Stück oberhalb des Hauses hinauf, suchte dort nach und fand wirklich ein sprudelndes Wasser. Davon ließ er etwas in den Stall tragen und dem Vieh zu trinken geben. Kaum hatten die Tiere davon getrunken, so wurden sie gesund, und kein Mensch merkte, daß ihnen je etwas gefehlt hätte. Der Bauer hatte darüber eine gewaltige Freude und gab dem Herrn noch viel mehr zum Lohn, als er verlangt hatte. So waren beide zufrieden, und der Herr ging seines Weges.
Er dachte noch nicht daran, nach Hause zu gehen, sondern wollte zuerst der Stadt das Wasser verschaffen und dadurch seinen Beutel noch fester anfüllen. Er ging in die Stadt und setzte sich in einen Buschen. Die Kellnerin kam und fragte ihn, was er wünsche. »Ich hätte gern einen Wein, aber vor allem will ich ein Glas Wasser.« »O Mensch«, sagte die Kellnerin, »Wasser kann ich dir keines geben. Das Wasser ist bei uns viel teurer als der Wein, weil in der Stadt selber keines fließt und wir es von weither holen müssen.«
Der Herr zeigte sich sehr verwundert darüber, trug aber der Kellnerin auf, sie solle den Wirt rufen und ihm sagen, es sei einer hier, der der Wassernot abhelfen könne. Die Kellnerin ging und kam als bald mit dem Wirt zurück. Dieser fragte den Herrn, ob er wirklich imstande sei, der Stadt Wasser zu verschaffen. »O ja«, sagte er, »geht nur und sagt den Bürgern, was sie mir geben wollen, wenn ich ihnen so viel Wasser gebe, daß an eine Not gar nimmer zu denken ist.«
Der Wirt ging hin und erzählte der Bürgerschaft von dem Herrn, der in seine Schenke gekommen war und der Wassernot abhelfen wolle. Die Bürger waren sehr erfreut darüber, kamen in den Buschen und
baten den Fremden, er solle ihnen nur Wasser verschaffen, bezahlen wollten sie ihm, soviel er nur begehre.
Da ging er mit den Bürgern hinaus, ließ die Stadt ausmessen und suchte dann die Mitte.
Hier stellte er Leute an, zu graben, und kaum hatten sie eine Weile gegraben, da hatten sie schon einen Bach entdeckt, der so groß war wie ein Mühlbach. Da hatten die Bürger eine überaus große Freude, und als der Herr seinen Lohn begehrte, zahlten sie ihm noch mehr, als er verlangte, weil sie dachten, daß eine solche Wohltat mit Gold gar nicht zu bezahlen sei.
Er hatte nun die Reden aller drei Würmer benützt und beschloß, nach Hause zu gehen. Bevor er in sein Quartier ging, suchte er das Wirtshaus auf, in das ihn seine Kameraden oft geführt hatten. Er dachte sich, hier finde ich sie gewiß, die werden dreinschauen, wenn sie mich mit gesunden Augen wiedersehen.
Er ging in die Stube und fand die zwei Kameraden wirklich beim Spielen. Er schaute ihnen eine Weile zu, ohne daß sie ihn erkannten, und sagte dann plötzlich: »Ach, Kameraden, wie geht es? Gewinnt ihr mit meinem Geld?« Die zwei rissen nicht wenig die Augen auf, als sie ihn sahen, wußten aber anfangs doch nicht recht, ob er es wirklich war. Er lachte sie tüchtig aus, sprach ihnen Mut zu und erzählte alles, was ihm seit ihrer Spitzbüberei begegnet war. Nachdem er mit seiner Erzählung fertig war, ging er weg und nach Hause.
Die zwei hatten sich gut gemerkt, was er von den drei Würmern gesagt hatte, und sprachen jetzt zueinander: »Wir gehen auch in den Wald und lassen uns von den Würmern so etwas sagen, damit wir
ebenso reich und glücklich werden wie er.«
Sie gingen hinaus an den nämlichen Ort, wo sie ihren blinden Kameraden beraubt hatten, und stiegen dort auf einen Baum. In der Nacht erhob sich ein Getöse, und es kamen die drei Würmer herbei.
Als sie sich unter den Baum gelegt hatten, huben sie an zu reden, und es sprach der Linkwurm zum Rechtwurm: »Rechtwurm, was weißt du heute Neues?« Der Rechtwurm sagte: »Heute weiß ich sonst nichts, als daß wir das vorige Mal zuwenig achtgegeben haben, und da hat es einer gehört und guten Gebrauch gemacht. Wir sollen also heute besser achtgeben, denn heute sind ihrer zwei droben.«
Da erhoben sich die Würmer und ringelten sich an dem Baum hinauf. Als sie die zwei mit den Zähnen erreichten, bissen sie diese so lange, bis sie herab fielen. Dann ringelten sie sich wieder herab und brachten sie ganz ums Leben.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DER SCHMIEDLERNER ...

Es war einmal ein Schmied, der hatte einen Lerner. Der Schmied schimpfte den Lerner oft aus, weil er von den Leuten hörte, der Bub gehe an Sonntagen immer nur zum hintern Kirchen! Der Lerner verteidigte sich, so gut er konnte, allein der Meister glaubte ihm nicht und drohte ihm einmal im Ernst: »Wenn es noch einmal geschieht, daß du zum hintern Kirchen gehst, so will ich mit dir nichts mehr zu tun haben und jage dich schnurstracks aus dem Haus.«
Der Lerner merkte sich das und nahm sich fest vor, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Als der Sonntag kam und es zum Kirchgang läutete, da war auch der Schmiedlerner schon im Feiertagskleid und wollte zum Gottesdienst gehen. Da kam aber gerade ein Soldat in das Haus, brachte einen zerbrochenen Degen und wollte ihn sogleich gemacht haben.
Der Lerner entgegnete ihm, er könne jetzt den Degen nicht machen, denn es sei Zeit zum Kirchengehen. Der Soldat ließ sich nicht damit abweisen und sagte, er müsse den Degen gemacht haben, sei es dann, wie es wolle. Der Lerner gab endlich nach, sperrte schnell die Schmiede auf, ließ den Blasbalg tüchtig sausen und fing an zu schmieden, daß die Funken nach allen Seiten flogen.
Als bald war die Arbeit getan, und er hatte nur noch des Meisters Siegel darauf zu schlagen. Das war auch bald geschehen, und er gab dem Soldaten seinen Degen wieder. Als aber der Soldat den Degen sah, schauderte er zurück und konnte ihn nicht angreifen. Denn des Meisters Siegel, das der Lerner darauf geschlagen hatte, war ein Kreuz.
Da kam es zum Streit zwischen den beiden Burschen, der Soldat wollte das Kreuz fort haben, der andere aber gehorchte nicht und sagte: »Der Meister macht immer sein Zeichen auf die Arbeit, und ich tue es auch nicht anders; wenn du den Degen so nicht willst, dann mußt du ihn lassen.«
Der Soldat wollte sich mit diesem Bescheid nicht zufriedengeben, der Lerner aber schob ihn zur Schmiede hinaus und machte sich schleunig auf den Weg in die Kirche. Er ging eine kurze Strecke vorwärts, da begegneten ihm schon die Leute, die vom Gottesdienst kamen, und unter den ersten der Schmiedemeister.
Als dieser den Lerner sah, ging er auf ihn zu und schimpfte ihn grob aus. Der Bub wollte sich verteidigen und fing an, die Geschichte von dem Soldaten zu erzählen, aber der Schmied ließ ihn nicht ausreden und sagte: »Ich habe schon genug von dir, du sollst mich nicht noch einmal dran kriegen. Noch allemal haben mir es nur andere Leute gesagt, daß du hinter die Kirche gehst, aber heute habe ich es selbst gesehen, und jetzt hilft dir alles nichts mehr.«
Der Bub sah wohl, daß da nichts zu machen war, und ging trüben Sinnes nach Hause. Beim Mittagessen gab der Meister dem Jungen seinen Abschied und sagte: »Wenn du gegessen hast, dann packe nur gleich zusammen und geh hin, wo der Pfeffer wächst. Ich kann dich nimmer brauchen.«
Der Lerner tat keine Widerrede mehr, weil er wohl sah, daß damit nicht geholfen war, und packte nach dem Essen seine Sachen zusammen. Als er mit dem Bündel aus dem Haus trat, sah er vor der Werkstätte noch den Degen liegen, den er am Vormittag bearbeitet hatte, und dachte sich: Ich nehme ihn doch mit, als ihn unnütz liegen zu lassen, ein Degen ist immer gut zu brauchen.
Er nahm den Degen mit und wanderte nun hinaus in die weite Welt. Durch manches Dorf führte ihn sein Weg und durch manche Stadt, und allenthalben fragte er um Arbeit. Aber all sein Fragen wollte nichts helfen, und so hieß es halt immer weitergehen, wenn auch mit leerem Beutel und hungrigem Magen.
Als er wieder einmal um Arbeit fragte, da wiesen ihn die Leute in ein Schloß, das in der Nähe lag, und erzählten ihm, daß da ein Hütebub nötig sei. »Aber es ist kein gutes Hüten bei dem Schloß droben«, sagten sie, »denn es ist eine verwunschene Alpe auf dem Berg, und da hat ein Hirt keinen guten Stand.«
Der Schmiedlerner achtete nicht viel auf die Warnungen, ging zu dem Grafen und meldete sich als Hirt. Der Graf nahm ihn freundlich auf, erzählte ihm aber ebenfalls, daß es auf der Alpe unheimlich sei und daß schon mehreren Hirten das Hüten nicht gut getan habe.
»Wenn du das Hüten übernimmst, so will ich dich auch ordentlich bezahlen, daß du dich etwa nicht zu beklagen hast. Aber achtgeben mußt du dann schon auch und kein Stück in die verwunschene Alpe hineinlassen, sonst wünsche ich dir Glück.«
Der Lerner dachte sich: Was will ich machen? Arbeit habe ich jetzt keine, und in die Alpe werde ich nicht hineinfahren müssen. »Ist schon recht«, sagte er zum Grafen, »ich will schon hüten und recht aufpassen, daß kein Stücklein in die verwunschene Alm geht.«
Sie waren nun handelseins, und der Schmiedlerner war jetzt Hirtenbub. Am anderen Tag trieb er das erste Mal sein Vieh auf die Weide. Ein Diener des Grafen ging mit ihm und zeigte ihm genau das Mark, wie weit er zu hüten habe und wo die verwunschene Alpe angehe. Der Diener ging dann heim und ließ den Hirten allein bei seiner Herde.
Der hatte aber genug zu tun. Bald lief ein Stück dahin, daß er ihm nachlaufen mußte, bald rannte eins dorthin, und er mußte wieder nachrennen. Der Tag ging ihm schnell vorüber, aber als es anfing, Abend zu werden und es Zeit war zum Heimfahren, da fühlte er auch eine solche Müdigkeit, daß er fast keinen Fuß mehr aufheben konnte.
Am zweiten Tag ging es nicht besser. Das Vieh wollte auf der Alpe des Grafen nicht bleiben, weil da nur schlechte Weide war, und versuchte immer hinüberzuspringen auf die verbotene, weil dort das Gras so hoch stand, daß es einem bis an die Knie reichte. Der Hirt hatte in einem fort abzuwehren, und wenn er das Vieh an einem Ort zurückgetrieben hatte, so mußte er schon wieder an einen anderen hinlaufen und dort mit aller Kraft die Peitsche handhaben.
Als endlich der Abend kam, war er müde wie ein gehetzter Hund und konnte kaum noch die Beine rühren. Er dachte sich: Das ist ein schönes Handwerk, das Schmieden gehört auch nicht zum Leichtesten, aber lieber als an einem solchen Platz Hirt sein, will ich Tag und Nacht auf den Amboß klopfen.
Gegend Abend trieb er müd und unwillig die Herde heim und war herzlich froh, sein Bett zu erreichen, um den matten Leib ein bißchen ausruhen zu lassen.
Am dritten Tag ging es ihm wieder wie am ersten und zweiten. Am vierten Abend endlich, als er sich schon ganz müde gelaufen hatte und das Vieh gar nicht aufhörte, ihn herumzujagen, wurde ihm die
Sache verleidet, und er dachte bei sich:
Was wird denn auf dieser Alm sein? Das Gras ist ja schön, und ich sehe niemanden, der dem Vieh etwas zuleid tun könnte. Das beste ist, ich lasse die hungrigen Dinger einmal hinlaufen; wenn sie genug gefressen haben, werden sie wohl wieder zurückkommen. Kaum hatte er die Geißel beiseite gelegt und sein Laufen eingestellt, da war auch schon die ganze Herde über die Grenze und watete mit gefräßigem Eifer in dem hohen Gras umher.
Es dauerte nicht lange, da legte sich ein Stück nach dem anderen auf den Boden, weil sie auf der fetten Weide bald satt waren. Der Hirt legte sich auch in die Sonne, gerade dort, wo die Grenze zwischen den beiden Almen gezogen war. Er schaute nicht viel um sich, spielte und schnitzte etwas und hatte doch seine Gedanken immer bei der verbotenen Alpe.
Auf einmal klapperten alle Schellen und Glocken, er schaute um und sah die ganze Herde im Rudel daher rennen. Hinterher aber fuhr ein scheußlicher Drache mit langem Hals und aufgesperrtem Rachen. Der Hirt wußte sich schnell zu helfen, stellte sich hinter die nächste Föhre und zückte seinen Degen.
Er ließ die ganze Herde vorbeilaufen, und als der Drache kam, führte er einen Schlag und schlug ihm mit einem Hieb den Kopf weg. Augenblicklich fielen Kopf und Drache zur Erde, daß der Boden zitterte, und der Knabe ließ vor Freude einen hellen Juchzer ab.
Er machte sich nun über den Drachen her und schnitt Kopf und Leib in Stücke. Im Kopf fand er einen eisernen Schlüssel, und diesen versteckte er an einem sicheren Ort. Die Stücke des Drachen aber warf er über einen Abgrund hinaus, weil von der ganzen Sache niemand etwas wissen sollte. Nun kehrte er mit der Herde heim, sperrte sie in den Stall und legte sich schlafen, ohne vom Drachen ein Wort zu verlieren.
Am anderen Tag trieb er die Herde wieder hinaus, plagte sich aber nur wenig mit der Bewachung der Grenze. Er ließ das Vieh gehen, wohin es wollte, und legte sich selbst an einen bequemen Ort. Als der Abend kam und er noch mit allerlei Kurzweil beschäftigt war, hörte er auf einmal wieder das Klappern und Klingeln und sah die Herde im Sturm daher laufen. Hinterdrein flog wieder ein Drache, der streckte zwei lange Hälse hinaus und sperrte zwei fürchterliche Rachen auf.
Der Hirt stellte sich wieder hinter die Föhre, hielt den Degen schlagfertig, ließ Schafe und Ziegen vorbeirennen und führte, sobald der Drache herankam, einen kräftigen Streich. Da fiel das Ungetüm nieder, daß der Boden zitterte, und die beiden Köpfe lagen richtig abseits vom Rumpf.
Der Hirte juchzte lustig, machte sich an den Drachen, zerschnitt ihn und fand in dem Kopf, der zur rechten Seite stand, einen silbernen Schlüssel. Diesen versteckte er, den Drachen aber warf er in einen Abgrund. Dann fuhr er mit der Herde heim und legte sich schlafen.
Am folgenden Tag ging es nicht anders. Der Hirt spielte für sich, die Herde lief auf die verbotene Alpe, und als der Abend kam, rannte alles durcheinander, daß die Schellen klapperten und die Glocken klingelten. Hinterdrein fuhr ein Drache mit drei Köpfen. Der Hirt stellte sich hinter die Föhre, haute mit einem Streich alle drei Köpfe ab, zerschnitt den Drachen und fand im mittleren Kopf einen Schlüssel, der von purem Gold war.
Diesen versteckte er, den Drachen aber warf er in den Abgrund hinab zu den anderen zweien. Dann fuhr er heim mit der Herde und legte sich schlafen, ohne einem Menschen von den Drachen etwas zu sagen.
Am folgenden Tag fuhr er wieder hinaus und ließ die Herde grasen, wo sie wollte; allein heute kam kein Drache, und die Ziegen und Schafe warteten ruhig, bis der Hirt sie heimtrieb. Ebenso ging es am folgenden und am dritten Tag, der Hirt hatte das leichteste Hüten, und das Vieh wurde so fett, daß sich jeder Mensch darüber wunderte.
Der Graf fragte den Hirten öfter, ob ihm das Hüten nicht sauer werde, hörte aber nie die mindeste Klage. Er schaute die Herde an, fragte, wie das zuginge, daß alle Stücke so fett seien. Der Hirt sagte aber gar kein Wort, daß die Drachen tot seien und ihre Alm nun von dem Vieh des Grafen abgeweidet werde. So ging es lange Zeit fort, und der Hirt hatte die besten Zeiten.
Weil ihm das Hüten keine Mühe machte, suchte er sich auf andere Weise die Zeit zu vertreiben und fing zur Kurzweil allerlei Spiele an. Besonders tändelte er oft im Schatten der Föhre, hinter der er seine Heldentaten vollbracht hatte. Er grub bald da, bald dort in der Erde ein Loch auf, ohne an etwas anderes zu denken als an seine Spiele.
Da kam er einmal mit Graben an ein Eisenblech und wunderte sich stark, was denn das zu bedeuten habe. Er erweiterte das Loch immer mehr und sah endlich, daß es eine eiserne Tür war, die er entdeckt hatte. Er wunderte sich sehr, was diese zu bedeuten habe, und er dachte nach, wie sie etwa aufgemacht werden könnte. Da fielen ihm die drei Schlüssel ein.
Er lief sogleich hin und holte sie herbei. Zuerst steckte er den goldenen an, der sperrte aber nicht auf. Dann probierte er den silbernen, auch dieser wollte nicht passen. Endlich versuchte er es mit dem eisernen, und sogleich ging das Schloß auf. Der Hirt öffnete die Tür und schaute neugierig hinein. Da sah er nichts als einen großen, finsteren Gang. Er entschloß sich und ging hinein.
Als der Gang zu Ende war, kam er in einen großen, weiten Saal. Er schaute sich nach allen Seiten um und fand, daß alles in dem Saal von Eisen war. Ein lebendes Wesen sah er nicht, außer daß an einer Krippe ein kohlschwarzes Roß stand, das einen eisernen Harnisch trug, und daneben hing auch ein eiserner Harnisch für einen Ritter.
Am Ende des Saales war eine silberne Tür. Zu dieser ging er hin, zog den goldenen Schlüssel heraus und wollte aufmachen. Der goldene paßte aber nicht, und er nahm den silbernen. Dieser sperrte ganz leicht auf, und er konnte ungehindert hineintreten.
Da war wieder ein großer, weiter Saal, aber in diesem war alles von Silber, und an einer Krippe stand ein Roß mit silbernem Harnisch, und daneben hing auch ein Silberharnisch für einen Ritter. Am Ende des Saales war eine goldene Tür, auf diese ging der Hirt los und öffnete sie mit dem goldenen Schlüssel.
Drinnen war wieder ein großer Saal, der den ersten beiden ganz ähnlich sah, nur daß hier alles von purem Gold war. Hier stand ein weißes Roß mit goldenem Harnisch, und der Ritterharnisch, der daneben hing, funkelte auch von purem Gold. Der Junge schaute sich alles gut an, ging dann wieder zurück und sperrte die Türen zu.
Er ging nun öfter in diese Gemächer hinein, weil es ihm drinnen so gut gefiel und ihm das Hüten jetzt nicht viel zu schaffen machte. Er sagte aber keinem Menschen etwas davon und hielt es so geheim wie die Geschichte von den drei Drachen.
Nun hatte aber der Graf eine wunderschöne Tochter, und täglich kamen Grafen und Ritter in das Schloß, die um ihre Hand warben. Der Graf wußte nicht, welchem unter den vielen Freiern er seine Tochter geben sollte. Er mochte auch keinen dadurch beleidigen, daß er ihm einen anderen vorzog, und sann auf ein Mittel, wie er seine Tochter verheiraten könnte, ohne selbst die Wahl vorzunehmen und allerlei Verdruß zu erregen.
Er ließ bekanntmachen, wer seine Tochter haben wolle, der müsse sie gewinnen, und setzte zugleich den Tag an, an dem sich die jungen Herren zu dem Wettkampf versammeln sollten. Der Hirt hörte von dieser Kundmachung, und es fiel ihm sogleich ein, ob er denn nicht auch aus den unterirdischen Sälen ein Pferd und einen Harnisch nehmen und sich beim Wettrennen einfinden könnte. Er meinte, probieren schadet nichts, und war bald entschlossen, den Spaß mitzumachen.
Als der bestimmte Tag herankam, wurde es lebendig auf allen Gassen und Straßen, und schmucke Ritter und Grafen auf prachtvollen Pferden ritten dem Grafenschloß zu. Auch kam einer mit eisernem Harnisch auf einem kohlschwarzen Pferd daher gesprengt. Das war niemand anders als der Hütebub des Schlosses, aber kein Mensch erkannte ihn, und man hielt ihn für einen stattlichen Ritterssohn.
Zur bestimmten Zeit wurde die Grafentochter herausgeführt und auf eine Säule gestellt. In der Hand hielt sie einen Veilchenstengel empor, und es wurde bekanntgemacht, die Ritter sollten im weiten Kreise herumreiten, und wer dann diese Blume zuerst erjage, der sollte die Braut nach Hause führen.
Die Ritter stellten sich an und begannen den Ritt. Da lief das schwarze Pferd, auf dem der Hirt saß, allen anderen weit voraus, und bald konnte der Ritter sich zur Hand der schönen Jungfrau erheben und ihr den Veilchenstengel abnehmen. Die anderen Ritter schauten ihm mißgünstig nach, er selbst aber gab dem Pferd die Sporen und sprengte wie im Flug von dannen.
Er kam auf die Alpe zurück, führte das Pferd wieder an seinen Ort, legte den Harnisch ab, und als ob nichts geschehen wäre, fuhr er abends mit seiner Herde nach Hause. Den Veilchenstengel gab er heimlich der Grafentochter, sagte aber niemandem etwas, wie es zugegangen war, daß er ihn erlangt habe.
Der Graf wartete wochenlang und meinte, der Sieger müßte kommen, um die gewonnene Braut zu begehren. Wer sich aber nicht meldete, das war der Ritter, der den Veilchenstengel gewonnen hatte. Dem Grafen ging die Geduld aus, und er ließ bekanntmachen, daß seiner Tochter wegen noch einmal ein Wettreiten gehalten werde.
Am bestimmten Tag kamen wieder zahlreiche Ritter und Grafensöhne, um ihr Glück und Geschick zu probieren. Auch kam einer daher geritten im silbernen Harnisch und auf rotem Roß und stellte sich in die Reihe der übrigen. Zur bestimmten Stunde wurde die Grafentochter herausgeführt mit einem Veilchenstengel in der Hand.
Der Ritt begann, und allen voraus flog der silberne Ritter auf dem roten Pferd. Er nahm den Veilchenstengel aus der Hand der Jungfrau und sprengte damit augenblicklich von dannen. Das war wieder der gräfliche Hirt gewesen, der ritt jetzt zur Alpe zurück, tat Roß und Harnisch an ihren Ort und fuhr abends mit der Herde heim. Den Veilchenstengel brachte er wieder der Grafentochter, sagte aber weder ihr noch sonst jemandem, daß er selbst ihn gewonnen habe.
Der Graf wartete wieder lange Zeit auf die Meldung des Siegers. Aber auch diesmal kam der Bräutigam nicht, um seine Braut zu holen, und das dritte Wettrennen wurde ausgeschrieben. Diesmal kam der Hirt auf dem weißen Roß und im goldenen Harnisch und stellte sich in die Reihe der Grafen und Ritter.
Als die Jungfrau auf der Säule den Veilchenstengel emporhob und das Zeichen zum Ritt gegeben wurde, war er wieder der erste am Ziel und nahm die Blume aus ihrer Hand. Dann flog er von dannen, und kein Mensch wußte, wohin er gekommen war. Er ritt aber zur Alpe, tat Pferd und Harnisch, wohin sie gehörten, und trieb abends die Herde heim. Den Veilchenstengel brachte er wieder der Grafentochter, sagte ihr aber nichts, woher er ihn bekommen habe.
Auch diesmal wartete der Graf umsonst auf das Erscheinen des Bräutigams. Er war voll Zorn und Ärger und wußte nicht, was er anfangen sollte. Er erfuhr aber, daß seine Tochter den Veilchenstengel immer wieder bekommen hatte, ließ sie daher vor sich kommen und fragte, wer derjenige sei, der die gewonnenen Blumen zurückgebracht habe.
Sie erzählte, daß allemal am Abend der Hirtenbub mit dem Veilchenstengel zu ihr gekommen war. Als der Graf das hörte, wurde er sehr neugierig und ließ sogleich den Hirten vor sich rufen. Er forderte ihn auf, zu bekennen, wer ihm an jedem Abend den gewonnenen Veilchenstengel gegeben habe. Da erzählte der Hirt, daß er sie von keinem anderen empfangen habe, sondern daß er selbst der dreimalige Sieger sei.
Als der Graf das hörte, fuhr er ihn an und sagte: »Aber warum hast du dich denn nicht früher gemeldet?« Der Hirt antwortete: »Ich habe mir halt immer gedacht, sie würde mich doch nicht mögen.« Der Graf aber sprach: »Was ich einmal gesagt habe, das muß seine Richtigkeit haben, und du bist daher der Bräutigam meiner Tochter.«
Bei diesen Worten war der Schmiedlerner wie aus allen Wolken gefallen und wußte nicht, wie er die Großmut seines Herrn genug loben und ihm danken sollte.
Es wurde nun alles zur Hochzeit bereitgemacht, und viele Ritter und Herren wurden eingeladen.
Erst beim Hochzeitsmahl fragte man den Bräutigam, woher er denn die schönen Waffen und Rosse bekommen habe. Da erzählte er von den drei Drachen, von den in ihren Köpfen gefundenen Schlüsseln und von den unterirdischen Sälen. Da wunderte sich alles, und nach der Mahlzeit führte er die anderen hinaus zu der Föhre, sperrte die eiserne Tür auf und führte sie hinein.
Als sie in den ersten Saal kamen, wo alles von Eisen war, da hub das schwarze Roß an zu reden und sagte zu dem alten Grafen: »Ich bin dein Urgroßvater und habe diese Alpe dem Urgroßvater deines Hirten genommen, und jetzt bin ich verloren.«
Als sie in den zweiten Saal kamen, wo alles von Silber war, da fing das rote Roß an zu reden und sagte zum alten Grafen: »Ich bin dein Großvater und habe um diese Sache nur wenig gewußt; ich bin im Fegfeuer.«
Dann gingen sie in den dritten Saal, wo alles von Gold war, und da hub das weiße Roß an zu reden und sagte zum alten Grafen: »Ich bin dein Vater und habe um die Sache gar nichts mehr gewußt und bin nun selig.«
Hiermit waren alle drei Rosse verschwunden, und die Grafenleute mit den Gästen kehrten in das Schloß zurück. Wie lange sie dort noch geschmaust haben, weiß ich dir nicht zu sagen.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Hafling
DIE KRÖTE ...
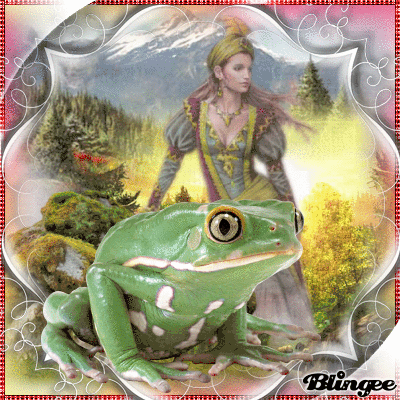
Vor langer Zeit lebte einmal ein armes Bäuerlein, das hatte drei Söhne, zwei gescheite und einen närrischen, und der närrische hieß Hansl. Der Vater war schon alt und schwach und konnte nimmer recht arbeiten.
Da sagte er einmal zum ältesten Sohn: »Wenn du willst, so will ich dir jetzt das Heimatle lassen und dir noch dreihundert Gulden geben, daß du die Wirtschaft anfangen kannst. Wenn du damit einverstanden bist, so geh nur und schau dich um eine arbeitsame Frau um, die dir hausen hilft.«
Der Sohn hatte nichts einzuwenden und war bald handelseins mit dem Vater.
Der zweite Bruder hörte auch von der Sache, ging als bald zum Vater und sagte: »Vater, Ihr wollt meinem Bruder das Heimatle geben und dreihundert Gulden, damit er heiraten kann. Gebt mir nur auch
dreihundert, ich will schon eine Frau finden, daß nicht viele ihresgleichen sind.« Der Vater ließ sich nicht lange bitten, versprach ihm die dreihundert Gulden und ließ ihn auf die
Brautwerbung gehen.
Da hörte auch der Hansl, daß seine zwei Brüder vom Vater so viel Geld bekommen hätten und heiraten wollten. Er ging als bald zum Vater und sagte: »Vaterle, heiraten kann der Hansl schon auch. Gebt mir nur dreihundert Gulden, und ich will mir schon eine Frau suchen.« Der Alte sagte: »Dreihundert Gulden will ich dir wohl geben, aber du mußt sie gut aufheben und achtgeben, daß du nichts verlierst.« Der Hansl sagte, achtgeben wolle er schon, und bekam die dreihundert Gulden.
Die drei Brüder gingen nun auf die Brautwerbung, aber dem Hansl ging es am schlechtesten. Die anderen zwei hatten schon ihre Frauen und wußten gleich, wohin gehen. Aber der Hansl hatte noch nie ans Heiraten gedacht und mußte jetzt nur aufs Geratewohl seinen Weg gehen. Er ging hinaus in den Wald und dachte darüber nach, daß er jetzt heiraten sollte.
Es kam ihm doch etwas sonderbar vor, heiraten wollen, ohne eine Braut zu haben, aber ihm war deswegen nicht bang, und er dachte sich: Jetzt ist es ganz gleich. Was mir begegnet, das heirate ich, sei es Mensch oder Tier. Er ging noch eine Weile fort, da hüpfte eine Kröte über den Weg und kam fast dem Hansl zwischen die Füße.
»Möchtest du nicht heiraten?« sagte sogleich der Hansl. »Heiraten möchte ich wohl«, erwiderte die Kröte. »Möchtest du mich, wenn du mich kriegen könntest?« »Ja, freilich möchte ich dich.« »Nun, wenn du mich magst, so ist die Sache auch schon abgesprochen; ich gehe jetzt heim zu meinen Brüdern und will es ihnen sagen.«
Die Kröte hatte nichts dagegen, und der Hansl ging heim zu seinen Brüdern.
Die Brüder lachten ihn tüchtig aus und sagten: »Ach, Hansl, bist du auch da? Du wirst schon etwas Sauberes haben von einer Braut. Wo bist du denn hingegangen auf die Werbung?« Der Hansl ließ
sie fragen und spotten und kümmerte sich nicht darum.
Nun gingen alle drei Brüder zum Vater und erzählten ihm, daß sie es jetzt in Richtigkeit haben und bald heiraten wollten. Da sagte der Vater: »Ja, wenn ihr aber alle drei heiratet, wem soll ich denn das Heimatle geben? Wir müssen es halt auf eine Probe ankommen lassen. Wißt ihr was: Ich gebe jedem von euch eine Reist, und die Reisten tragt ihr zu euren Bräuten. Die sollen dann die Reisten spinnen, und wer von euch seine Reist am schönsten gesponnen zurückbringt, dem soll das Heimatle gehören.«
Die Brüder waren mit diesem Antrag zufrieden und bekamen die Reisten. Die anderen trugen den Flachs als bald zu ihren Mädeln und sprachen ihnen lange Zeit zu, sie sollten das Garn recht klug und fein machen. Der Hansl machte sich auch auf den Weg und ging mit seinem Strähn tief hinein in den Wald. Endlich kam die Kröte daher gepatscht und fragte den Hansl, warum er denn die Reist mit sich bringe.
»Die Reist mußt du mir spinnen«, sagte der Hansl, »und wenn du schöner spinnen kannst als die Bräute meiner zwei Brüder, so bekommen wir zu den dreihundert Gulden auch noch das Heimatle, und das ist schon der Mühe wert, daß du dich zusammennimmst.« »Zusammennehmen will ich mich schon«, antwortete die Kröte. »Gib mir jetzt die Reist, und morgen kannst du das Garn abholen.« Der Hansl gab ihr die Reist und ging wieder heim.
Am dritten Tag brachten die älteren beiden Brüder das Garn zum Vater und sagten, er solle jetzt entscheiden, welcher von ihnen eine bravere Braut habe und die Heimat bekomme. Da war der Vater über die Maßen erstaunt wegen des feinen Fadens, den die beiden Bräute gesponnen hatten. Er wußte nicht, welchem Sohn er das Heimatle geben sollte, und kratzte sich gerade einmal hinter den Ohren.
Der Hansl war aber auch inzwischen zu seiner Kröte gegangen und hatte das Garn geholt. Er brachte es seinem Vater und sagte: »Da, schaut einmal, wie schön meine Braut spinnen kann. Das Heimatle wird wohl mir gehören?«
Der Vater traute kaum seinen Augen, als er das feine Gespinst betrachtete, und wenn er das Garn der Brüder damit verglich, so kam ihm gerade vor, als wenn er früher nur Rupfen in der Hand gehabt und das Flachsene erst der Hansl gebracht hätte. »Freilich gehört dir die Heimat«, sagte er zum Hansl, »und morgen müßt ihr alle drei eure Bräute bringen, dann wollen wir ein Mahl anrichten und lustig sein in Ehren.«
Am anderen Tag gingen die zwei älteren Brüder um ihre Mädchen, und auch der Hansl schickte sich an, in den Wald hineinzugehen. Er dachte sich aber: Die Kröte hüpft doch nicht bis hierher, der Weg ist nun einmal zu weit. Er nahm daher ein Milchkübele mit und wollte die Kröte darin heimtragen.
Als er in den Wald kam und die Kröte sah, sagte er: »Komm, Krötl, du sollst heute mit mir heimgehen und beim Mahl mithalten. Der Weg ist dir aber gewiß zu weit. Hüpf ins Milchkübele, und ich will dich heimtragen.« Die Kröte sagte: »Ich lasse mich nicht tragen, ich gehe schon selbst.« »Wenn du gehen willst, so ist es auch recht«, sagte der Hansl und ging voraus. Die Kröte hüpfte fleißig hinterdrein, und bald hatten sie ein gutes Stück Weges zurückgelegt.
Da fing der Wald an stockfinster zu werden, und dem Hansl kam alles ganz unbekannt vor. Er begann verzagt zu werden und dachte bei sich selber: Der rechte Weg kann das nimmermehr sein, aber daß ich mich verfehlt habe, kann ich auch nicht glauben. Ich bin ja oft durch diesen Wald gegangen und habe den Weg noch immer gefunden. Weil er sich gar nimmer auskannte, so klagte er der Kröte seine Not und wollte mit ihr beratschlagen, was da zu tun sei.
Die Kröte aber sagte: »Geh du nur vorwärts, du wirst schon heimkommen.« Der Hansl folgte ihr und ging vorwärts. Sie waren nicht lange Zeit gegangen, da öffnete sich der Wald, und vor ihnen lag ein großer, ebener Platz, der vom frischesten Grün überwachsen war. In der Mitte des Platzes lag ein ungeheurer Steinhaufen, und neben dem Steinhaufen stand eine großmächtige Haselhecke.
Als sie da im Freien standen, fing die Kröte wieder an zu reden und sagte: »Hansl, jetzt schneid von der Haselhecke das längste Reis ab und schlag damit so lange auf den Steinhaufen, bis du nichts mehr in der Hand hast.« Der Hansl nahm sein Messer aus der Tasche, ging zur Haselstaude, schnitt den längsten Zweig ab und fing an, lustig auf den Steinhaufen einzuhauen. Er schlug, daß die Splitter nach allen Seiten flogen, und schlug so lange, bis ihm nichts mehr in der Hand blieb.
Und siehe da! Auf einmal war der Steinhaufen in das aller vornehmste Schloß verwandelt, daneben stand anstatt der Haselhecke ein Pferdestall mit den aller vornehmsten Rossen, und aus der Kröte war eine wunderschöne Frau geworden, die sich der Hansl nicht genug anschauen konnte. Aber der Hansl war auch nicht der närrische Hansl geblieben, sondern in einen gescheiten verwandelt worden, und zwar in einen so gescheiten, daß es auf der ganzen Welt nicht seinesgleichen gab.
Jetzt tat die schöne Frau ihren Mund auf und sagte: »Siehst du, Hansl, das alles gehört jetzt uns. Als meine Eltern starben, hätte ich einen vornehmen Herrn heiraten sollen, den habe ich aber nicht gemocht. Dafür bin ich verwunschen worden, daß ich als Kröte herumziehen soll, bis ich etwas anderes zu heiraten kriege.
Weil du mich gemocht hast, bin ich erlöst, und jetzt sollen unsere lustigen Tage anfangen. Geh nur gleich in das Schloß, leg dir die schönsten Herrenkleider an und nimm das schönste Sattelzeug, das du findest. Geh dann in den Stall und sattle die zwei schönsten Pferde, daß wir zu deinem Vater heimreiten können. Ich will auch indes in das Schloß gehen und mich mit den schönsten Kleidern herausputzen.«
Der Hansl tat, wie ihm befohlen war, ging in das Schloß, kleidete sich um, nahm dann das schönste Sattelzeug und sattelte die zwei schönsten Pferde. Dann setzten sie sich auf und ritten der Heimat des Hansl zu.
Die Brüder und der Vater hatten indes immerfort auf den Hansl gewartet und fingen an, ungeduldig zu werden über sein langes Wegbleiben. Sie schauten in einem fort zum Fenster hinaus und meinten, jetzt und jetzt müsse er kommen, aber wer immer nicht kam, das war der Hansl.
Als es schon anfing, Nacht zu werden, da kamen ein vornehmer Herr und eine vornehme Frau des Weges daher geritten. Die kostbaren Steine, die sie an den Gewändern trugen, sah man schon von weitem glitzern, und die Pferde hatten einen so stolzen Gang, als ob sie einen König zu tragen hätten. Da sagten die Brüder des Hansl zueinander: »Was sind etwa das für Herrschaften, die so spät daher reiten?«
Sie schauten fortwährend auf die zwei Reiter hinaus und machten große Augen, als diese gerade auf das Haus los ritten und dort abstiegen. Der Herr führte die Frau in das Zimmer hinein zu den Brüdern und gab sich zu erkennen, daß er der Hansl sei, zeigte ihnen seine Frau und erzählte lange Zeit von seinem Glück und Reichtum und wie er das alles erlangt habe.
Das vornehme Brautpaar gab dann den zwei Brüdern ein schönes Geschenk, hielt eine lustige Hochzeit und ritt wieder heim in das Schloß. Und die mir das Geschichtlein erzählt hat, ist auch bei der Hochzeit gewesen und hat gegessen und getrunken und ein wenig abgespült.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, gehört von einer Passeierin in Meran
STIEFMUTTER ...
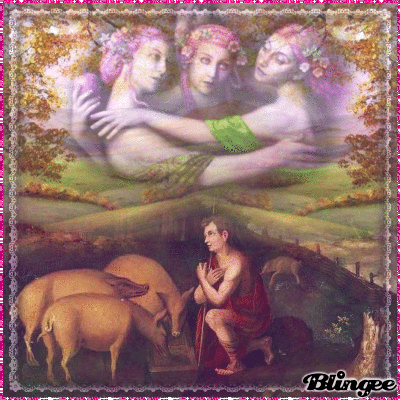
Es waren einmal ein Vater und eine Mutter, die hatten nur ein einziges Kind, und das war ein feines, herziges Büblein. Aber einmal erkrankte die Mutter und wurde immer schwächer und schwächer, so daß sie in wenigen Tagen von dem Büblein und ihrem Mann Abschied nahm und dann die Augen für immer zuschloß.
Dann kamen die Totengräber, trugen die Mutter fort und taten sie ins Grab hinab, und dem Knaben kam es jetzt so leer und enterisch vor in dem Haus, daß er sich vor lauter Sehnsucht und Langeweile oft nicht zu helfen wußte. Aber bald wurde es schon wieder lauter in dem Haus, und der Knabe hatte nimmer viel über Langeweile zu klagen, denn der Vater brachte gar bald eine Stiefmutter und sagte zu dem Kind:
»Siehst du, das ist jetzt deine Mutter, dieser mußt du jetzt gehorchen wie deiner ersten Mutter und mußt alles fleißig verrichten, was sie dir aufträgt.« Der Knabe versprach, das zu tun, er hatte aber zu dieser neuen Mutter kein solches Zutrauen, wie er zur ersten Mutter gehabt hatte, und wenn er ihr auch brav folgte, so tat er es doch mehr aus Zwang als aus Liebe, und so kam ihm das Folgen immer viel saurer vor als früher.
Die Stiefmutter konnte auch den Buben gar nicht leiden, und wenn er ihr auch alles tat, was sie wollte, so war sie doch nicht zufrieden und schimpfte und züchtigte ihn, als ob er der böseste Bub von der Welt wäre. Sie tat ihm nichts an, kämmte ihn nicht und wusch ihn nicht, so daß das Büblein, das früher so nett und sauber gewesen war, bald alle Leute grausen machte und bei niemandem mehr gern gelitten wurde.
Den ganzen Tag mußte er im Wald draußen eine ganze Schar Schweine hüten, und dabei bekam er nichts anderes zu essen als morgens vor dem Ausfahren und abends nach der Heimkehr ein bißchen trockenes Brot. So hätte er keine Freude gehabt, wenn nicht die Schweine, die er zu hüten hatte, gut geraten wären. Diese nahmen aber schon so zu, daß jedermann gemeint hätte, sie wären im Stall gemästet, nicht aber auf die Weide getrieben worden. Wie das zuging, das verstand der Knabe selbst nicht.
Sooft er mit seiner Herde ausfuhr und ein Stück in den Wald hinein kam, fingen die Schweine auf einmal an zu laufen und liefen so schleunig waldein, daß dem Hirten das Nachlaufen verging. Abends kamen sie auch richtig alle wieder zurück, und man konnte es ihnen an ihrem Wanst und am Laufen ansehen, daß sie untertags gute Weide gehabt haben mußten.
Der Knabe wunderte sich oft, wo denn etwa der gute Platz für die Schweine sei, aber zum Nachlaufen konnte er sich nie entschließen. Als er einmal so allein im Wald herum strich und sich auf mancherlei Art die Zeit zu verkürzen suchte, begegnete ihm ein altes Weibele und fragte ihn: »Bübl, was tust du denn?« »Facken hüten.«
»Weißt du, wo deine Facken immer hingehen?« »Das weiß ich nicht. Sie laufen halt allemal fort, wenn sie ein Stück im Wald sind, und abends kommen sie satt gefressen zurück.« »So geh doch einmal schauen, wo sie ihre Weide haben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, es geschieht dir ganz gewiß nichts.« Der Knabe versprach ihr, einmal nachzulaufen, und die Alte ging wieder fort.
Am anderen Tag zog er wieder mit seiner Herde in den Wald, aber als die Schweine anfingen zu laufen, lief er auch mit und lief so stark, daß er fast die Füße verlor. Als er lange Zeit gelaufen war und ihm schon der Atem auszugehen begann, da sah er ein Loch im Erdboden, und in das liefen die Schweine alle zusammen hinein.
Da getraute er sich nimmer nachzulaufen, weil es in dem Loch gar so finster war, daß ihm schon das Hineinschauen völlig unheimlich vorkam. Er strich wieder den ganzen Tag in der Nähe des Loches umher und vertrieb sich die Zeit mit allerlei Kurzweil. Während er so herumtändelte, stand auf einmal wieder das alte Weibele vor ihm und fragte:
»Bist du den Schweinen heut nachgegangen, und hast du geschaut, wo sie ihre Weide haben?« »Ja, ich bin ihnen wohl lange Zeit nachgelaufen, aber sie sind dann in ein stockfinsteres Loch hinein, und da habe ich mich nicht mehr nachgetraut.« »Warum denn nicht nachgetraut? Geh du nur hinein in das Loch, du wirst sehen, es geschieht dir nichts.«
Der Knabe versprach, am anderen Tag hineinzugehen, und die Alte humpelte wieder fort. Als es Abend war, lief das ganze Rudel Schweine wieder daher, und der Hirt kehrte sogleich heim.
Am anderen Tag in aller Frühe bekam er wieder sein trockenes Brot und mußte dann die Schweine hinaustreiben in den Wald. Als er ein Stück im Gehölz drinnen war, da fingen die Schweine wieder an zu laufen, und der Hirt lief ihnen nach über Stock und Stein, daß ihm fast der Atem ausging - und als sie in das Loch hinein schossen, da überwand er alle Furcht und lief ihnen auch nach.
Da war es aber so finster wie in einem Sack, und er wußte bei keinem Schritt, wo er hintappte, sondern mußte nur aufs Geratewohl seiner Nase nachlaufen, so wie es die Schweine auch taten. Nachdem er eine gute Strecke so gelaufen war, kam es ihm vor, als ob ein schwacher Lichtstrahl in das Dunkel herein bräche, und während er sich darüber zu freuen anfing, wurde es schon wieder ein wenig heller und dann noch heller - endlich hörte das Loch auf, und er kam mit seinen Facken auf eine freundliche Lichtung.
Die Facken rannten noch immer aus Leibeskräften darauf los, der Hirt aber ließ sich jetzt ein bißchen Zeit, weil er sich in der freien Weite doch weniger fürchtete als in dem stockfinsteren Loch. Er war noch nicht weit von dem Ausgang der Höhle, da begegneten ihm drei wunderschöne Jungfrauen und fragten ihn: »Bübl, wohin?« »Ich gehe nur schauen, wo meine Facken sind. Ich will dann geschwind wieder hinaus gehen.«
So sagte das Büblein, weil es sich halt gar so fürchtete vor den drei fremden Jungfrauen. Diese aber waren freundlich mit ihm, hießen ihn munter sein und sagten: »Wenn du die Facken sehen willst, so mußt du noch weit hinausgehen, dann wirst du sie schon finden.«
Das Büblein folgte ihnen, hob rüstig die Füße auf und ging noch eine lange, lange Strecke. Als es sich schon völlig müde gelaufen hatte, sah es endlich seine Facken, die vergnügt in drei großmächtigen Haufen wühlten und mit einem solchen Eifer fraßen, daß sie den Hirten gar nicht gewahr wurden.
Er wunderte sich, woran sie denn so gierig fraßen, und er ging deswegen noch etwas näher hinzu. Da sah er, daß es drei Kornhaufen waren, worin sie ihre Rüssel steckten, und es kam ihm nun nicht mehr sonderbar vor, daß die Tiere in der letzten Zeit so viel Speck angesetzt hatten. Er dachte sich, da brauche ich nicht viel zu hüten, fressen tun sie schon selber, und hinausgekommen sind sie auch noch allemal.
Er kehrte also um und ging wieder den gleichen Weg zurück, auf dem er gekommen war. Da begegneten ihm wieder die drei Jungfrauen und sagten: »Bist du bei den Facken gewesen?« »Jetzt habe ich sie wohl gesehen«, sagte das Büblein voll Freude, »sie sind da draußen und fressen Korn.«
»Siehst du«, erwiderten die Jungfrauen, »all das Korn ist für deine Facken. Daran kannst du sie fressen lassen, bis es gar ist, und wenn sie das alles aufgefressen haben, werden sie schon einen dicken Speck haben.« Das Büblein dankte dafür und wollte weitergehen. Die Jungfrauen aber sagten: »Jetzt bleibe da, bis es Abend wird, und dann läufst du selbst mit deinen Tieren zum Loch hinaus und der Heimat zu.«
Der Knabe ließ sich die Einladung gerne gefallen und blieb bei den Jungfrauen. Diese gingen sogleich um Kamm und Seife, kämmten und reinigten ihn und brachten ihm dann neue Kleider, die er anlegen mußte. Da schaute das Büblein auf einmal ganz anders aus, und es war ihm so wohl in den reinlichen Kleidern, daß es vor Freude gar nicht wußte, wie ihm geschehen war.
Jetzt brachten ihm die Jungfrauen auch zu essen und stellten ihm Schmalznudeln und andere gute Sachen vor, die er sein Lebtag nicht gekostet hatte. Das Büblein aß mit großem Appetit und dankte in einem fort unserem Herrn und den Jungfrauen. Diese schauten ihm zu, redeten freundlich mit ihm und munterten ihn von Zeit zu Zeit auf, tapfer dreinzuschlagen.
Als er den Löffel fortgelegt und unserem Herrn noch einmal für die gute Speise gedankt hatte, hießen ihn die Jungfrauen noch bleiben und sagten zu ihm: »Jetzt, weil wir deine Facken verköstigen und du bei uns Kleider und Essen gekriegt hast, mußt du uns auch etwas versprechen, was du leicht halten kannst. Du darfst keinem Menschen etwas sagen, wohin du deine Facken auf die Weide treibst oder wo du selbst Gewand und Speise bekommst. Hörst du?
Aber wenn du uns das versprichst und dein Versprechen hältst, darfst du mit deinen Tieren immer zu uns hereinkommen und wirst immer so gut aufgenommen werden wie heute.« Dem Knaben fiel es gar nicht ein, sich zu besinnen, und sogleich versprach er ihnen hoch und teuer, keinem Menschen von ihrer verborgenen Wohnung etwas zu sagen.
Als die Sonne anfing, hinter die Berge hinab zu kriechen, kamen die Facken des Weges daher, und man konnte es ihnen an Gang und Bauch wohl ansehen, daß sie am Fressen keinen Mangel gehabt hatten. Der Knabe nahm dankend Abschied von den drei Jungfrauen und versprach, am anderen Tag wiederzukommen. Dann hob er seinen Stecken auf, gab den hintersten von den Facken einen leichten Schlag und rannte nun, so schnell es gehen wollte, zum Loch hinaus und der Heimat zu.
Als er daheim ankam, tat er zuerst die Facken in den Stall und ging dann in die Küche hinauf zur Stiefmutter. Als diese den sauberen Jungen sah, schaute sie ihn zuerst von oben bis unten an, ob es wohl ihr Bub sei, und als sie sich überzeugt hatte, daß es doch kein anderer war, wurde sie brennrot vor Zorn, weil sie ihm das hübsche, reinliche Aussehen und das saubere neue Kleid nicht vergönnen wollte.
Sie schimpfte eine Weile zu, ohne ihn zu Wort kommen zu lassen, und erst als sie ihr Maul tüchtig ausgeleert hatte, fragte sie ihn: »Jetzt sag mir aber, wer hat dir das saubere Kleid angelegt?« »Das habe ich mir selbst angelegt«, erwiderte der Knabe. Da ging das Schelten des bösen Weibes von neuem an, und sie wollte mit aller Gewalt aus dem Knaben herausbringen, woher es denn komme, daß er heute so schön und sauber sei.
Der Knabe aber gab ihr stets ausweichende Antworten und ließ sie schelten, soviel sie wollte, sagte aber von den drei Jungfrauen und ihrem geheimen Aufenthalt kein einziges Wörtchen. Als es Schlafenszeit war, hörte der Lärm endlich auf, und der Knabe legte sich vergnügt in sein schlechtes Bettchen. Er dachte und träumte die ganze Nacht von dem glücklichen Aufenthalt, den er gestern angetroffen hatte, und konnte kaum den Morgen erwarten, um mit seiner Herde wieder dahin zu ziehen.
Kaum fing es an zu dämmern, sprang er schon aus dem Bett, legte sich vergnügt die sauberen Kleider an, trieb dann die Schweine aus dem Stall und zog singend und pfeifend mit der grunzenden Herde dem Wald zu. Die Schweine brauchte er nicht viel zu treiben, weil sie das gute Futter wußten, und so kam er bald bei dem Loch an.
Die Facken rannten ungeheißen darauf los und, wie der Wind, alle zusammen hinein. Der Knabe lief ihnen nicht nach, weil er wußte, wohin sie rannten, sondern er ging allein hinten nach. Als er durch das Loch gegangen war, begegnete er wieder den drei Jungfrauen, die ihn freundlich grüßten und einluden, den Tag über bei ihnen zu bleiben.
Er blieb gerne da und hatte wieder so gute Zeiten wie gestern. Schmalznudeln und andere gute Kost bekam er in Hülle und Fülle und hatte sich nichts zu wünschen, als daß er abends nicht wieder zur bösen Stiefmutter heimkehren müßte. Als aber die Sonne unterging, kamen die Facken, und er mußte wieder heimgehen und sich das Schimpfen und Lästern der Mutter anhören.
So ging es lange Zeit fort. Der Knabe rannte alle Tage durch das Loch zu den drei Jungfrauen und hatte dort ein Leben, daß er es sich nicht besser hätte wünschen können. Sie schenkten ihm immer mehr und schönere Sachen, und als er zu einem Jüngling herangewachsen war, konnte er sich mit den schönen Kleidern, die er von den Jungfrauen bekam, vor seinen Altersgenossen herausputzen.
Abends aber mußte er sich immer das Schelten und Fragen der Stiefmutter anhören und hatte genug zu tun, um allemal einen Ausweg zu finden, damit er von den Jungfrauen und ihrem Aufenthalt nichts zu sagen brauchte.
Eines Tages, als er wieder mit den drei Jungfrauen herumging und sich von ihnen bewirten ließ, führten sie ihn zu drei großen Geldhaufen und sagten: »Schau, einen von diesen Haufen kannst du dir leicht erwerben, wenn du so fortfährst, wie du bisher getan hast. Wir alle drei sind verwunschen, und es dauert nur noch zehn Jahre, bis wir erlöst werden können.
Bist du diese zehn Jahre hindurch fein still und sagst keinem Menschen etwas von uns und unserem Aufenthalt, so sind wir erlöst, und von diesen drei Geldhaufen gehört einer dir, einen gibst du der Kirche und den dritten verteilst du unter den Armen.«
Der Knabe, weil er sich über seine verwunschenen Wohltäterinnen erbarmte und ihm das Geld auch ein bißchen in die Augen stach, gab ihnen sein Wort, er wolle sich schon zusammennehmen, wie er es bisher getan hatte, und keinem Menschen ein Wörtchen von ihnen sagen.
Von nun an gaben ihm die Jungfrauen nicht nur Essen und Kleider, sondern auch Geld, so daß er der Stiefmutter oft mit einem Silberstück aushelfen konnte. Diese aber hatte nur einen neuen Zorn, als sie sah, daß der Bub, den sie nicht leiden konnte, auch Geld in der Tasche hatte, und sie schimpfte ihn jetzt nur desto ärger. Sie hielt ihm vor, er habe es gestohlen, und drohte, ihn vor Gericht anzuzeigen, wenn er nicht bekenne, woher er es habe. Der Junge aber wußte sich jedesmal herauszureden, ohne daß er von den Jungfrauen etwas sagte.
Die Stiefmutter bekam endlich einen solchen Zorn auf ihn, daß sie wirklich bei Gericht angab, ihr Stiefsohn betreibe das Schelmhandwerk. Da kam der Gerichtsdiener, faßte ihn und führte ihn vor Gericht. Da forderte ihn der Richter auf zu bekennen, woher er das viele Geld bekomme, wenn er es nicht stehle.
Er brachte allerlei Ausreden vor, der Richter aber war damit nicht zufrieden und sagte, wenn er es nicht bekennen wolle, so werde für ihn schon ein Loch im Turm oder beim Seiler ein Stricklein zu finden sein. Da wurde er verzagt und erzählte, daß er das Geld von den verwunschenen Jungfrauen habe, zu denen er im Wald draußen durch eine Höhle gelangt war.
Hiermit waren Stiefmutter und Richter zufrieden, und er konnte wieder frei seine Wege gehen. Am anderen Tag trieb er wieder seine Herde hinaus in den Wald. Die Facken rannten dem Loch zu, und er selbst lief ihnen eilig nach. Allein das Loch war verschlossen, und weder er noch die Facken konnten hineinkommen. Drinnen hörte er aber oft, wenn er in dieser Gegend hütete, ein bitteres Seufzen und Weinen.
Da kam ihm allemal die Reue, daß er sich hatte abschrecken lassen, die drei Jungfrauen zu erlösen.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DIE WIRTIN ...
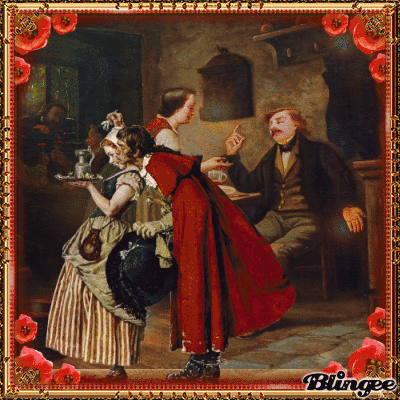
Vor langer Zeit war einmal eine Wirtin, die führte einen schlechten Lebenswandel und war weitum verrufen wegen ihrer nichtsnutzigen Sitten.
Da kam einmal ein vornehmer Herr in das Wirtshaus und wollte dort über Nacht bleiben. Als er gegessen und getrunken hatte, sagte er zur Kellnerin: »Sei doch so gut und halte heute Nacht Wache vor meinem Zimmer. Ich zahle dir dafür fünfhundert Gulden.«
Die Kellnerin wollte sich dazu nicht verstehen und sagte: »Bei Nacht will ich lieber schlafen als Wache stehen.« Die Wirtin, die vom Begehren des Fremden hörte, ging zu ihm und sagte: »Wache stehen will schon ich; ich fürchte mich nicht.«
Als es Nacht war und der Herr sich in sein Zimmer gesperrt hatte, da ging die Wirtin vor die Tür hinauf und stand Wache. In der Nacht hörten die Leute Seufzen und Stöhnen vor der Tür, aber niemand ging schauen, was es gebe. Am anderen Morgen lag die Haut der Wirtin vor der Tür und dabei die fünfhundert Gulden. Das übrige hatte der Teufel geholt.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, gehört von einer Passeierin in Meran
DER BÄR ...

Vorzeiten lebte ein Kaufmann, der hatte drei Töchter. Davon war die älteste ein herzensgutes, folgsames Kind, die zwei jüngeren waren aber stolz und böse und konnten ihre älteste Schwester nicht leiden.
Da trug es sich einmal zu, daß ein Wintermarkt in der Nähe war, den der Kaufmann besuchen wollte. Er sprach beim Abschied zu seinen Töchtern: »Was soll ich euch vom Markt mitbringen?« Da verlangten die zwei jüngeren Töchter schöne Kleider und andere Kostbarkeiten.
Die älteste aber sprach: »Lieber Vater, bring mir eine Rose als Marktkram! Ich habe diese Blumen am liebsten.« Sie dachte sich aber im Herzen: Meinem Vater geht doch Geld genug auf. Eine Rose kostet ihm aber nichts, und mir macht sie doch viel Freude.
Der Kaufmann reiste nun auf den Markt und machte diesmal sehr gute Geschäfte. Er kaufte für seine zwei jüngeren Töchter schöne Kleider und andere Kostbarkeiten, allein umsonst forschte er nach einer Rose für sein ältestes Kind. Denn es herrschte kalter Winter, und Knie tiefer Schnee lag auf allen Gärten und Feldern. Das war dem Kaufmann unlieb.
Nach abgeschlossenen Geschäften trat er den Heimweg an und fuhr schnell über Schnee und Eis dahin. Als er schon eine gute Strecke zurückgelegt hatte, kam er zu einem herrlichen Schloß, das er früher noch nie gesehen hatte. Das schöne Gebäude war aber von einem prächtigen Garten umgeben, in dem die lieblichsten Rosen zahllos blühten.
Da dachte sich der Kaufmann: Hier muß ich mir eine Rose beschaffen, denn ich möchte meinem ältesten Kind doch eine Freude machen. Er stieg deshalb aus dem Schlitten, ging in den Garten hinein und pflückte eine Rose. Dann wollte er wieder schnurstracks zum Schlitten und von dannen fahren.
Allein dies ging nicht so schnell; denn kaum hatte er die Rose gepflückt, da hörte er seinen Namen rufen. Erstaunt sah er um sich und erblickte zu seinem großen Schrecken einen zottigen Bären, der ihn anbrummte:
»Du hast dich unterfangen, in meinen Garten einzubrechen und eine Rose zu stehlen, dafür sollst du büßen. Schickst du mir deine Tochter, für die du diese Rose gepflückt hast, binnen vierzehn Tagen hierher, so ist es recht. Tust du das nicht, so sollst du sehen, wie es dir und den Deinigen gehen wird.«
Der Kaufmann erschrak über diesen unvermuteten Auftritt dergestalt, daß er, ohne eine Antwort zu geben, sich eiligst aus dem Staub machte. Er lief zu seinem Schlitten, schwang sich hinein und fuhr über Eis und Schnee seiner Stadt zu. Da hatten die drei Töchter eine große Freude, als sie ihren Vater kommen sahen. Sie sprangen ihm entgegen und bewillkommneten ihn aufs freudigste.
Sie bemerkten aber bald, daß ihr Vater ernst und trübe gestimmt sei, und das verdarb ihnen sogar die Freude an den schönen Geschenken. Sie fragten ihn nun so lange, was ihm fehle, bis er ihnen endlich erzählte, was der schreckliche Bär zu ihm gesprochen hatte.
Da machten die zwei jüngeren Töchter hämische Gesichter und sprachen zur ältesten: »Siehst du, wie es dir geht, weil du gerade eine Rose haben mußt. Dir geschieht recht, wenn du eine Bärenbraut wirst. Mit den Leuten kannst du doch nicht umgehen.«
So schmähten sie und hatten die größte Freude an dem Unglück, das ihrer guten Schwester drohte. Doch diese blieb gefaßt, denn sie hatte ein reines Gewissen, und dachte sich: Gar so bös wird der Bär nicht sein. Sie brachte ihre Sachen in Ordnung und nahm am vierzehnten Tag von ihrem Vater und ihren Schwestern Abschied und fuhr dann auf der Landstraße so lange, bis sie zum Schloß des Bären kam.
Dieser wartete schon auf sie am Eingang des Gartens und empfing sie freundlich. Dann führte er sie in das stolze Schloß, bot ihr Erfrischungen und wies ihr die schönsten Zimmer zum Aufenthalt an. Da fand sie alles, was sie sich nur wünschen mochte, vorhanden, und es mangelte ihr an keiner Sache.
So lebte sie nun im Schloß, und der Bär, der sich gar freundlich zeigte, leistete ihr Gesellschaft. Sie schickte sich bald in ihre Lage und lebte vergnügt und glücklich. Doch nach einiger Zeit ergriff sie eine starke Sehnsucht, ihren Vater wiederzusehen, so daß sie ihr Anliegen endlich dem Bären mitteilte.
Da brummte dieser anfangs und wollte von einem Besuch bei dem Vater nichts wissen. Als aber die Jungfrau von neuem bat, brummte der Bär: »Geh, wohin es dich zieht, aber länger als zwei Tage
darfst du nicht bei den Deinen bleiben.«
Dann nahm er einen Ring aus einem verborgenen Kästchen und gab ihn der Kaufmannstochter mit den Worten:
»Wenn du dieses Ringlein am Abend vor deiner Abreise an den Finger steckst, so wirst du dich am folgenden Morgen in deinem Vaterhaus befinden. Bleib dann zwei Tage dort. Dann mußt du abends wieder das Ringlein anstecken, auf daß du am dritten Morgen wieder hier bist.«
Die Kaufmannstochter war darüber hoch erfreut und konnte den Abend kaum erwarten. Als es endlich dunkelte, steckte sie das Ringlein an ihren Finger und wollte dann einschlafen. Allein das ging nicht so schnell. Die Freude ließ ihr keine Ruhe, und erst gegen Mitternacht fielen ihr die Augen zu.
Als sie am nächsten Morgen erwachte, befand sie sich im Haus ihres Vaters. Sie wurde von ihren Angehörigen freundlichst empfangen, und ihr Vater hatte ob dem unerwarteten Wiedersehen mit seiner Tochter eine maßlose Freude. Da gab es einen recht gemütlichen, heiteren Tag, und niemand dachte ans Abschiednehmen.
Am nächsten Tag erst sagte die Tochter, die aus der Fremde gekommen war, daß sie am folgenden Morgen wieder beim Bären sein müsse. Da waren alle überrascht und drangen so lange in die Jungfrau, bis sie endlich beschloß, noch einen Tag beim Vater zu verleben.
Am Abend des dritten Tages steckte sie erst das Ringlein an ihren Finger und schlief unter wehmütigen Gefühlen ein. Wie sie am folgenden Tage erwachte, war sie im Schloß des Bären. Sie stand nun auf und wollte zu ihrem Herrn gehen, um ihn zu begrüßen.
Sie ging deshalb in sein Zimmer, das war aber leer. Dann suchte sie das ganze Schloß ab, konnte aber den Bären nirgends finden. Da war sie sehr traurig, denn sie hatte das gute Tier lieb gewonnen. Sie beschloß deshalb, noch einmal im ganzen Schloß den Bären zu suchen - und sie tat es.
Da fand sie ihn endlich unter dem Brunnentrog, wo er wie halb tot lag. Sie zog ihn heraus, streichelte den Braunpelz und fragte ihn, warum er in diesem traurigen Zustand sei. Da antwortete er: »Ich habe schon gemeint, daß du nicht mehr kommen würdest, und darob bin ich fast verzweifelt.«
Als die Kaufmannstochter dies hörte, hatte sie noch größeres Mitleid mit ihm, streichelte ihn und sprach: »Sei nur nicht verzagt! Ich will immer bei dir bleiben und werde dich nie mehr verlassen, denn du bist mein Schatz!« Als der Bär diese Rede hörte, sprang er hocherfreut auf und brummte: »Wenn ich dein Schatz bin, mußt du mich so lange schlagen, bis mir die Haut vom Leib fliegt.«
Dagegen sperrte sich die Jungfrau lange, doch endlich gab sie den Bitten nach und nahm eine Peitsche. Diese schwang sie so kräftig, daß bald Hautfetzen vom Bären davon flogen. Auf die Bitte des Bären schlug sie aber noch immer zu, daß die Hiebe klatschten.
Als die Haut fast ganz weggepeitscht war, stand plötzlich ein wunderschöner Jüngling vor ihr. Er eilte auf sie zu, umarmte sie und dankte ihr für seine Erlösung. Dann führte er sie in das Schloß zurück und hielt mit ihr eine lustige Hochzeit. Dabei diente das alte Gesinde, das zugleich mit dem Herrn vom Zauber erlöst worden war.
Die gute Kaufmannstochter war nun eine steinreiche Rittersfrau und hatte mit ihrem Gemahl ein gar herrliches Leben.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Tannheim
DIE BAUERNMAGD ...
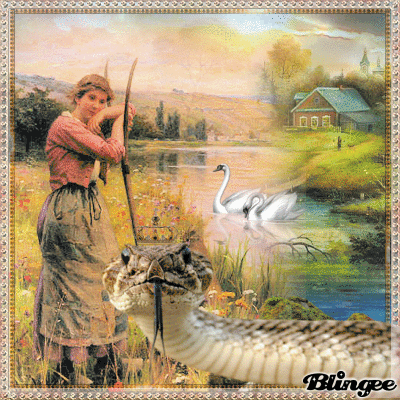
In einem Dorf lebte einmal eine arme, aber brave Bauernmagd. Zu dieser kam oft, wenn sie im Stall war und melkte, eine Krönlnatter und tat gar freundlich. Als die Magd einmal wieder die Kühe melkte, kam die Natter ganz nahe zu ihr und sprach:
»Weil du ein braves Mädchen bist und bisher keine schwere Sünde begangen hast, kannst du mich erlösen. Ich werde in drei Tagen als abscheuliche Schlange wiederkommen, dir dreimal um den Hals kriechen und dir zuletzt ein goldenes Schlüsselchen in den Mund legen. Du darfst mich aber nicht wegschütteln, denn dann hätte ich umsonst auf dich gehofft.«
Nach diesen Worten verschwand die Natter ins Gemäuer. Am dritten Tag abends, als die Magd allein im Stall war, kam ein abscheulicher Wurm, der trug ein goldenes Schlüsselchen im Maul. Er kroch auf die Magd zu und an ihr hinauf. Dann schlängelte er sich um ihren Hals.
Sie ließ das zweimal geschehen und blieb gefaßt. Doch wie er zum dritten Male um ihren Hals sich schlingen wollte, war die Magd von einem großen Grauen befallen, und sie schüttelte den Wurm von sich.
Da sprach er: »Du hast mich von dir gestoßen, und deshalb muß ich noch hundert Jahre als Schlange umgehen und leiden. Hättest du mich an deinem Hals gelassen, wäre ich erlöst, und du hättest all das Geld bekommen, das ich während meines Lebens aus Geiz vergraben habe.«
Dann verschwand die Schlange und ließ sich viele Jahre nicht mehr sehen.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Tannheim
DIE SELTSAME HEIRAT ...
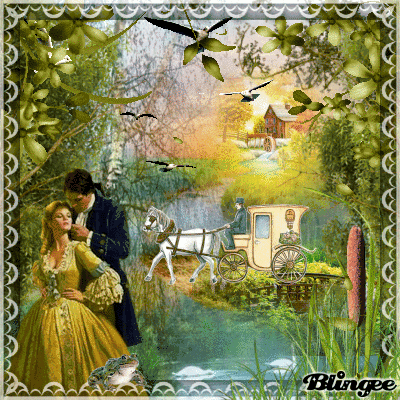
Vor langer Zeit hatte einmal ein Bauer drei Söhne, von denen der ältere ein rechter Lapp war. Man mochte ihm auftragen, was man wollte, alles tat er verkehrt.
Eines Tages war er ganz betrübt, denn seine Brüder wollten ihm die Hauswirtschaft nicht überlassen, weil er gar so dumm war; er wußte sich vor Ärger und Verdruß gar nicht zu fassen und ging in den Wald hinaus, um seine Brüder nicht mehr zu sehen.
Als er so durch den dichten, dunklen Forst dahinwanderte, hörte er plötzlich in der Nähe seinen Namen rufen. He, wer ist etwa das? dachte er und ging der Gegend zu, aus der die Stimme zu kommen schien. Er war nicht weit gegangen, so gelangte er zu einem schönen, blauen See und erblickte am Ufer eine Kröte, die ihm immer zurief: »Hansl, Hansl!«
»Was willst du denn?« fragte Hansl, der ganz erstaunt war. »Nichts sonst«, antwortete sie. »Ich bin so mutterseelenallein, und da möchte ich dich zur Gesellschaft haben.«
Der Hansl hatte Mitleid mit dem armen Tier, setzte sich auf einen Stein und plauderte die längste Zeit mit der Kröte. Endlich wollte es Abend werden, und ein kühler Luftzug strich schon über das Wasser, da dachte sich Hansl, ich muß doch heimgehen, und nahm von der Kröte Abschied.
Diese sagte aber: »Komm mich bald wieder besuchen, und dann kannst du verlangen, was du willst, ich werde es dir geben.« Sie gab ihm auch ein Stäbchen und fuhr fort: »Nimm dieses Stäbchen, und wenn du damit in den See hinein schlägst, weiß ich schon, daß du da bist.«
Nach diesen Worten hüpfte sie ins Wasser, daß es einen lauten Patsch tat, und der Hansl ging freudig mit seinem Stäbchen nach Hause. In der Nacht konnte er nicht schlafen, denn immer dachte er an die Kröte und das Stäbchen, und er wunderte sich sehr, ob wohl das, was die Kröte gesagt hatte, wahr sei.
In aller Frühe, als die Hennen noch auf einem Fuß standen und schliefen, stand er schon auf, nahm das Stäbchen und wanderte in den dunklen Wald hinaus und ging, bis er zum See kam. Und wie er dort war, schlug er mit dem Stäbchen ins Wasser, daß es weite Wellen schlug, und sogleich hörte er die Kröte fragen:
»Hansl, was willst du?« Er antwortete: »Drei Schneuztüchlein.« Kaum hatte er es gesagt, so flogen drei schöne Tücher aus dem Wasser heraus, und Hansl ging damit voll Freude nach Hause. Als er dort war, dachte er bei sich, ich habe so schöne Schneuztücher, und meine Brüder haben nur schlechte; ich muß ihnen schon auch zwei davon geben. Gedacht, getan! Das schönste Tuch behielt er für sich, die anderen beiden gab er seinen Brüdern.
Am anderen Morgen ging Hansl wieder, bevor der Tag graute, in den Wald zum See hinaus und schlug mit dem Stäbchen ins Wasser. Da fragte die Kröte wieder: »Was willst du?«, und Hansl antwortete:
»Drei schöne Schnupftabakbüchsen.«
Kaum hatte er es gesagt, kam die Kröte aus dem Wasser herausgewatschelt und sprach: »Lieber Hansl, ich kann dir diese nicht geben, denn ich habe keine vorrätig. Tu aber einen anderen Wunsch, und
ich werde ihn erfüllen.«
Da besann sich der Lapp nicht lange und sprach: »Das liebste wäre mir, wenn ich heiraten könnte und dürfte!« Der Kröte schien dieser Wunsch zu gefallen, und sie erwiderte: »Wenn du heiraten willst, so soll dir bald geholfen sein. Du heiratest mich, und dann ist alles abgetan.«
Als Hansl dies hörte, hatte er die größte Freude, denn er hatte jetzt auch eine Braut. Jetzt konnten die Dorfmädchen sehen, daß er doch eine gekriegt hatte. Er setzte sich nun auf einen Stein nieder, und die Kröte kroch auf seinem Knie herauf, und sie saßen den ganzen Tag beisammen und besprachen alles, was bei solchen Gelegenheiten besprochen wird.
Und als sie noch nicht alles abgeredet hatten, fing es schon an zu dunkeln, die Kröte nahm von ihrem Hansl Abschied und sprang in den See hinein, und Hansl eilte voll Freude nach Hause. Am folgenden Tag, es war gerade ein Samstag, ging er, ohne dem Vater oder den Brüdern etwas davon zu sagen, in den Widum und sagte dem Pfarrer, er wolle jetzt heiraten und habe mit seiner Braut alles in Ordnung. Er bat dann, der Herr Pfarrer möge den Verkündzettel schreiben und ihn morgen nach der Predigt verkünden.
Der Pfarrer glaubte anfangs, Hansl sei nicht bei Sinnen, und wollte ihm nicht willfahren. Als dieser aber auf seinem Vorhaben bestand, gab der Geistliche nach, und schrieb, was Hansl ihm ansagte, staunte aber nicht wenig, als der junge Bauer keine Braut nannte. Sie zu nennen, hatte ihm nämlich die Kröte verboten. Der Pfarrer mochte fragen und tun, was er wollte, Hansl erwiderte immer: »Ich darf meine Braut nicht nennen.«
Am Sonntag wurde Hansl verkündet, und alle Zuhörer lachten hellauf, daß der Lappe, ohne eine Braut zu haben, heiraten wollte. Als er aus der Kirche nach Hause kam, waren Vater und Brüder über ihn böse und verlachten ihn. Ihm war jedoch alles gleichgültig, und er kümmerte sich nicht darum und ging oft zum See zu seiner Kröte hinaus. Endlich kam der Hochzeitstag, und da hättest du die Freude des Hansl sehen sollen!
Als es noch nicht Ave-Maria geläutet hatte, fuhr Hansl schon in einer prächtigen Kutsche in den Wald hinaus, um seine Braut zu holen. Als er am See ankam, wartete die Kröte schon am Ufer, wurde vom Hansl sogleich in die Kutsche gehoben, und dann ging es im schnellsten Trab über Stock und Stein der Kirche zu. Vor der Kirchtür wurde sie wieder aus dem Wagen gehoben und patschte an der Seite ihres Bräutigams zum Altar, wo der Geistliche auf das Brautpaar schon harrte.
Dieser machte keine kleinen Augen, als er die garstige Braut sah, nahm aber keinen Anstand, das seltsame Paar zu trauen. Nach dem Gottesdienst watschelte die Kröte wieder zur Kirchentür, wurde von Hansl wieder in den Wagen gehoben und fuhr dann mit ihrem Mann von dannen zum See. Dort angekommen, hob sie Hansl wieder aus dem Wagen, und sie sprang lustig in den See hinein.
Da war Hansl gar traurig und wußte nicht, was er tun sollte. Er nahm endlich sein Stäbchen und schlug in das Wasser, und siehe da! - eine wunderschöne Frau stieg aus dem See und eilte auf den Hansl los und halste und herzte ihn, daß er fast erdrückt wurde. Dann stiegen beide in die Kutsche und fuhren in das Dorf zurück.
Da staunte jung und alt die Braut an, denn eine so schöne Frau hatte man noch nie gesehen. Es gab nun eine lustige Hochzeit, bei der ihnen der Himmel voller Geigen hing und der Tisch voll Speisen war, und die Braut war gar froh, daß sie erlöst war.
Hansl und seine reiche, schöne Frau lebten lange, lange Zeit glücklich und zufrieden beisammen und sprachen noch oft im Alter von ihrer seltsamen Heirat.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Gnadenwald
DER ASCHENTAGGER ...
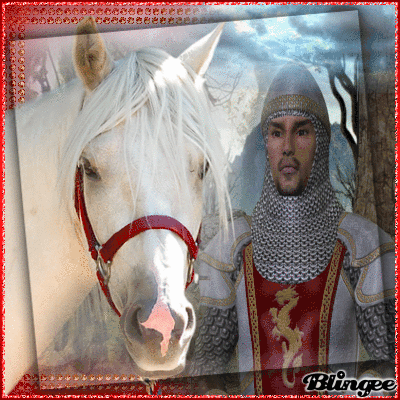
Dicht an einem Wald lebte einmal ein Bauer, der drei Söhne hatte. Die älteren zwei waren rüstige Buben, die dem Vater an die Hand gingen und tüchtig arbeiteten. Der jüngste aber war ein Lappe und konnte zu keiner Arbeit angestellt werden. Er trug, obwohl er schon zwanzig Jahre alt, noch einen Kinderrock aus Loden und saß den ganzen Tag auf dem Herd. Hier machte er sich immer mit der Asche zu schaffen, und man nannte ihn deshalb den Aschentagger.
Da ereignete es sich, daß der Bauer todkrank wurde. Als er sah, daß für ihn kein Kräutlein mehr gewachsen war, sagte er zu seinen drei Söhnen: »Ich kann euch wenig hinterlassen. Wenn aber ein jeder von euch in den drei ersten Nächten zu meinem Grab kommt, werde ich euch mit Rat und Tat helfen.« Als er dies gesagt hatte, starb er und wurde bald begraben.
Da nahte nun die erste Nacht, in der der älteste zum Grab des Vaters gehen sollte. Dieser aber fürchtete sich, allein auf den Friedhof zu gehen, und ging in die Küche, wo der Aschentagger auf dem Herd saß. Zu diesem sprach er: »Hansl, wenn du anstatt meiner zum Grab meines Vaters gehst, gebe ich dir einen Laib Brot.« Da lachte Hansl vor Freude hellauf und antwortete: »Um Brot gehe ich dir alle Nacht auf den Friedhof.«
Hansl bekam nun von seinem Bruder einen Laib Brot, aß ihn und ging, als es Nacht war, zum Grabe seines Vaters. Dort wartete er bis Mitternacht. Als es auf dem Kirchturm zwölf Uhr schlug, stieg der Vater aus dem Grab und sprach, als er den Hansl sah: »Sieh, bist du da! Du bist halt der erste und der Beste, und deshalb will ich dir etwas Gutes geben. Da hast du einen Roßzaum. Bewahre ihn gut auf, denn er wird dir einmal großen Nutzen bringen.«
Hansl nahm den Roßzaum und dankte dem Vater, der sogleich wieder verschwand. Hansl kehrte nun lustig nach Hause zurück, ging dort in den leeren Stall und hängte den Roßzaum an eine Wand. Dann ging er in seine Kammer und schlief, bis der Morgen graute.
Als am anderen Tag die Brüder ihn fragten, erzählte er ihnen sonst alles, nur vom Roßzaum verlor er kein Wörtchen. Er saß wieder auf dem Herd und wühlte wie gewöhnlich in der Asche. Da sprach der zweite Bruder zu ihm: »Hansl, du fürchtest dich nicht. Geh du anstatt meiner auf den Friedhof. Ich gebe dir dafür einen Laib Brot.« Hansl lachte nun hellauf und sprach: »Gib mir nur das Brot, ich werde schon zum Vater gehen.«
Er bekam sogleich das Brot, aß es und war guter Dinge. Er blieb auf dem Herd und tändelte in der Asche, bis es dunkle Nacht war. Dann ging er auf den Gottesacker und wartete bei dem Grab seines Vaters bis Mitternacht. Als es vom Kirchturm zwölf Uhr schlug, stieg der Vater aus dem Grab und war ganz verwundert, wie er den Hansl sah. »Hansl, bist du wieder da? Du bist halt der Beste und Folgsamste«, sprach er. Dann gab er dem Aschentagger eine Geißel mit den Worten: »Hebe sie gut auf, denn sie wird dir von großem Nutzen sein.«
Kaum hatte er es gesagt, war er auch verschwunden, Hansl ging mit der Geißel wohlgemut nach Hause und steckte sie im Stall neben dem Roßzaum auf. Dann suchte er sein Lager auf und schlief, bis es Morgen wurde. Dann zog er seinen Rock an und setzte sich auf den Herd. Seine Brüder fragten ihn, wie es ihm auf dem Friedhof ergangen sei. Da erzählte er ihnen alles, nur von der Geißel sagte er kein Wörtchen.
In der dritten Nacht traf ihn die Reihe, und er ging wieder zu dem Grab. Da stieg der Vater wieder aus der Erde und sprach: »Sieh, der Hansl ist heute auch da! Du bist der Beste und erste, und ich will dir auch dafür etwas geben. Da hast du ein spanisches Stäblein. Bewahre es gut auf, denn es wird dir zu großem Nutzen gereichen.« Der Vater reichte ihm ein spanisches Stäblein und verschwand.
Der Aschentagger ging damit seelenvergnügt nach Hause, steckte seinen Stab zu dem Zaum und der Geißel und ging dann schlafen. Am folgenden Tag erzählte er seinen Brüdern, wie es ihm auf dem Gottesacker gegangen war, allein von dem spanischen Röhrlein sagte er ihnen kein Wort. Seitdem hockte er wieder auf dem Herd und spielte mit der Asche.
Nicht fern von der Heimat des Aschentaggers war eine steile Felswand, auf deren Höhe sich eine sehr schöne Ebene befand. Vorn war der Anstieg so jäh, daß nur ein geübter Fußgänger hinaufgehen konnte. Von der Rückseite führte aber ein guter Weg zur Anhöhe.
Da ließ einmal der König verkünden, wer imstande sei, auf der Vorderseite bis zur Ebene hinaufzureiten, werde die Königstochter zur Frau erhalten. Dazu bestimmte der König einen Tag, an dem die
Versuche gemacht werden sollten.
Da kamen Ritter und Herren von weit und breit, um dies Schauspiel zu sehen oder selbst ihr Glück zu versuchen.
Als der vom König bestimmte Tag angebrochen war, sagten zum Aschentagger seine zwei Brüder: »Hansl, wir gehen die Ritter anschauen, bleib du fein daheim und hüte das Haus!« Dann gingen sie zur Wand hinaus. Da dachte sich Hansl: Ich bleib auch nicht daheim, ging in den Stall, nahm dort Zaum und Geißel und humpelte in den Wald hinaus.
Dort fand er einen wunderschönen Schimmel, der an eine Tanne gebunden war, und an einem anderen Baum hing eine prachtvolle, silberne Rüstung. Hansl konnte sich an dem schönen Roß und der funkelnden Wehr nicht satt sehen und dachte hin und her, wem es etwa gehören möchte. Allein umsonst, denn niemand ließ sich sehen.
Da sagte Hansl: »Wenn beides so leer da steht, will ich es nehmen.« Er zog seinen Lodenrock aus, schnallte sich die herrliche Rüstung an und stieg auf den mutigen Schimmel. Kaum saß aber Hansl droben, als das Pferd schnell wie der Wind davon eilte und ihn zur steilen Felswand trug. Dort machten alle Zuschauer dem unbekannten Ritter Platz, und der mutige Schimmel schritt sicher und behende die steile Wand hinauf, bis er auf der Höhe stand.
Da war ein Jauchzen und Jubeln unter den Zuschauern, und niemand konnte den guten Reiter genug bewundern. Auf der grünen Ebene droben befand sich die Königstochter. Als diese den schönen, mutigen Ritter sah, eilte sie freudig auf ihn zu, wollte ihn umarmen und ihn küssen.
Hansl aber verstand nicht, was sie wollte, stieß sie von sich und mochte durchaus keinen Kuß. Er ritt sogleich wieder davon wie der Wind und sprengte über Stock und Stein in den Wald zurück. Dort stieg er vom Pferd, legte die Rüstung ab und zog wieder den schmutzigen Lodenrock an. Dann lief er nach Hause, setzte sich auf den Herd und tat, als ob er ihn gar nicht verlassen hätte.
Der Königstochter hatte aber der fremde Ritter so gut gefallen, daß sie den König bat, er möchte dies Reitspiel noch einmal veranstalten. Vielleicht komme dann der schöne Reiter wieder. Der König tat nach dem Willen der Prinzessin und ließ auf den folgenden Tag alle Ritter zum Spiel einladen.
Als am folgenden Morgen das Spiel abermals beginnen sollte, sprachen wieder die zwei Brüder zum Aschentagger: »Hansl, bleib du daheim und hüte das Haus, wir gehen zum Spiel hinaus.« Da ließ der Hansl sie gehen, dachte aber: Ich bleibe auch nicht da.
Er ging wieder in den Stall, nahm Zaum und Geißel und trottete in den Wald hinaus. Dort fand er wieder die wunderschöne Rüstung und den prächtigen Schimmel. Er zog den Lodenrock aus, legte die blanke Rüstung an und bestieg dann das Pferd. Hui! Wie rannte dieses zur Felswand und trug den unbekannten Reiter glücklich zur Höhe.
Da gab es ein Jubeln und Jauchzen, und des Staunens war kein Ende. Droben eilte die Königstochter wieder auf ihn zu und wollte ihn küssen. Hansl aber verstand das nicht, stieß die Prinzessin fort und sprengte spornstreichs über die Wand hinunter und wollte in den Wald eilen.
Da wurde er aber aufgehalten, denn der König hatte eine Reihe starker Wachen dort aufgestellt und ihnen befohlen, den fremden Ritter um keinen Preis fortzulassen. Der König selbst stand bei den Wächtern. Hansl war bald umringt, und als er dennoch alles aufbot, um durchzukommen und mit der Geißel rechts und links Hiebe verteilte, da wurde er am rechten Fuß verwundet.
Als er dies sah, schien er nachgeben zu wollen und rief nach einem Verband. Da nahm der König sein eigenes Sacktuch und verband damit die Wunde des fremden Ritters. Wie dieser aber bemerkte, daß die Wächter sich etwas zerstreut hatten, gab er dem Roß die Sporen und verschwand ins Weite.
Da blieb dem König und seinen Dienern das Nachschauen, denn niemand konnte den flüchtigen Reiter mehr einholen. Hansl sprengte über Stock und Stein in den Wald, legte die Rüstung ab und zog seinen Lodenrock an. Dann eilte er heim, trug Zaum und Geißel in den Stall und ging in die Küche, wo er sich auf den Herd setzte und in der Asche klaubte.
Bald kamen seine Brüder vom Spiel zurück und erzählten davon. »Wer ist etwa der dumme Ritter, der immer davonläuft? Den möchte ich kennen.« Hansl dachte sich, ich wüßte den schon, und grabbelte in der Asche, als ob er ihre Rede nicht verstanden hätte.
Die Königstochter war über das Entfliehen des schönen Ritters ganz untröstlich und bat ihren Vater eindringlich, er sollte ihr den Bräutigam nicht entkommen lassen. Da ernannte der König eine Kommission, die mußte landaus, Land ein alle Burschen und Männer visitieren und den verwundeten Ritter suchen.
Die mit diesem Auftrag betrauten Männer kamen auch in das Haus der drei Brüder und visitierten die älteren beiden. Doch da fanden sie keine Wunde und keine Schramme. Die Sucher fragten: »Ist noch jemand hier zu Haus?« Da hieß es: »Ja, ein Lappe«, und sie wurden in die Küche geführt, wo Hansl auf dem Herd saß.
Als die Männer den dummen Burschen sahen, dachten sie sich, der ist es doch nicht, und wollten weitergehen. Aber es fiel ihnen ein, wie sie den strengsten Befehl hätten, jeden zu untersuchen, und deshalb kehrten sie um und visitierten den Hansl. Und siehe! Als sie seinen Rock aufhoben, schimmerte ihnen das Sacktuch des Königs entgegen.
Als sie sich vom Staunen erholt hatten, packten sie den rußigen Aschentagger und führten ihn zum König und zur Königstochter. Wie aber diese den schmutzigen Hansl erblickte, fing sie an zu weinen und zu rufen: »Nein, der ist es nicht! Nein, den mag ich nicht.«
Jetzt dachte sich der König: Was ist nun zu tun? Ich ließ den Reiter überall suchen, und nachdem er gefunden ist, mag ihn meine Tochter nicht. Wie er so hin und her dachte, fiel ihm ein Ausweg ein.
Es hielt sich damals in einem nahen Wald eine furchtbare Schlange auf, die Vieh und Leute auffraß. Deshalb sagte nun der König zum Aschentagger: »Du mußt noch eine Probe deiner Ritterlichkeit ablegen, wenn du meine Tochter zur Ehefrau haben willst. Geh in den Wald hinaus und erlege die Schlange, die weit und breit alles Land verheert. Ich werde selbst nachkommen und deinem Kampf zusehen.«
Hansl war nicht faul, ging heim und holte sein spanisches Röhrlein aus dem Stall. Dann trottete er munter in den Wald hinaus und blies auf einer Schwegel, die er einmal als Marktkram bekommen hatte. So wanderte er lange fort. Endlich kam er zur fürchterlichen Viper, die pfeifend auf ihn losstürzte.
Hansl wich ihr aus und schlug mit dem Stäbchen aus das giftige Tier. Und siehe! Gleich lag es mausetot auf der Erde. Als der König dies sah, war er voll Freude, daß er einen so tapferen Schwiegersohn bekomme. Allein die Königstochter weinte und jammerte und wollte vom Hansl nichts wissen.
Da sprach der König zu ihr: »Dein Bräutigam hat die Spiele gewonnen, du mußt ihn halt nehmen.« Hansl mußte nun nach dem Hofe gehen und dort wohnen. Allein die Prinzessin weinte Tag und Nacht, so daß es dem Aschentagger zu arg wurde.
Er verließ den Hof und ging heim, wo er vom Stall Zaum und Geißel holte. Dann ging er in den Wald hinaus und fand dort wieder den schönen Schimmel und die silberne Rüstung. Er zog nun den Rock aus, legte die glänzende Rüstung an und bestieg das Roß. Dann sprengte er spornstracks nach dem Hof zurück.
Als er in die Königsburg einritt, stand die Prinzessin am Fenster und sah den herrlichen Ritter. Da kam sie vor Freude fast außer sich und rief: »Mein Bräutigam, mein Bräutigam!« Sie eilte ihm entgegen und begrüßte ihn huldreich. Da gefiel ihr Hansl so, daß sie ihn sogleich zum König führte und noch am nämlichen Tag Hochzeit hielt.
So war nun der Aschentagger eines Königs Schwiegersohn und Erbe geworden.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Absam
SCHWESTERCHEN UND BRÜDERCHEN ...
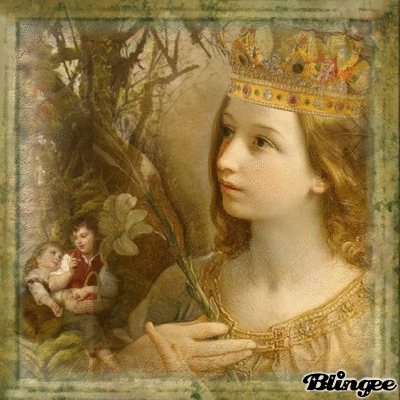
Es war einmal ein Schwesterchen und ein Brüderchen. Das Schwesterchen war brav und folgsam und betete fleißig in der Kirche, das Brüderchen ging aber seine Wege, war störrisch und schnippisch und machte seinen Eltern nur Kummer und Verdruß.
Einmal gingen beide in den dunklen Wald hinaus Erdbeeren lesen, Sie kamen immer tiefer und tiefer in den Forst hinein. Das Brüderchen aß und aß voller Gier, ohne jemals an Gott oder an die Mutter zu denken das Mädchen hatte aber ein Körbchen mitgenommen und las die roten Beerlein in das selbe hinein, um sie der lieben Mutter zu bringen.
Wie sie so beisammen im Walde waren und Schwesterchen sammelte und Brüderchen aß, kam plötzlich ein schöne Frau. Ein wunderbares Licht umfloß sie und die Krone auf ihrem Haupte glänzte wie die
Sonne. Das Schwesterchen ließ das Sammeln und stand ehrerbietig auf, als die schöne Frau kam, das Brüderchen rupfte aber in den Erdbeeren fort, ohne sich an etwas anderes zu kehren.
»Was machst du da, mein Kind?« sprach die schöne Frau lächelnd zum Mädchen.
»Ich pflücke Erdbeeren, um sie meiner lieben Mutter zu bringen« antworte das Schwesterchen errötend; denn es schämte sich vor der schönen Frau.
Die Frau lächelte wieder und drückte dem Schwesterchen ein Schächtelchen, das aus reinem Golde war, in die Hand und sprach: »Mein Kind sei brav! Wenn du das Schächtelchen öffnest, so gedenke
meiner. Wir sehen uns einst wieder.« Lächelnd ging die Frau mit der funkelnden Krone weiter und kam zum Brüderchen, das in Hast und Wut Erdbeeren aß wie das liebe Vieh.
»Was machst du, Bübchen?« sprach die Frau ernst und doch milde.
»Schmeck es, wenn du es wissen willst«, erwiderte störrisch und trotzig der wilde Bursche.
Der schönen Frau kugelten zwei Tränen über die feinen Wangen und betrübt gab sie dem ungezogenen Knaben ein schwarzes Kästchen. »Gedenke meiner, wenn du es öffnest«, sagte sie wehmütig und
verschwand leuchtend hinter den Bäumen wie die Sonne, wenn sie hinter den Bäumen niedersinkt; die schöne Frau war aber die Gottesmutter.
Was mochte aber in dem Schächtelchen sein?
Das wirst du gleich hören, mein Kind! Das Brüderchen riß gleich voll Neugierde den Deckel auf, und sieh - aus dem schwarzen Schächtelchen schlangen sich zwei schwarze, schwarze Würmer heraus und
die wurden immer länger und länger, umwickelten endlich das Brüderchen und führten es immer weiter in den finsterrn, finsterrn Wald hinein, so daß es nie und nimmer gesehen wurde.
Das Schwesterchen dachte sich aber: »Bevor ich das Schächtelchen öffne, muß ich es der Mutter zeigen; oh, und die wird eine Freude haben!« In diesen Gedanken pflückte und pflückte es Erdbeeren,
bis das Körbchen voll war, und wollte dann zur Mutter heimkehren.
Beim Weggehen wollte es aber auch das Brüderchen bei sich haben, obwohl es böse war. Schwesterchen rief aus voller Kehle, aber Brüderchen gab keine Antwort. Dann suchte das Mädchen rechts und
links und links und rechts, aber nirgends fand es eine Spur vom Brüderchen, bis es anfing zu dunkeln und es im Walde unheimlich wurde.
»O, vielleicht ist das Brüderchen schon zu Hause oder es will mich nur necken,« dachte sich betrübt das Mädchen und ging mit dem vollen Körbchen und dem goldenen Kästchen dem Hüttchen zu, in dem
die Mutter wohnte. Es fand aber nicht das Brüderchen zu Hause, und als dieses lange, lange nicht kam und Mutter und Schwesterchen darauf warteten, erzählte das Mädchen von der schönen Frau, die
es gesehen, und zeigte der lieben Mutter das Kästchen.
»Du tust es mir wohl aufbehalten, liebe Mutter!« bat das Kind. »Aber zuvor darf ich wohl schauen, was darinnen ist?« fragte das Mädchen und blickte forschend der Mutter ins blaue, treue
Auge.
»O ja!« sprach die Mutter, und das Mädchen öffnete das Schächtelchen, und sieh! - zwei Engelein kamen heraus und wurden größer und größer, nahmen das brave Schwesterchen in ihre Mitte und flogen
damit vor den Augen der Mutter immer höher und höher, bis sie am Himmel verschwanden.
Die Mutter saß auf der Bank vor dem Hause, blickte nach und weinte vor Freude Tränen und dachte: »Du gehst voraus, ich hoffe dich aber einstens wieder zu finden, liebes Kind!«
Österreich: Ignaz und Josef Zingerle: Kinder- und Hausmärchen aus Tirol,
VON DREI DESERTEUREN ...
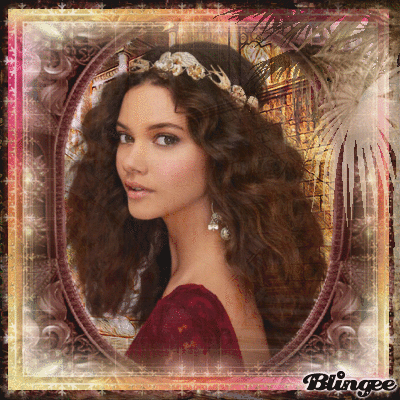
Es waren einmal vor langer Zeit ein Vater und ein Sohn, die hatten beide Soldat werden müssen. Aber weder dem Vater, der doch durch seine Klugheit Offizier geworden war, noch dem Sohn wollte der enge Soldatenrock behagen, und es wäre ihnen ihr Bauernwams viel lieber gewesen.
Da begab es sich, daß beide bei kalter Winterszeit Wache stehen mußten, innen in der Wachstube war der Vater, der Sohn aber ging außen auf und ab und stampfte, daß es hallte. Endlich nach einer Weile stand er still, dann ging er schnell zum Vater hinein und sagte ihm: »Sei Soldat, wer da will, ich laufe davon!« »Wenn du davon läufst«, antwortete ihm dieser, »dann mache ich es auch nicht besser. Ich bin nun schon ein alter Kerl, man wird mir es nicht so übel nehmen, wenn es die jungen Burschen nicht mehr aushalten.«
Damit war es beschlossen, sie nahmen Säbel und Gewehr mit und ließen Wache Wache sein. Am Tag streiften sie in Wäldern umher, schossen Wild und nahmen, wo sie etwas fanden, abends stiegen sie auf einen Baum, um nicht entdeckt zu werden. Als sie umherschweiften, begegnete ihnen einer, den sie für einen alten Soldaten ansahen, und sie fragten ihn, woher er sei. Jener, der wohl sah, er habe es mit seinesgleichen zu tun, lachte und gab ihnen zu verstehen, daß er nicht gerne Wache gehalten habe, und nannte sich einen Polen.
Sie gingen nun mitsammen weiter und kamen zu einem wohl gebauten Haus. Tore und Türen fanden sie offen und Küche und Keller aufs beste bestellt, aber sie hörten und sahen im Haus keine Menschenseele. Das hatte indessen nichts zu sagen, sie waren froh, wenn nur niemand kam, und ließen es sich gerne gefallen, immer zu bleiben. Wirklich kam auch niemand.
Tags darauf gingen Vater und Sohn auf die Jagd und der Pole blieb daheim, achtzugeben, daß nicht Feuer auskomme. Während er sich sein Mittagsmahl herrichtete, kam ein recht schmutziger, alter Bettler zu ihm in die Küche, der hatte einen langen, schwarzen Bart und bat aufs kläglichste, sich auf den Herd setzen zu dürfen, weil ihm so kalt sei.
»Setz dich nur hinauf, Alter!« brummte der Pole und arbeitete indessen dieses und jenes in der Küche. Sobald aber das bärtige Bettelmännlein merkte, daß man auf ihn nicht mehr achtgab, sprang es vom Herd und zerkratzte und zerzauste den armen Deserteur aufs jämmerlichste und war schnell wieder fort.
Abends kamen die anderen nach Hause, und als sie ihren Kameraden so übel zugerichtet sahen, fragten sie, wie das zugegangen war. »Ja«, antwortete er, »da kam heute eine große Katze, die setzte sich auf den Herd, und als ich nicht aufpaßte, sprang sie mir ins Gesicht - das andere seht ihr schon selber.« Die zwei lachten und gingen zu Bett.
»Heute gehen wir zwei jagen, ich und der Pole«, sagte am anderen Tag der Sohn zum Vater, »schau fein, daß dich die Katze in Ruhe läßt.« Die Jäger gingen fort, und der Vater besorgte zu Hause die Geschäfte. Gegen Mittag klopfte es an der Haustür. Der Vater machte auf, und draußen stand das alte, bärtige Männlein und bat inständig um Einlaß, weil ihm so kalt sei.
Da ging es nun wie am vorigen Tag. Nach einer Viertelstunde war der Schelm fort, und der alte Soldat fluchte und wischte sich das Blut vom zerkratzten Gesicht; am Abend aber mußte er gleichwohl auch der Katze die Schuld geben, denn er schämte sich, daß er sich von dem alten Wicht hatte überlisten lassen.
Am dritten Tag blieb der Sohn zu Hause. Es dauerte nicht lange, da kam der schmutzige Bettler und bat um die Erlaubnis, sich ans Feuer setzen zu dürfen.
»Von mir aus«, sagte der Junge mürrisch und dachte bei sich: Aha, das Männlein schaut noch tückischer drein als unser Korporal, wenn er sich einen neuen Prügelstock abschnitt. Vielleicht ist
es gar die große Katze, die dem Vater und dem Polen so viel zu schaffen machte. Er stellte sich, als ob er den Bettler ganz unbeachtet lasse, gab aber gut auf ihn acht.
Sobald sich jener unbemerkt glaubte, sprang er vom Herd; aber der Junge hatte ihn im nämlichen Augenblick schon am Bart gefaßt und schleppte ihn lachend unter das Dach hinauf, wo er ihn festband und mit Stricken beim Bart an einen Nagel hängte.
Beim Abendessen fragte der Vater ganz verwundert, ob die Katze nicht gekommen sei, während er auf der Jagd war. »Ja«, sagte der Sohn, »geht nur und schaut, unter dem Dach oben hängt sie.« Da sprangen alle vom Tisch auf, die Katze anzuschauen, sahen aber nur den langen, schwarzen Bart des Männleins am Strick hängen, und über den Estrich hin bis hinab über die Stiege zogen sich Blutspuren.
Wohin mag nun etwa das Männlein geflohen sein? Fort war es nun einmal, wenn auch ohne Bart. Neugierig gingen sie der blutigen Spur nach und kamen bis zu einem großen Stein, wo sie aufhörte. In der festen Überzeugung, das Männlein müßte da hineingeschlüpft sein, wälzten sie den Stein weg und fanden, daß er über eine große Öffnung hingeworfen war, die tief unter die Erde führen mußte.
Nur allzugerne hätten die drei gewußt, wie es unten etwa aussehe, und waren ganz einverstanden, als der Sohn sagte, das Männlein dürfe nicht auskommen; aber damit waren sie nicht einverstanden, daß sie hinab steigen sollten, weil ihnen der Aufenthalt des tückischen Bettlers doch gar zu unheimlich schien.
So dachten der Vater und der Pole; der Sohn aber hatte sich ein Herz gefaßt und war ins Haus zurück gelaufen, um Stricke und Seile zu holen. Bald war er wieder mit Stricken versehen zurück gekommen und verlangte ohne weiteres, sie sollten oben festhalten, während er am Seil hinab glitte, und ihn erst dann wieder heraufziehen, wenn er ihnen durch Anziehen des Strickes ein Zeichen geben werde.
Die zwei waren es zufrieden, wenn es nur nicht ihnen auf die Haut ginge, und hielten aus Leibeskräften. Das Seil war schon fast zu kurz geworden, da kam zum Glück der unerschrockene Jüngling unten an und wußte kaum, was er denken sollte, wie er vor sich die schönste, lieblichste Landschaft erblickte.
Er dachte gar nicht mehr daran, daß oben seine Genossen ihn erwarteten, und ging immer voll Freude auf den sonnigen Feldern vorwärts, denn ihn lockten in der Ferne drei Schlösser, und er gab sich selbst das Versprechen, nicht eher zu ruhen, als bis er sie erreicht hätte.
Da er immer auf die Schlösser schaute, hätte er bald einen Hirten und eine Herde am Weg übersehen. Es war das Männchen ohne Bart - doch nach einem flüchtigen Blick eilte er vorüber immer rascher und schneller, bis er endlich das erste der Schlösser erreichte.
Durch ein großes Tor trat er in den Hof, und von dort stieg er über glatte Marmor Steine hinauf, aber das ganze Schloß schien wie ausgestorben. Nur ein Wesen trat ihm endlich nach langem Suchen entgegen, es war die Herrin des Palastes. Sie schien dem jungen Wanderer die lieblichste Jungfrau auf der ganzen weiten Welt.
Wie erschrocken wandte sie sich an den staunenden Gast und bat ihn, entweder schnell sich zu entfernen oder in jedem Augenblick bereit zu sein, einen furchtbaren Kampf mit einem Ungetier zu bestehen. »Aber«, setzte sie noch mit sichtbarer Freude hinzu, »bist du Sieger im Kampf, dann bist du dadurch auch mein Befreier und nicht bloß der meinige, sondern auch der meiner zwei Schwestern, die in den anderen beiden Schlössern verzaubert sind.
Zwar mußt du auch für sie noch vieles wagen, aber es wird dir leichter fallen. So wisse, ich und meine Schwestern sind die Kinder eines reichen Königs, die von einem bösen Schwarzkünstler in diese einsamen Schlösser verzaubert wurden, wo uns greuliche Drachen und siebenköpfige Adler und ein furchtbar wütender Hund bewachen. Merke wohl darauf, daß mein grausiger Wächter, wenn er kommt, nicht so leicht durch das Tor eindringen kann, sonst bist du verloren.«
So schnell wie möglich wurden jetzt alle Tore fest geschlossen, und nur ein Torflügel wurde offen gelassen. Kaum war das geschehen, da wurde es völlig dunkel vor dem Tor, wo der Jüngling sich mit einer gewaltigen Hacke bereithielt, und durch das halb geöffnete Tor streckte ein ungeheurer Drache seinen Rachen und schnaubte Rauch und giftiges Feuer, da er merkte, daß man ihn nicht einlassen wollte.
Aber das Tor war fest, und ehe der Schlangenleib zur Hälfte hereinkommen konnte, lagen schon alle seine sieben Köpfe auf dem Boden, und augenblicklich wurde es im ganzen Schloß lebendig, und was da war vom geringsten Diener bis zur Prinzessin dankte seinem Retter.
Die Prinzessin aber war jetzt noch zehnmal schöner als früher, und mit der Bitte, sie nicht zu vergessen, wenn auch ihre Schwestern durch ihn befreit wären, gab sie ihm ein goldenes Krönlein und wünschte ihm viel Glück bei der Befreiung der Schwestern.
Bist doch ein rechtes Glückskind! dachte sich unser Held, als er das Schloß verließ, um nur ja recht bald zu den anderen beiden zu gelangen. Und als er nach wenigen Stunden mit den lieblichen Königskindern wieder zum Schloß zurückkam, da dachte er: Nun bist du noch ein weit seligeres Glückskind.
Durch seine Unerschrockenheit war es ihm gelungen, auch sie zu befreien, und von ihnen hatte er einen Ring und ein Kettlein aus hellem Gold bekommen, als Andenken an den Tag der Erlösung.
Nun begann die freudige Reise zum alten König zurück. Da mußten sie zum ersten Schloß zurück, wo der junge Retter sich am Strick herabgelassen hatte. Als sie zum Strick kamen, der von der Öffnung herab hing, die nach oben führte, gab der Sohn dem Vater und dem Polen, die, wie er wußte, oben seiner warteten, das Zeichen durch Anziehen des Strickes, und nun wurden zuerst die glücklich Befreiten hinauf gezogen.
Jetzt kam die Reihe an den Befreier selbst. Eben wollte er das Seil ergreifen, als es zu seinem Schrecken herab fiel, und von der Öffnung her kam es ihm gerade vor, als ob er den Polen und den Vater lachen hörte.
Da war guter Rat teuer - der Betrogene aber, denn das war er, wußte sich gar nicht zu helfen. Am meisten schmerzte ihn, daß er so ganz und gar allein war und auch seine Prinzessin nicht mehr sehen konnte. Jetzt fiel ihm das alte Männlein ein, das er früher gesehen hatte, das wollte er nun aufsuchen, um wenigstens eine Ansprache zu haben. Er fand es auch und klagte ihm, weil er sonst niemandem klagen konnte, seine große Not.
»Siehst du«, sagte da das Männlein, »wenn du mir auch übel mitgespielt hast, ich will dir helfen, wenn du mir folgst. Ich besitze die Kunst mich zu verwandeln, in was ich will. Nun verwandle ich mich in einen großen Adler und trage dich hinauf. Aber ich werde sehr matt vom Flug, und da mußt du geschwind ein Lamm schlachten und es in drei Teile zerteilen. Sooft ich dann schreien werde, mußt du mir schnell ein Stück geben, sonst fallen wir herab, und du bist tot.«
Was das Männlein versprach, erfüllte es auch sogleich, und so packte der Adler mit seinen Klauen den Jüngling, dieser aber trug das Fleisch. Dreimal hatte schon der schnell fliegende Vogel nach Futter geschrien, und noch waren sie nicht oben, als er zum vierten Mal schrie. Das Lamm war verzehrt - was nun? Schnell schnitt sich der Soldat ein Stück von seiner Wade herunter und gab es dem Adler zu fressen, denn anders wußte er sich nicht mehr zu helfen.
Einige Augenblicke noch, und sie waren oben. Der Adler war nun wieder zum alten Männlein geworden und dankte dem Soldaten herzlich für die Befreiung, die er dadurch erlangte, daß er ihm ein Stück von der Wade zu fressen gab.
»Das war das einzige Mittel meiner Rettung«, sagte es, »auch ich bin verzaubert worden, und jenes Haus, in das du und dein Vater zuerst gekommen seid, gehörte mir; nun übergebe ich es dir. Ich will dich auch zu einem Brünnlein führen, wo deine Wunde an der Wade alsbald heil wird, dann magst du deines Weges weitergehen.« Darauf war das Männlein, nachdem es ihm das Heilbrünnlein gezeigt hatte, fort, und er sah es nicht wieder.
Der erste Gedanke, den nun der junge Deserteur hatte, war, in die Stadt des Königs zu gehen, dessen Töchter er befreit hatte, und sei sie auch, wo sie wolle. Die anderen haben mich betrogen, dachte er, vielleicht betrügt mich das Glück nicht. Und richtig, das Glück schien ihn zu begleiten, denn eher, als er dachte, gelangte er ans Ziel seiner Reise.
Er befand sich schon nach einigen Tagen in der Königsstadt, wo alles vom Größten bis zum Kleinsten sich der Freude hingab und ihm jeder, den er fragte: »Warum so lustig, Bruder?«, froh zur Antwort gab: »Ja, weil die Königskinder wieder da sind und bald Hochzeit sein wird.«
Daß die Königskinder da waren, das war unserem Wanderer freilich lieb und recht, aber die Hochzeit kam ihm ein wenig zu schnell. Allein er konnte unter so vielen fröhlichen Gesichtern doch auch nicht traurig sein und mußte, als er erfuhr, der Vater und der Pole hätten sich für die Befreier der Prinzessinnen ausgegeben, zum schlechten Spiel gute Miene machen.
Nur eines gab ihm noch Hoffnung, seine drei Andenken: sein Krönlein, das Ringlein und das Kettlein. Ich will zum König gehen, sagte er zu sich selbst, bei der Hochzeit habe ich auch etwas dreinzureden, und er sah dann wieder die hohen Paläste und dies und das an, um sich zu zerstreuen.
Da gewahrte er einen Mann in einer offenen Werkstätte sitzen, und der feilte so emsig an einem goldenen Ding, daß ihn wundernahm, was das abgebe. Er ging hinzu und fragte: »Was feilt Ihr denn da? Ihr schaut Euch ja völlig die Augen heraus?«
»Das braucht es auch«, antwortete der Goldschmied, ohne aufzusehen, »wenn die Prinzessin eine schöne Krone bekommen soll und ich eine schöne Belohnung.«
»Ei, willkommen, Meister«, lachte nun der Wanderer, »ich bin ein Goldschmiedgeselle, wollt Ihr mich nicht in Dienst nehmen? Ich hoffe, Ihr sollt zufrieden sein.«
Der Meister gab ihm dazu bald sein Jawort, der neue Goldschmiedgeselle verlangte ein Zimmer allein, wo er ganz ungestört arbeiten könnte, und schloß sich nun, ohne sich viel sehen zu lassen, eine ganze Woche lang ein.
Dann nahm er sein Krönlein, gab es dem Meister und ging schnell wieder fort zu einem anderen Goldarbeiter, denn er hatte erfahren, daß auch ein Brautring und ein Halsgeschmeide für die zwei älteren Königstöchter noch angefertigt würden. Der Goldschmied war aber ganz erstaunt über die kunstvolle Arbeit der neuen Krone und hatte jetzt nichts Eiligeres zu tun, als diese ausgezeichnete Arbeit dem König zu zeigen.
Sobald aber der König und die Prinzessinnen das herrliche Krönlein sahen, schrie die jüngste laut auf, und die beiden älteren sahen einander freudig an, denn sie wußten wohl, wer dieses Krönlein einst getragen hatte, und waren nun voll froher Hoffnung, ihren wahren Befreier wiederzufinden.
Gleich mußte der Goldarbeiter alles erzählen, wie er zu dem Krönlein gekommen war, und als er nun vom fremden Gesellen sprach, da drängten alle, ihn schnell holen zu lassen. Jedoch schien alle Eile vergeblich, und selbst als der zweite Goldschmied mit dem goldenen Brautringlein, das ein fremder Geselle gefertigt hatte, sich vor dem König meldete, war alles Nachforschen umsonst und der fremde Künstler schon wieder fort.
Die Königskinder aber waren teils voll froher Hoffnung, teils traurig.
Inzwischen war es in der ganzen Stadt laut geworden, die vermeintlichen Befreier der Königstöchter seien böse Betrüger, und der eigentliche Befreier sei angekommen und halte sich wahrscheinlich
in der Stadt auf.
Unser junger Wanderer war bis jetzt schon beim dritten Meister als Lehrjunge im Dienst und sollte, so gut er nur immer könnte, ein goldenes Halskettlein machen, was er auch ganz auf die nämliche Art und Weise wie bei den vorigen Meistern zu tun versprach.
Der neue Meister aber war schlauer als die vorigen, und sobald er merkte, daß der Geselle sich nur so stelle, als ob er arbeite, während er sich aber in seinem abgeschlossenen Zimmer mit anderen Sachen beschäftigte, ging er in der völligen Gewißheit, den Vogel gefangen zu haben, in den Königspalast und meldete, er könnte Auskunft über den fremden Künstler geben, der Krone und Brautringlein gemacht hatte.
Gleich wurde zum Goldarbeiter geschickt, die königlichen Boten trafen den lang gesuchten Künstler bald an und überraschten ihn, wie er eben lächelnd das Halskettlein betrachtete. Sie führten ihn voll Freude zum König.
Das war nun ein schöner Tag für das ganze Königshaus und ein fröhliches Wiedersehen für den Befreier und die Befreiten. Kurz darauf nahm der Glückliche die schönste und jüngste der Königstöchter bei der Hand und führte sie zum Hochzeitstanz.
Dem Vater und dem Polen aber vergingen die lustigen Tage, denn sie wurden ins einsame Waldhaus verbannt zur Strafe für ihren Betrug, und sie fürchteten sich noch oft vor dem alten, tückischen Bettelmännlein.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Hall und zu Fließ im Oberinntal
DER BLINDE METZGER ...

Vor vielen Jahren lebte einmal ein Metzger, Hans mit Namen. Der war aber schon so alt, daß er blind geworden war und deshalb sein Geschäft aufgegeben hatte. Zu arbeiten hatte er aber auch gar nicht mehr nötig, denn er hatte sich ein hübsches Sümmchen erspart und lebte nun mit seiner Frau in Ruhe.
Da hörte er eines Tages, daß in einem nicht fernen Dorf ein großer Markt sei, und es stieg in ihm die alte Liebe auf, auch auf den Markt zu gehen und ein bißchen zu schachern. Er steckte deshalb einige Zwanziger in die Tasche und marschierte, seinen alten Haselstock in der Hand, auf den Markt. Als die anderen Metzger den Hans zwischen den Kühen und Ochsen herumtappen sahen, wollten sie sich einen Spaß machen und redeten untereinander ab, den Blinden jetzt einmal recht anzuführen.
Sie wünschten ihm freundlich einen guten Morgen und fragten, was er denn auf dem Markt eigentlich wolle. Auf seine Antwort, daß er gerne eine große, junge, schöne Kuh kaufen möchte, führten sie ihm eine recht schöne Kuh zu, und sie wurden wegen des Preises bald handelseins. Nachdem er das verlangte Geld auf den Tisch gezählt hatte, nahm er den Strick, woran die Kuh gebunden war, in die Hand und kehrte langsam nach Hause zurück.
Die Metzger aber hatten jetzt statt der Kuh einen Bock an den Strick gebunden und lachten sich satt, als der Hans, ohne den Betrug zu merken, mit dem Bock nach Hause ging. Dort angekommen, rief er sogleich sein Weib heraus, um die schöne Kuh anzusehen.
»Glaubst du, ich lass' mich foppen, daß ich einen Bock für eine Kuh anschauen soll«, sagte aber diese. »Zum Teufel«, sagte Hans, »was sprichst du denn von einem Bock! Es ist ja die schönste Kuh, die ich gekauft habe.« Er griff sogleich nach deren Rücken; da faßte er aber den Bock bei den Hörnern, der, über diese sonderbare Berührung aufgebracht, den Hans bald über den Haufen geworfen hätte.
Jetzt merkte er wohl, daß man ihn betrogen hatte, beschloß aber, sich für diesen Streich an den Metzgern zu rächen, koste es, was es wolle. Er steckte eine schöne Rolle Taler zu sich und ging augenblicklich wieder in das Dorf, wo der Markt gehalten wurde. Er setzte sich aber diesmal ein altes Hütl auf, das mit den sonderbarsten Figuren und Zeichen verziert und ein altes Erbstück seines Vaters war.
Im Dorf angekommen, ging er schnell zu drei Wirten und gab einem jeden ein hübsches Sümmchen Kronentaler und sagte, er werde mit einigen Metzgern kommen und das Geld verhauen; wenn das Geld verzehrt sei, so sollte man ihn heimlich stoßen; er werde dann sein Hütl herumdrehen und fragen: »Was bin ich schuldig?«, und der Wirt dürfe bloß sagen: »Ist schon bezahlt!«, weiter nichts. Dies ließen sich die Wirte nicht zweimal sagen.
Hierauf suchte er die Metzger auf, und wie er sie gefunden hatte, fragte er sie, ob sie nicht eine Halbe wollten. Sie erklärten sich sogleich bereit dazu und gingen mit ihm ins Wirtshaus. Da wurde gegessen und getrunken, als wenn Kirchtag gewesen wäre. Endlich stieß der Wirt ganz heimlich den Hans und bedeutete ihm, daß das Geld zu Ende sei.
Da fragte Hans die Metzger, ob sie nicht aufbrechen wollten; und da sie sich dazu bereit erklärten, drehte er dreimal sein Hütl herum und fragte: »Herr Wirt, was bin ich schuldig?« »Ist
alles bezahlt!« war die Antwort. Die Metzger staunten.
»Wenn das so steht«, sagte Hans, »so gehen wir in ein anderes Wirtshaus, denn ich habe versprochen, auch eine Halbe zu zahlen.«
Hier und im dritten Wirtshaus wiederholte sich das nämliche. Da wurden die Metzger endlich auf das Hütl aufmerksam und fragten, ob dieses eine solche Kraft besitze. Auf seine Bejahung baten sie ihn, es ihnen um 600 Gulden zu überlassen; denn er als alter Mann brauche es doch nicht mehr so nötig.
»Weil ihr meine guten Freunde seid«, meinte Hans, »ich aber schon alt und blind bin, so will ich euch das Hütl um 600 Gulden geben.« Sie zahlten ihm voller Freude die 600 Gulden, und Hans schlich sich ganz still und eilig nach Hause, wo er mit seiner Frau über die Betrogenen nach Herzenslust lachte.
Die Metzger ließen nun ihre Weiber und Kinder kommen, gingen ins Wirtshaus und ließen sich alles wohlschmecken bis tief in die Nacht hinein. Endlich wollten sie doch nach Hause gehen; deshalb setzte einer das Hütl auf, drehte es dreimal herum und fragte: »Herr Wirt, was bin ich schuldig?« »Werde gleich zusammenrechnen«, war die Antwort.
Da machten alle große Augen. Es setzte ein zweiter, ein dritter das Hütl auf, sie drehten es bald nach rechts, bald nach links und fragten immer, aber allzeit hieß es, man werde gleich zusammenrechnen, niemals aber, es ist schon bezahlt. Da mußten sie denn siebzig Gulden für die Zeche bezahlen. Jetzt sahen sie wohl, daß diesmal sie die Betrogenen waren, zahlten mit verhaltenem Zorn die Zeche und machten sich dann unter Fluchen und Schelten gegen morgen auf, um sich an dem blinden Hans zu rächen.
Dieser saß indessen mit seiner Frau beim Frühstück. Wie er die Metzger daherkommen hörte, befahl er ihr, über ihn ein Leintuch auszubreiten, einige Lichter anzuzünden, sich die Haare zu zerraufen und zu jammern und zu klagen, als wäre er in dieser Nacht gestorben. Wenn die Metzger kämen, so sollte sie dann einen davon bitten, daß er mit einem alten Stock, der im Kasten war, ganz leicht dreimal auf ihn klopfe, damit er vielleicht noch lebendig würde.
Sie tat, wie ihr befohlen war. Die Metzger hörten sie von weitem schon heulen und schreien, wußten aber gar nicht, was das bedeute. Wie sie näher kamen, sahen sie das Weib wie rasend im Haus herumlaufen, und fragten sie um die Ursache. Sie sagte zuerst gar nichts und führte sie bloß in die Stube, wo der Hans zwischen den brennenden Kerzen unter dem Tuch ganz mäuschenstill lag; bald aber bat sie einen von den Metzgern, indem sie den alten Stock mit den sonderbaren Figuren aus dem Kasten nahm, er möchte doch mit diesem dreimal ganz gelinde auf den Hans schlagen, vielleicht könnte er noch ins Leben zurückgebracht werden; denn es sei dies ein alter Zauberstab.
Da sie sich so erbärmlich gebärdete, daß sich darüber hätte ein Stein erbarmen müssen, da fühlten auch sie Mitleid mit der armen Frau, und einer von ihnen ergriff den Stab und schlug dreimal ganz gelinde auf den armen Hans. Kaum war dies geschehen, so regte sich Hans unter der Decke, erhob sich langsam von der Bank, rieb sich die Augen, als wäre er aus einem tiefen Schlaf erwacht, und fragte, wo er denn wäre. Allmählich zu sich gebracht, erzählte er den Metzgern seltsame Sachen, die er im Jenseits gesehen und gehört hatte.
Die Metzger hatten jetzt all ihren Groll und Zorn verloren und baten ihn, ihnen doch den Stock zu geben. Hans gab ihnen diesen für den wichtigen Dienst, den sie ihm geleistet hätten, und dazu mußten sie ihm noch 800 Gulden auszahlen, was sie mit Freuden taten, denn sie hofften, sich damit bald was zu verdienen.
Sie gingen gar nicht mehr nach Hause, sondern geradezu in die Residenzstadt, denn dort meinten sie mit ihrem Zauberstab Wunder zu wirken und bei den reichen Familien Millionen zu verdienen. Wie sie in der Residenz ankamen, war die ganze Stadt in größter Trauer; denn des Königs einziges, innig geliebtes Töchterlein war gestorben. Da ließen die Metzger dem König melden, sie seien imstande, seine Tochter ins Leben zurückzurufen.
Der König ließ sie sogleich rufen und zum Bett führen, auf dem die Prinzessin in schneeweißem Kleid lag. Alle Zuschauer wurden nun entfernt, und der älteste der Metzger ergriff den Zauberstab. Er schlug ganz sanft dreimal auf den Leichnam, aber dieser blieb leblos wie zuvor; da ergriff der zweite und nach diesem der dritte den Stock, aber keiner brachte die Prinzessin ins Leben zurück. Jetzt schlug bald der eine, bald der andere, bald stärker, bald schwächer, bis der König merkte, daß sie bloß Betrüger seien, weshalb er sie ins Gefängnis abführen ließ, wo sie etliche Wochen nachdenken konnten, wie sie sich an Hans für den neuen Betrug rächen wollten.
Aus dem Gefängnis entlassen und vor Rache dürstend überfielen sie heimlich in der Nacht das Haus, nahmen den Hans gefangen und banden ihn in einen großen Sack, um ihn in einen Fluß zu werfen. Um dem Hans die Todesängste recht fühlen zu lassen, ließen sie den Sack, worin er sich befand, auf der Brücke des Flusses stehen und gingen auf einige Zeit ins Wirtshaus, um dort ihre Hitze ein wenig abzukühlen.
Unterdessen schrie Hans im Sack in einem fort: »I will nit, i mag nit.« Wie er so schrie, kam ein Sautreiber mit einer großen Schweineherde über die Brücke und fragte: »Was willst du nit?« »Ja«, sagte Hans, »i soll die Königstochter heiraten, und das mag i nit.« »I möcht schoan«, meinte der Sautreiber. »Dann mußt du mi auslassen und dich in den Sack einbinden lassen.«
Der Sautreiber war damit einverstanden, öffnete den Sack, ließ den Hans heraus, schenkte ihm die ganze Schweineherde, ließ sich in den Sack hinein binden und schrie in einem fort: »I will schoan, i mag schoan«, während Hans nichts Eiligeres zu tun hatte, als die Schweine nach Hause zu treiben.
Wie die Metzger aus dem Wirtshaus kamen und den im Sack schreien hörten: »I will schoan, i mag schoan«, lachten sie hellauf und sagten: »Du magst wollen oder nicht, du mußt«, hoben den Sack vom Boden auf und warfen ihn über das Geländer in den Fluß, der ihn sogleich davontrug. »Jetzt hat der Kerl seinen Lohn«, sagten sie zueinander, »jetzt hat er Feiertag mit seinem Foppen.« Hans aber hütete unterdessen ganz wohlgemut seine Schweineherde.
Als nun nach einigen Tagen wieder ein Metzger an Hansens Haus vorbeiging und im Anger die große Schweineherde, den Hans selbst aber vor der Tür sich sonnen sah, da wußte er gar nicht, wie das zugehe, und fragte deshalb den Hans, ob er denn nicht im Wasser ertrunken sei.
»Gar nicht«, erwiderte der Gefragte, »sondern ich wurde lange fortgetragen, bis endlich der Sack aufging und ich mich an einem Ort befand, wo sich sehr viele Schweine befanden, aber keine Menschen, und damit ich den Weg dahin nicht umsonst gemacht hätte, trieb ich einige Schweine mit mir.«
Der Metzger blieb nicht lange beim Hans, sondern eilte zu seinen Genossen und erzählte ihnen, wie sie wider ihren Willen dem Hans zu einem so großen Glück verholfen hätten. »Da müssen wir schon auch nach dieser Gegend hin, um Schweine zu holen, und mit diesen einen großen, profitablen Handel anfangen«, meinten sie.
Gesagt, getan; sie legten ihre bessere Kleidung an und machten sich sogleich auf den Weg, schnurgerade auf den Fluß zu. Auf dem Weg machten sie aus, daß derjenige, der zuerst hineinspringen würde, den anderen zurufen solle: Kummt«, wenn nämlich das Wasser nicht gar zu tief wäre. Wie sie auf der Brücke angekommen waren, sprang einer ganz beherzt ins Wasser, so daß ein lautes Plump erhallte. Die andern glaubten, er rufe »kummt!« und sprangen insgesamt nach, schluckten aber zuviel Wasser und ertranken.
Hans hatte aber seit dieser Zeit vor ihnen Ruhe, und er konnte ganz gemächlich seine Schweinlein verzehren, wovon er gar fett wurde.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Zillertal
FÜRCHTEN LERNEN ..., II Märchen
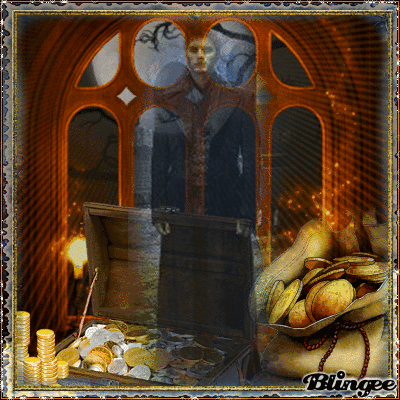
Es war einmal ein Vater, der hatte drei Söhne. Einer von ihnen hieß Hansl und war ein rechter Tölpel. Die anderen zwei waren schon in die Fremde gezogen, und der Vater wartete immer, ob nicht bald einer zurückkomme. Da fiel es eines Tages dem Hansl auch ein fortzugehen, denn er sagte, er müsse das Fürchten lernen, damit er sich unter ehrlichen Leuten sehen lassen könnte.
Der Vater wollte ihn zurückhalten, allein da half alles nichts, denn was der Hansl einmal im Kopf hatte, das konnte man mit Stock und Prügel nimmer heraustreiben.
Er ging nun eine gute Zeit immer der Nase nach und kam eines Tages in ein Wirtshaus. Da erzählte er, warum er auf dem Weg sei, und brummte auch oft vor sich hin: »Wenn ich nur das Fürchten bald lernte, damit ich wieder heimgehen und beim Vater bleiben könnte.«
Der Wirt ließ ihn nachmittags mit sich in den Stall gehen und zeigte ihm seine Pferde. »Hoi«, sagte der Hansl auf einmal, »woher hat denn der Herr Wirt diese zwei Rosse?« Denn er erkannte, daß es jene waren, auf denen seine Brüder in die Fremde geritten waren.
»Oh«, sagte der Wirt, »diese beiden haben zwei Fremden gehört, die da in das Schloß hinauf gegangen und nimmer zurückgekehrt sind. Aber, ist wohl wahr, da droben wäre ja für dich der beste Platz, da könntest du das Fürchten gleich von Grund aus lernen.«
Als das der Hansl hörte, war er voll Freude, ging sogleich in das Schloß und sah sich einmal alles an. Er fand da gar nichts Besonderes und ging wieder heraus. Da sah er an der Schloßmauer eine Hollerstaude, machte sich zur Kurzweil darüber her und pflückte Beeren.
Als es finster zu werden anfing, ging er hinauf in die Küche, schürte ein Feuer an und kochte ein Hollermannl. Er hatte die Pfanne eben über das Feuer gestellt, da kam einer zur Tür herein, der gar kein freundliches Aussehen hatte. Der Hansl aber fürchtete sich nicht im mindesten, blies zuerst besser an und sagte dann zu dem Kameraden:
»Ist recht fein, daß du auch kommst, denn so allein wird mir die Zeit lang. Ich habe schon so viel Hollermannl, daß wir beide genug haben; jetzt mußt du aber ein wenig warten, bis es gekocht ist.« Der andere wollte nicht warten und sagte: »Geh du sogleich mit mir!«
»Gleich kann ich nicht gehen«, erwiderte der Hansl. »Du mußt wissen, daß mir das Hollermannl anbrennt, wenn ich davon laufe, und wäre doch schade um die gute Sache.« Der andere ließ sich nicht überreden und schnarrte: »Wenn du nicht sogleich gehst, dann zerreiße ich dich.« »Du schaust genauso aus, als ob du jemand zerreißen könntest«, spottete der Hansl.
Der andere gab aber nicht nach und zog jetzt zartere Saiten auf, damit der Hansl mit ginge. »Schau«, sprach er, »deinem Hollermannl geschieht gewiß nichts, wenn du mit mir gehst. Ich gebe dir mein Wort dafür, daß du es wieder gut antriffst, und wenn es nicht so ist, dann kannst du mir antun, was du willst, sobald wir zurückkommen.«
Er Hansl hörte, daß seinem Hollermannl nichts geschehe, ließ er sich endlich bewegen und sagte, er wolle mitgehen. Da fragte aber noch der andere: »Fürchtest du dich denn gar nicht, wenn du mitgehst?« »Ist das eine Frage«, sagte der Hansl, »ich weiß ja nicht einmal, was fürchten ist, wie soll ich es dann erst zuwege bringen?«
Nun gingen sie über etliche Stiegen hinab und kamen zu einer Tür. »Da mach auf«, rief der Geist dem Hansl zu. »Du hast schon gehört«, erwiderte der Hansl, »daß ich keinen Spaß verstehe. Machst du nicht gleich auf, daß wir weiter kommen, so gehe ich hinauf und schaue zu meinem Hollermannl.«
Jetzt gab der Geist nach und machte auf. Als sie hinein kamen, war da ein ungeheurer Hund, der ein feuriges Maul zeigte und die zwei mit großen Augen anglotzte. Der Hansl wurde zornig, als der das Tier sah, und schrie: »Gedacht habe ich es mir zuvor, du wirst da einen Kerl haben, der mir mein Hollermannl frißt. Jetzt laufe ich gleich hinauf und lasse dich allein gehen.«
Der Geist besänftigte ihn, in dem er ihm wieder versprach, daß dem Hollermannl gewiß nichts geschehe. Dann fragte er ihn: »Hast du Mut, den Hund hinaus zu jagen?« »Warum soll ich dem Vieh nicht den Weg zeigen?« fragte der Hansl und rannte dem Hund so derb an den Leib, daß er davon lief wie der Wind und auf allen Seiten die Ganstern hinaus flogen.
Während der Hansl dem Hund nachschaute und lachte, war der Geist ein wenig weiter gegangen. Hansl sah das und schrie: »Halt ein bißchen, ich darf dich nicht zu weit von mir weg gehen lassen, damit ich dir die Schläge herab messen kann, wenn etwa das Hollermannl hin ist.« Der Geist wartete, und der Hansl kam nach.
Bald kamen sie an eine zweite Tür. Der Geist hieß den Hansl aufmachen, Hansl aber wurde zornig und fuhr ihn an: »Das Vieh frißt so schon das Hollermannl oben. Wenn du nicht gleich aufmachst, kriege ich gar nichts mehr.« Der Geist sagte: »Noch ist es ja heiß, so kann er es nicht fressen«, er tat aber dem Hansl seinen Willen und sperrte auf.
Als sie herein kamen, fanden sie abscheuliche Schlangen, und der Geist reichte dem Hansl eine Peitsche und sagte: »Da, jage die Schlangen hinaus.« Der Hansl wollte aber nicht recht anpacken, denn es war ihm um das Hollermannl zu tun, und er dachte, die scheußlichen Bestien könnten es ihm fressen.
Der Geist aber sprach ihm Mut zu und sagte: »Dem Hollermannl geschieht gewiß nichts, nimm du nur die Peitsche und verjage die Bestien!« Da nahm der Hansl die Peitsche, wichste den Schlangen ein paar auf den Rücken, und sie fuhren wie der Wind zur Tür hinaus. Die zwei gingen nun weiter und kamen zur dritten Tür.
»Mach auf da!« sagte der Geist. Der Hansl aber machte nicht auf, sondern begehrte lieber einen Besen, um die Schlangen droben zu verjagen, wenn sie sein Hollermannl angreifen würden. Da sperrte denn der Geist selber auf und hieß den Hansl mit sich hineingehen. Da standen nun drei Fässer, und darin lagen viele Schlangen und anderes abscheuliches Getier.
»He, Hansl«, rief der Geist, »nimm die Kreaturen und wirf sie hinaus!« »Jetzt ist es gleich, ob ich dir gehorche oder nicht«, sagte der Hansl, »denn das Hollermannl ist doch hin. Sag nur, wo ich anpacken soll.« »Anpacken kannst du, wo du willst«, antwortete der Geist. »Dann ist es auch recht«, sagte der Hansl, rannte an ein Faß und warf alles heraus, ging dann zum zweiten und dritten und machte es ebenso.
Als die abscheulichen Tiere aus dem Faß waren, fuhren sie schleunig zur Tür hinaus und ließen sich nicht mehr sehen. Aber in den drei Fässern war jetzt lauter Geld, und zwar im ersten Kupfer, im zweiten Silber und im dritten nichts als Gold.
Der Hansl machte große Augen bei den drei Fässern, und der Geist sagte: »Jetzt will ich dir auch Weis' und Lehre geben, was du mit den drei Fässern zu tun hast. Das Kupfer teilst du unter die armen Leute aus, das Silber gibst du an arme Klöster und Kirchen, und das Gold behältst du für dich. Jetzt lebe wohl, und ich bedanke mich für die Erlösung!«
»Oho«, schrie der Hansl, »ich muß zuvor sehen, ob mein Hollermannl noch droben ist, sonst kommst du mir ohne Schläge nicht fort.« Hiermit packte er den Geist und führte ihn hinauf in die Küche. Das Hollermannl war ordentlich gekocht, und kein bißchen davon war verbrannt oder aufgefressen. Das gefiel dem Hansl, denn er hatte großen Hunger, und es wäre ihm jetzt um nichts mehr leid gewesen als um das Hollermannl.
»Iß da«, sagte er zum Geist, »du schaust nicht aus, als ob du zu viel zu essen bekämst.« Der Geist aß aber nicht und wurde immer blasser und blasser. »Iß da«, sagte der Hansl noch einmal und stellte die Pfanne vor ihn hin. Der Geist aber aß immer noch nicht und wurde endlich ganz weiß.
Da sagte er zum Hansl: »Du hast mich endlich erlöst, nachdem viele ihr Leben daran gesetzt haben und zugrunde gegangen sind. Hätten sie auch soviel Mut gehabt, so wäre ich lange schon erlöst und hätte nicht erst auf dich warten müssen. Aber zum Dank sollst du jetzt außer dem Geld auch noch das Schloß haben.«
Am anderen Morgen ging der Wirt vor das Haus, schaute zu dem Schloß hinauf und dachte: Den hat es wohl auch. Jetzt wird er wohl wissen, was Fürchten ist.
Da kam gerade der Hansl heraus, sah den Wirt und rief: »Nur geschwind mit Rossen herauf, wir müssen das Geld hinabführen.«
Da wunderte sich der Wirt sehr, ging hinauf und fragte, wie es die Nacht zugegangen sei. Der Hansl erzählte alles, beklagte sich aber, daß er noch nicht fürchten gelernt habe. Da redete ihm der Wirt zu und sagte, er sollte doch einmal nach Hause gehen und dem Vater von seinem Glück erzählen, denn das Fürchten sei nicht eine gar so wichtige Sache.
»Ja, es wäre leicht, heimzugehen, wenn ich auch das Geld mit brächte«, sagte der Hansl. Da versprach der Wirt ihm ein Fuhrwerk zu leihen, und der Hansl fuhr mit einem Haufen Geld zum Vater heim. Da wird er ihm wohl auch von den zwei Brüdern erzählt haben, die im Schloß zugrunde gegangen sind. Ob er aber noch einmal ausgezogen ist, das Fürchten zu lernen, das kann niemand sagen.
[Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, bei Schlanders
DIE FURCHTLERNER ...
Es war einmal ein Vater, der hatte eine große Schar Kinder. Im Frühling stiegen die Kinder öfter auf die Kirschenbäume, und da ereignete es sich einmal, daß der älteste Bub herabfiel. Der Vater stand unten und schrie: »Holla, jetzt bin ich erschrocken!« Da stand der Bub sogleich auf und fragte: »Vater, was ist denn erschrecken?« »Was erschrecken ist«, antwortete der Vater, »das wirst du schon lernen, wenn du in die Welt hinauskommst.«
Da ließ sich der Sohn nicht mehr aufhalten und sagte, es wundere ihn gar sehr, was das Erschrecken sei, und er müsse schnell in die Welt hinausgehen, um diese Kunst zu studieren. Der Vater ließ ihn gehen, weil er doch noch Kinder genug daheim hatte, und dachte sich: »Das Erschrecken wirst du bald genug lernen, darum habe ich keinen Kummer.«
Der Bub ging mutterseelenallein der Landstraße nach, und wenn ihn jemand anredete und fragte, wo er hingehe, dann sagte er immer nur: »Ich gehe erschrecken lernen.« Da lachten ihn denn die Leute aus und ließen ihn wieder allein gehen, denn sie meinten, er wäre ein Halbnarr, mit dem sich nicht viel anfangen lasse.
Eines Abends kam er zu einem Wirtshaus, und da es schon spät war, kehrte er ein, um da über Nacht zu bleiben. Weil er ganz allein und verlassen an einem Tisch saß, erbarmten sich einige Leute über ihn, setzten sich an seinen Tisch und wollten ihm Gesellschaft leisten. Sie kamen mit ihm auf allerlei zu reden und fragten ihn unter anderem, wo er hingehe.
»Erschrecken lernen«, gab er zur Antwort. Da lachten sie ihn aus und sagten: »Wenn du nur das willst, so wissen wir einen guten Ort, wo du es lernen kannst.«
»Und wo ist der Ort?« fragte der Bub. »Siehst du«, sagten sie, »da drüben hat der Wirt ein Schloß, dahin mußt du gehen, und du wirst das Erschrecken als bald kennen.«
Sogleich stand der Bub auf, ging zu dem Wirt und bat ihn, er solle ihm doch sogleich das Schloß auftun, damit er einmal lerne, was erschrecken sei. »Das kannst du drüben wohl lernen«, sagte der Wirt, führte ihn zum Schloß und ließ ihn hinein. Hinter ihm sperrte er die Tür wieder zu, das war aber dem Buben gleich, denn er dachte, zuletzt würden sie ihn wohl doch wieder hinauslassen.
Er ging nun hinauf in die Küche, suchte das bißchen Holz zusammen, das noch unter dem Herd lag, und machte ein Feuer an. Es ging gegen Mitternacht, und das Holz war beinahe schon abgebrannt, so daß er meinte, er müsse bald im Finsteren bleiben. Da regte sich auf einmal etwas im Kamin, und es fiel ein Stück Totenbahre herab.
»Zu einer besseren Zeit hättest du nimmer herabfallen können«, sagte der Bursche, nahm das Holz und schürte es an. Das Feuer leuchtete ihm nun wieder ein bißchen heller, und er hoffte, wenn es zu Ende ging, so würde wohl wieder etwas herabfallen. Auf einmal regte es sich wieder im Kamin, und es fiel eine Hand herab. »Ist auch zu brauchen«, sagte er, »jetzt habe ich drei Hände, damit geht das Arbeiten leichter.«
Bald darauf rumpelte es wieder, und es kam ein Fuß. »Auch gut, zu drei Händen gehören drei Füße. Wie ist es, kommt noch etwas nach?« Es rumpelte wieder, und da kam noch eine Hand, und dann rumpelte es noch einmal, und es fiel wieder ein Fuß herab. »Jetzt ist es gar gut, habe ich ja vier Hände und vier Füße. Wenn etwas inzwischen hinein und oben darauf käme, so wäre es ja ein ganzer Mensch.«
Auf einmal rumpelte es viel ärger, und es fiel ein Rumpf auf den Herd. Da ging der Bursche hinzu, legte die Hände und die Füße, wo sie hingehörten, und siehe da, alles wuchs so fest zusammen, als ob es nie getrennt gewesen wäre. »So, jetzt wärst du ein Kerl, es ist schade, daß du nicht einen Kopf auch noch hast.«
Da rumpelte es wieder, und es kugelte ein Kopf herab. Den faßte der Bursche bei den Haaren und legte ihn an seinen Platz. Der Kopf wuchs sogleich an, und der Bursche hatte seine Freude mit dem neu gemachten Menschen, der auf dem Herd lag. »Gut«, sagte er, »jetzt bist du ja ein Kerl, fast stärker als ich.«
Da erhob sich der Neugemachte, sprang vom Herd herab und rief: »Jetzt will ich dich zerreißen.« »Was, du mich zerreißen, wenn ich dich gerade zusammen gemacht habe! Halts Maul mit solchen
Reden, oder ich zeige dir, was zerreißen ist.« Da wurde der andere ein wenig sanfter und sagte: »Jetzt geh mit mir!«
»Mit dir gehen will ich schon«, antwortete der Bursche, und ging mit.
Sie kamen in einen tiefen Keller hinab, und da lagen drei große Haufen Geld. Der Geist hub wieder an zu reden und sprach: »Von diesen drei Haufen gehört einer dir, einer den Armen und einer dem Wirt. Das Schloß gehört auch dir, und der Wirt, der es bisher ungerechterweise besessen hat, bekommt für die wenigen Ansprüche, die er darauf hat, den Haufen Geld. Ihr werdet jetzt wieder sicher in dem Schloß wohnen können, wenn es nicht mehr einem unrechtmäßigen, sondern dir als rechtmäßigem Besitzer gehört.«
Hiermit verschwand der Geist, und der Bursche war mutterseelenallein in dem Keller. Morgens ging er hinauf und schaute, ob der Wirt die Tür schon aufgesperrt habe. Als er hin kam, war sie schon offen, und die Wirtsleute standen vor dem Schloß, um zu sehen, ob es vielleicht doch einmal einem geglückt wäre, mit dem Leben davon zu kommen.
Als er frisch und gesund zur Tür hinaus kam, lachten sie und riefen: »Wie ist es, weißt du jetzt, was erschrecken ist?« »Nein, das weiß ich noch nicht, aber etwas anderes kann ich euch sagen, wenn ihr mit mir geht.« Sie wunderten sich, was das etwa sei, und gingen mit. Er führte sie in den Keller, zeigte ihnen die drei Haufen und sagte:
»Der Geist, der in der Nacht gekommen ist, hat mir das Schloß geschenkt und einen von den drei Haufen. Der andere Haufen gehört dem Wirt und der dritte den Armen.« Als die Wirtsleute das hörten, beneideten sie den Buben und die Armen um das, was sie bekommen sollten, und ihr Neid war so groß, daß sie über den armen Kerl her fielen und ihn mausetot schlugen. Da verschwanden aber augenblicklich die drei Haufen, und in dem Schloß war es wieder unheimlich wie vordem.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
DER SCHLAFENDE RIESE ...

Es schlief einmal ein Riese knietief und schnarchte, daß die Bäume weit und breit zitterten. Da fuhr ein Fuhrmann mit seinem Lastwagen, an dem acht Paar Rosse zogen, des Weges daher und dachte sich: Das ist heute doch ein Sturmwind, daß die Bäume so sausen.
Als er schon lange gefahren war, kam er zum Riesen, hielt ihn für einen Berg und fuhr darüber. Er fuhr wacker zu und glaubte immer noch, er befinde sich auf dem rechten Weg. So ging es lange fort, bis er zur Nase des großen Mannes kam. Da dachte sich der Fuhrmann: Hier sind jetzt zwei Hohlwege, und er wußte nicht, ob er in den linken oder in den rechten einfahren sollte.
Endlich meinte er: Ich wage es einmal und schlage den Weg rechts ein, und er lenkte in das linke Nasenloch des Riesen. Wie er so hinein fuhr, kitzelte das Fuhrwerk den Riesen. Der wachte darob auf, mußte niesen und nieste so, daß das Fuhrwerk vier Meilen weit davon flog. Das ließ sich der Fuhrmann in Zukunft gesagt sein und war mehr auf der Hut.
Und was geschah weiter?
Muß ich dir etwas erzählen
Von Bohn' und Fisälen,
Von rotzigen Buben,
Von Kraut und von Ruben?
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Absam
DIE KRÖTE ...

Ein mutwilliger Bub legte einmal einen brennenden Schwamm auf den Rücken einer großen Kröte, die an einer Mauer saß. Da kniete das arme Tier auf, faltete die Vorderpratzen und sah den Knaben so flehend an, daß er gleich den Zunder wegnahm. Die Kröte war aber eine arme Seele gewesen.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Absam
DER KLAUBAUF ...
Es hatten einmal zwei blutarme Leute ein recht böses Kind, das ihnen viel Verdruß machte. Die Mutter sagte wohl oft zu ihm: »Wenn du nicht folgen willst, so geb ich dich dem Klaubauf.« Aber das
fruchtete wenig bei dem Rangen, der seine Wege ging und die Ermahnungen seiner Eltern in den Wind schlug. So trieb er es lange Zeit.
Da nahte denn wieder der St.-Nikolaus-Tag, und am Vorabend kam wirklich ein Klaubauf in die arme Hütte. Der Klaubauf hatte gar lange Hörner und große, feuersprühende Augen. Schellend und polternd
trat er in die Stube, wo sich das unfolgsame Kind befand, und frug die Eltern mit hohler Stimme: »Darf ich den Fratzen mitnehmen?« Die Eltern bejahten seine Frage. Er wiederholte sie zum zweiten
und zum dritten Male, und als die Eltern immer mit Ja antworteten, nahm er das Kind und trug es zur Tür hinaus. Draußen fuhr er mit dem Kind, das laut aufschrie und um Hilfe rief, durch die Luft
von dannen. Die armen, bekümmerten Eltern mochten sich wohl abhärmen und nach dem Kind forschen, sie konnten keine Spur mehr von ihm entdecken.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Paznaun
DAS FROMME KIND ...
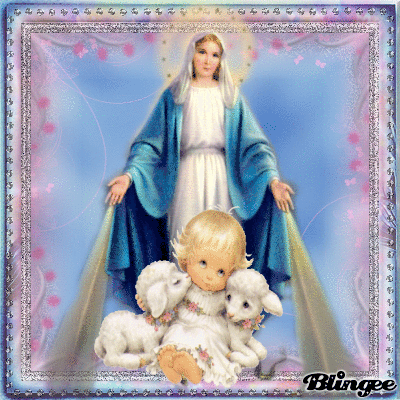
Es war einmal ein gar gutes, frommes Mädchen, das trieb die Schafe auf den Berg und hütete sie dort. Auf dem Berg war aber ein Bildstöcklein der Muttergottes, und dem machte das Mädchen Kränze
und band ihm Blumensträuße zusammen. Einmal wand es ihm wieder ein Kränzlein, und da lief es um Blumen so hin und her, daß es voll Ritze wurde. Und wie es mit dem Kranzl fertig war, war es schon
stockfinstere Nacht.
Da ist es dem Kind schlecht gegangen, denn es konnte nicht heimfahren und nirgends hineinkommen und mußte über Nacht bei den Bamberlen liegen. Das Kind schlief aber auch da süß, bis der Morgen
kam. Wie es Tag zu werden anfing, gingen die Leute das Kind suchen und fanden es ganz zerritzt und zerkratzt im Stall bei den Bamberlen liegen. Und bei ihm stand die Muttergottes, die so aussah
wie auf dem Bildstöcklein. Nur noch viel schöner war sie und leuchtete wie die Sonne. Neben ihr standen viele Engel und glänzten und sangen, und wie die Muttergottes fortging, gingen auch die
Engel mit und nahmen das fromme Mädchen mit sich in den Himmel.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, aus Algund
DIE HEUGABEL ...
Es kam einmal ein Bauer zu seinem Nachbarn und bat ihn recht inständig, er möchte ihm doch helfen beim Heu Einführen. Denn er habe so gewaltig viel auf den Wiesen liegen, daß seine Leute allein nicht imstande seien, alles heute noch einzubringen. Der Nachbar aber machte dicke Ohren und schlug ihm die Bitte ab.
Nachmittags, als der Bauer sein Heu zu einem Haufen zusammen gerecht hatte, kam ein Wirbelwind und trug das Heu bei Putz und Stengel hinweg. Der Bauer hatte das Nachsehen und wurde so ärgerlich, daß er die Heugabel in die Höhe warf und schrie: »Weil der Teufel das Heu fort getragen hat, soll er die Gabel auch dazu nehmen.« Und richtig, wie die Gabel aus seinen Händen fuhr, flog sie lustig auf und davon.
Bald darauf erkrankte der Nachbar. Er mußte lange Zeit das Bett hüten, und die Leute sagten schon herum, daß er in keiner guten Haut stecke. Der Bauer hörte freilich auch von der Krankheit seines Nachbarn, er ging aber gar nie hin, um ihn zu besuchen. Die Krankheit wurde alleweil ärger, und alle Leute, die den Kranken sahen, schüttelten den Kopf und meinten: »Holla, mit dir ist es Matthäus am letzten.«
Wie der Bauer in einem fort hörte, daß es mit dem Nachbarn so schlimm stehe, ging er in sich und dachte: Kopf machen ist nie fein gewesen. Er verzieh ihm, ging ihn besuchen und fragte mit dem freundlichsten Gesicht um allerlei: »Wie geht es? Wo tut es weh? Was sagen denn die Dokter? Konn dir gor koaner helfen?«
Auf diese Frage schaute ihn der Kranke wehmütig an und sagte: »Na, Dokter konn mar koaner helfen, ober du konnst mar helfen.« Während er das sagte, schob er das Federbett bei Seite und zeigte dem Nachbarn eine Heugabel, die in seiner Hüfte stak.
Der Nachbar erschrak zuerst, zog aber die Heugabel schleunigst heraus, und der Kranke konnte bald aufstehen und seine Arbeit tun wie zuvor.
Österreich: Ignaz und Joseph Zingerle: Kinder und Hausmärchen aus Süddeutschland, Meran
