MÄRCHEN AUS DEM BALTIKUM: Estland, Letland, Litauen, Lappland ...,
VERZEICHNIS I
"Der Räuber Nachtigall"
"Der Bauer und die drei Teufel"
"Der gehörnte Pastor"
"Der Fuchs und der Krebs"
" Kastute"
"Warum der Schwarzspecht auf die Bäume hackt"
"Der Diebslehrling"
"Jokima und sein Vater Grumpis"
"Das kluge Weib"
"Der Bettler und die reiche Bäuerin"
"Der geizige König"
"Der Bösen Tochter und das Waisenmädchen"
"Das vergessene Kind"
"Wie eine Königstochter sieben Jahre geschlafen hat"
"Wie ein Königssohn als Hüterknabe aufwuchs"
"Das Werwolfsfell"
"Gut und schlecht"
"Der Glückliche und der Unglückliche"
"Der Hund und die Katze"
"Die Krähe und der Fuchs"
"Fliege und Spinne"
"Die drei guten Worte"
"Die drei genasführten Freier"
"Die Stiefmutter"
"Der Hausgeist"
"Der kluge Ratgeber"
"Der Reiche drischt"
"Die Tiere gehen zur Beichte"
"Die Geldmühle"
"Der Schlangenkamm"
"Des Nebelberges König"
"Wie der Rabe die Meise freien wollte"
"Des Krähenmännchens Heirat"
"Die wunderbare Flöte"
"Der Tod auf dem Apfelbaum"
"Pikkers Dudelsack"
"Der Lohn für die Rettung des Teufels"
"Die Mücke und das Pferd"
"Wie der Gutsbesitzer in den Himmel kam"
"Das Gutspferd und das Bauernpferd"
"Wie ein Mann Hausfrau war"
"Wie ein Bauer auf seinen Tod wartete"
"Zwei Leichen und ein schwanzloses Pferd"
"Der Aschewicht"
"Die Färber des Mondes"
"Hans und der Teufel"
"Die kämpfenden Brüder"
"Der Bräutigam mit der goldenen Nase" (zweites Märchen)
"Wie drei Brüder ihr Glück machten"
"Warum die Bäume nicht mehr reden"
WARUM DIE BÄUME NICHT MEHR REDEN ...
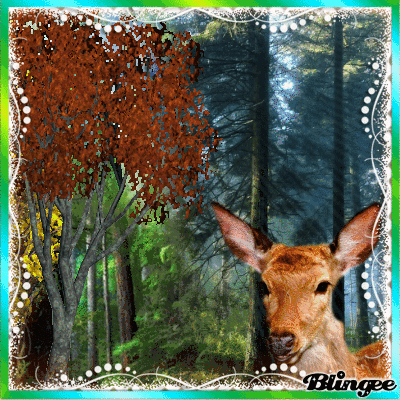
Vor alters konnten die Bäume reden. Jetzt haben sie zwar auch eine Seele, was man daran erkennt, daß sie wachsen, Blüten und Früchte bringen, wozu ein abgehauener Baum nicht mehr imstande ist; die Sprache aber ist ihnen genommen. Und das ist so zugegangen:
Ein Bauer ging in den Wald, um Holz zu hauen. Der erste Baum, den er abhieb, war eine Tanne, aber aus ihrem Innern scholl ihm eine Stimme entgegen: 'Haue mich nicht! Siehst du nicht, wie zähe Tränen aus meinem Fleische hervordringen? Es würde dir übel gehen, wenn du mir das Leben nähmest.' - Der Bauer wandte sich zu einem Fichtenbaume und hob seine Axt gegen ihn auf. Die Seele des Baumes aber rief ihm zu: 'Haue mich nicht um! Du würdest wenig Nutzen von mir haben, denn mein Holz ist gewunden und ästig.' Unwillig wandte sich der Bauer zu einem dritten Baume, der Erle, und begann sie umzuhauen. Der Baumgeist aber schrie: 'Hüte dich, mich zu verletzen! Bei jedem Hiebe dringt Blut von meinem Herzen heraus und färbt mein Holz und deine Axt blutig.'
Betrübt gab der Bauer seine Versuche auf und schickte sich an, nach Hause zu gehen. Als er aus dem Walde heraustrat, begegnete ihm der Herr Jesus und fragte, weshalb er so mißmutig aussehe. Er erzählte sein Mißgeschick. Da antwortete ihm der Herr: 'Kehre nur wieder um und haue ab, was du willst; denn von jetzt an werde ich den Bäumen verbieten, zu reden und den Menschen zu widersprechen.' Es geschah, und seit der Zeit wagt es kein Baum, gegen die Axt des Menschen die Stimme zu erheben.
Doch hört man es im Walde noch sanft rauschen und die Blätter sich bewegen, wenn die Bäume leise miteinander flüstern.
Estland: Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Volksmärchen
WIE DREI BRÜDER IHR GLÜCK MACHTEN ...
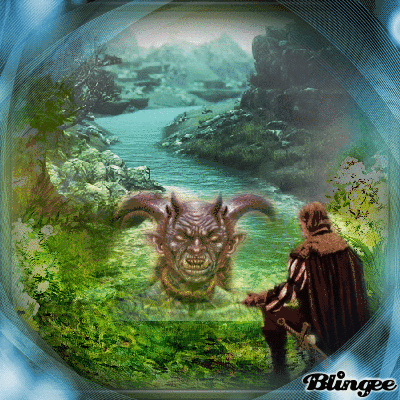
Ein alter Mann starb, drei Söhne blieben zurück. Die Söhne teilten den Besitz des Vaters: einer bekam ein Riegensieb, der andere eine Katze und der dritte ein Bastbund.
Der Siebmann ging das Riegensieb verhandeln. Geht und sieht: ein alter Mann schwingt mit bloßen Händen Roggen. Der Siebmann schwingte seinen Roggen fertig. Der alte Mann ist sehr guten Mutes und will das Sieb kaufen. Der andere Mann war auch gar nicht abgeneigt, sondern sagte: "Wenn du mir das Sieb voll Geld füllst, kannst du es haben!" Der alte Mann gab es ihm.
Ging der Katzenmann in die Stadt, die Katze zu verhandeln. Ein Gutsherr kommt ihm entgegen, fragt: "Was für ein Tier ist das?" "Das ist der Mäusekönig." Der Mäusekönig wurde in die Kammer gesteckt, wo viele Mäuse waren. Am Morgen waren sie alle kalt. Der Herr fragte: "Was kostet der Mäusekönig?" "Decke die Katze mit Geld zu, so daß man nichts von ihr sieht", sagte der Katzenwirt. Der Herr tat es und bekam die Katze.
Nun ging das allerjüngste Söhnlein mit seinem Bastbund los. Geht zu einem Fluß und fängt an, eine Bastschnur zu flechten. Der Teufel kommt aus dem Fluß heraus und fragt: "Mann, was tust du?" "Ich mache einen Strick, damit wird das Geschlecht der Teufel vernichtet." Der Teufel verlegt sich aufs Bitten: "Ich zahle eher, aber vernichte uns nicht!" "Na, wenn du mir diesen Fluß voll Geld bringst, werde ich sie nicht vernichten." Der Teufel trug den Fluß voll Geld, und der Lindenbastmann wurde der allerreichste Mann.
Quelle: Märchen aus Estland
DER BRÄUTIGAM MIT DER GOLDENEN NASE ...
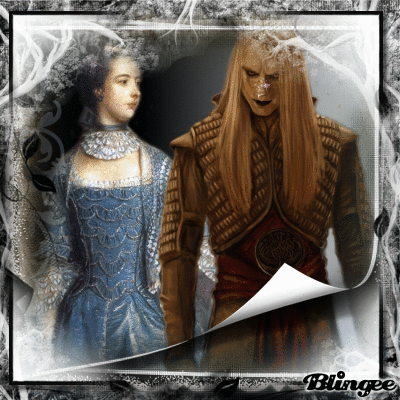
Es war einmal ein sehr schönes und stolzes Mädchen. Jeden Tag kamen Freier, die sie haben wollten, aber keiner gefiel ihr, denn jeder hatte ja eine natürliche Fleischnase, und das Mädchen wollte einen Mann, der eine goldene Nase hatte.
Als sie nun genug Freier heimgeschickt hatte, ohne die gewünschte Goldnase zu finden, zog sie selbst in die Welt, um sich einen Bräutigam zu suchen. Sie reiste und reiste, aber ohne besseren Erfolg. Schließlich fand sie jedoch den gewünschten Bräutigam mit der goldnen Nase; das war aber Zauberei und ging nicht mit rechten Dingen zu.
Als das Mädchen den Bräutigam fand, saß er gerade in seiner Kammer und machte Stiefel. Sofort hatte er dem Mädchen gefallen, und was brauchte man da mehr, als die Verlobung abzuschließen? Die Verlobung kam auch wirklich zustande. Die Goldnase verlangte aber, daß die Braut vor der Trauung mit ihm an drei Kirchen vorbeifahre; darauf ging sie auch ein.
Die Zeit der Trauung kam heran. Der Bräutigam ließ zwei schwarze Hengste vor den Wagen spannen, setzte sich dann mit seiner Braut in den Wagen und jagte zur ersten Kirche. Als sie vor der Kirche an kamen, ging er hinein und sagte seiner Braut, sie solle im Wagen so lange warten, bis er zurück kehre. Die Braut gehorchte. Der Bräutigam war ziemlich lange in der Kirche, kam aber noch vor den Kirchenbesuchern heraus, setzte sich in den Wagen und jagte zur zweiten Kirche.
Im Augenblick waren sie angelangt. Dort machte der Bräutigam Goldnase es ebenso wie bei der ersten Kirche und ließ die Braut im Wagen sitzen, ging selbst in die Kirche und kam ebenso vor den Kirchgängern heraus; dann jagte er zur dritten Kirche. Hier tat er das selbe, blieb aber recht lange in der Kirche. Die Braut dachte: 'Wer weiß, was er in jeder Kirche tun mag?' Sie stieg aus dem Wagen, ging ins Kirchenvorhaus und blickte durchs Schlüsselloch hinein.
Aber was sieht sie da! - Ihr geliebter Bräutigam, die Goldnase, frißt in der Kirche Leichen, gerade zu der Zeit, wo der Pastor die Toten einsegnet! Sie stieg wieder in den Wagen und wartete auf die Goldnase. Sie kam auch bald, und die Fahrt ging wieder los, aber diesmal nach Hause.
Unterwegs fragte die Braut den Bräutigam, weshalb er in die Kirchen gegangen sei. Er antwortete, daß er es getan habe, um den Gottesdienst anzuhören. Die Braut konnte aber ihr Geheimnis nicht mehr bei sich behalten und erzählte ihm alles, was sie durchs Schlüsselloch in der Kirche gesehen hatte.
Als der böse Geist das hörte, geriet er in Zorn, weil die Braut sein Verbot übertreten hatte, und erwürgte sie mit schauerlichem Gebrüll.
So endete das Leben des stolzen Mädchens.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DIE KÄMPFENDEN BRÜDER ...
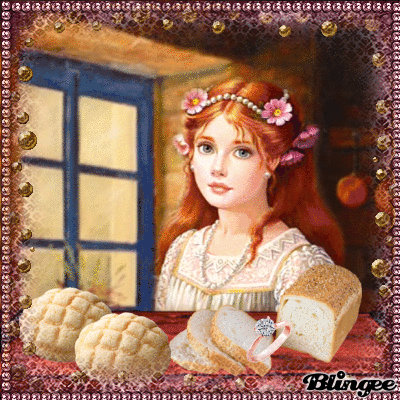
Es lebte ein Mann mit seiner Frau, die hatten drei Söhne und eine Tochter. Die Frau starb, der Mann nahm sich eine andere Frau - das war eine Hexe. Und so lebten sie nun miteinander.
Einstmals fuhr der Mann mit der Frau zur Kirche. Die Söhne sagten: »Wie, sind sie in die Kirche gefahren?« Ein jeder ging, um sich ein Pferd auszusuchen; ein jeder aber wollte das beste haben, so zankten sie und kämpften, bis der Vater und die Mutter zurück kamen. »Warum kämpft ihr?« - »Um die Pferde kämpfen wir!« - »Kämpft ihr jetzt, so möget ihr euer Leben lang kämpfen!« fluchte die Mutter. Kaum war das Wort heraus, so gingen die drei, immer noch kämpfend, davon.
Jetzt blieb nur noch die Schwester nach; aber diese wurde von der Hexe geschlagen und gequält; Hunger mußte sie leiden, sogar ihrem Leben stellte man nach. Die Schwester entfloh und dachte: 'Vielleicht finde ich meine Brüder.'
Sie ging und ging, bis sie zu einer alten, verfallenen Hütte kam, und da ging sie hinein und fand dort einen alten Mann. »Guten Tag, liebes Kind, wohin gehst du?« - »Ich gehe, meine Brüder zu suchen.« - »Wo sind denn deine Brüder geblieben?« Das Mädchen erzählte dem Alten, wie die Stiefmutter die Söhne verwünscht habe. »Leg dich hin, liebes Kind, vielleicht kann ich dir helfen.«
In der Nacht rief der Mann alle Tiere im Walde zusammen, die Wölfe, die Bären, die Füchse, die Elche - kurz alles, was sich im Walde bewegte. »Ihr kommet in alle Welt, sahet ihr nicht drei kämpfende Brüder?« Niemand aber hatte sie gesehen.
»Mach dich wieder auf den Weg, liebes Kind«, unterwies sie der Alte am anderen Morgen, »du wirst bald zu einer eben solchen Hütte kommen, wie die meinige ist; vielleicht findest du dort Hilfe, ich vermag dir nicht zu helfen.«
Das Mädchen ging und ging und kam zu einer verfallenen Hütte; drin wohnte auch ein altes, graues Männlein. »Wo führt dich denn Gott her, liebes Kind?« Das Mädchen erzählte ihm, weshalb sie wandere. »Leg dich hin; der Morgen ist klüger als der Abend!«
Der Alte ging in die Nacht hinaus vor die Hütte und rief: »Es sollen sich versammeln alle Vögel, die unter dem Himmel fliegen!« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so entstand ein Rauschen, ein Brausen auf allen Seiten. Es flogen zusammen alle Vögel, die kleinen wie die großen. »Ihr sehet die ganze Welt; sahet ihr nicht die drei kämpfenden Brüder?« - »Wir haben sie gesehen; über neun Könige Land, am Meeresstrand, da kämpften sie mit eisernen Keulen.«
Der Alte gab dem Mädchen einen Knäuel. »Wohin dieser rollt, dahin folge du nach!« Der Knäuel rollte zu den Brüdern. Da war ein altes Hüttlein; im Hüttlein alles leer, nur drei Brötlein auf dem Tisch. Das Mädchen nahm des ältesten Bruders Brötlein und schnitt es an.
Die Brüder kamen nach Hause. Der älteste erblickte sein Brot und sagte: »Wer hat mein Brötlein angeschnitten?« Die andern meinten: »Gott gibt uns Brot, er hat es vielleicht auch genommen.« Die Schwester hielt sich hinter dem Ofen versteckt; sie sah, wie die Brüder in großer Eintracht lebten: sie küßten einander, und es fiel kein böses Wort. Doch als die Zeit zum Kämpfen kam, da nahmen sie ihre Keulen, begaben sich an den Meeresstrand und schlugen wieder aufeinander los.
Die Schwester nahm nun des zweiten Bruders Brötlein, zerschnitt es und versteckte darin der Mutter Ring. Die Brüder kamen nach Hause und schauten: »Wer mag das getan haben?« Sie erkannten ihrer Mutter Ring. »Vielleicht ist es unsere Schwester, die uns den Ring gebracht hat? - Schwester, bist du's, dann tritt hervor!«
Die Schwester trat hervor, alle Brüder fielen ihr um den Hals; sie unterhielten sich und sagten: »Hör, Schwester! Hier kannst du nicht leben. Kommt die Stunde, wo wir kämpfen müssen, da schlagen wir auch dich. Doch wenn du neun Jahre hindurch kein Wort sprichst, man mag dich quälen, man mag dich martern, dann wirst du uns erretten - sonst nie!«
Die Stunde brach an; die Brüder fingen an zu kämpfen, sie schlugen aufeinander los mit eisernen Keulen. Die Schwester aber entfloh; und auf der Flucht stürzte sie in eine Grube, die am Wege war. Da fuhr der Königssohn an der Grube vorbei, zwei Kutscher saßen auf dem Bock. »Hier war ein Mädchen, wo ist es geblieben?« Der Königssohn schickte den einen Kutscher, nachzusehen; der schaute und erblickte das Mädchen. So schön, so schön war es, daß er nicht vermochte, sich vom Anblick zu trennen.
Der Königssohn aber wartete und wartete und schickte endlich den zweiten Kutscher. Dem erging es ebenso: auch er vermochte nicht die Augen abzuwenden. Da lief der Königssohn selber hin, um nach zu sehen. Auch ihm gefiel das Mädchen; er zog es aus der Grube, nahm es in seine Kutsche, brachte es nach Hause und machte es zu seiner Frau.
Die Schwester lebte ein Jahr mit ihm und wurde Mutter eines Söhnleins. Doch die Stiefmutter des Königssohnes nahm das Kind, schnitt ihm den Fuß ab, bestrich die Mutter mit dem Blute des Kindes und steckte ihr sogar den Fuß in den Mund. Drauf ging sie zum Königssohne und klagte: »Sieh doch, was deine Frau gemacht hat - ihr eigenes Fleisch und Blut hat sie umgebracht; dafür müßte auch sie umgebracht werden.« Doch der Mann antwortete: »Sie ist eine so gute Frau, wenn sie auch nicht spricht - sie soll noch leben, was sie auch getan haben mag.«
So lebte sie und lebte und wurde wieder Mutter eines Kindes. Die Stiefmutter schnitt dem Kinde eine Hand ab, bestrich mit dem Blute die Lippen der Mutter und steckte ihr sogar die Hand in den Mund. Drauf eilte sie zum Königssohn und klagte: »Komm doch und sieh, was deine gute Frau getan hat, ihr eigenes Fleisch und Blut hat sie umgebracht; die Hand steckt ihr noch im Munde. Laß sie vertilgen von Gottes Erdboden.«
Der Königssohn wollte sie immer noch nicht töten lassen, doch die Stiefmutter drängte ihn, bis sie ihn schließlich soweit hatte. Der Königssohn ließ einen Pfosten einrammen, an diesem sollte seine Frau erhängt werden. Doch während sie zur Hinrichtung hingeführt wurde, waren die neun Jahre gerade um.
Da laufen die Brüder zu ihr, und Engel kommen aus dem Himmel und rufen: »Wie könnt ihr diese fromme Seele quälen und töten?« - »Richtet selber: sie hat ihre Kinder aufgefressen!« Doch die Engel Gottes sagen: »Tragt alle in den Himmel, aber die Stiefmutter stoßt in die Hölle, wo es weder Mond noch Sonne gibt!«
So wurde es auch ausgeführt.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
HANS UND DER TEUFEL ...

Der Teufel trat einst zum klugen Hans und sprach: 'Komm, laß uns unsere Kraft messen! Wer dem anderen so die Hand drücken kann, daß er schreit, der soll gewonnen haben.' 'Wohl', sprach Hans, 'mag's drum sein! Ich möchte aber nicht, daß es bei Tage geschehe; denn wenn ich schrie und es gingen Leute vorbei, so schämte ich mir die Augen aus dem Kopfe.'
So verabredeten sie denn, in der Dämmerung im Walde zusammen zu kommen: weit vom Dorfe, da sollte der Wettkampf stattfinden. Hans aber ließ sich einen Fausthandschuh aus Eisen machen und zog ihn an die rechte Hand, und als die Sonne hinter den Wipfeln des fernen Waldes verschwunden war, ging er beherzt in den dunklen Wald und fand den Teufel beim Kreuzweg auf ihn harrend.
Da stellten sie sich einander gegenüber, Fuß an Fuß und Aug' in Auge; der Teufel streckte seine langfingerige Tatze aus, ergriff Hansens Rechte und drückte - wie der Teufel. Aber der Handschuh war aus schwedischem Eisen geschmiedet, und Hans lachte nur dazu, denn weil es dunkel war, so vermochte der Teufel nicht zu erkennen, daß Hans behandschuht war. 'Teufel', rief er aus, 'wie ist deine Hand so hart.' - 'Das kommt von harter Arbeit!' - 'Und woher ist deine Hand so schwarz?' - 'Das kommt vom Mistfahren!' -
Und als der Teufel müde geworden war, griff Hans zu und quetschte des Teufels Krallen zusammen, daß dieser anfing kläglich zu heulen, gerade wie eine Katze im Schraubstock. 'Au, au, auweh, auweh!' schrie er, dann setzte er sich in einen Graben, biß ins Gras, legte sich kühlende Kräuter auf die gequetschte Hand und nahm sich vor, nie mehr den Kampf mit Hans aufzunehmen.
Der Wald aber, wo solches geschehen, hieß fortan der Druckwald. Die Blümlein, die der Teufel ab biß und sich auf die Pfote legte, heißen noch heutigentags Teufelsabbiß und Katzenpfötchen.
Estland: Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Volksmärchen
DIE FÄRBER DES MONDES ...

Altvater hatte schon die ganze Welt erschaffen, aber noch war sein Werk nicht vollkommen, wie es wohl sein sollte, denn noch mangelte es der Welt an reichlichem Licht. Des Tages wandelte die Sonne ihre Bahn am himmlischen Zelt, aber wenn sie abends unterging, so deckte tiefe Finsternis Himmel und Erde. Alles, was geschah, verbarg die Nacht in ihrem Schoße.
Gar bald ersah der Schöpfer diesen Mangel und gedachte, dem abzuhelfen. So gebot er denn dem Ilmarinen, dafür Sorge zu tragen, daß es fortan auch in den Nächten auf Erden hell sei. Ilmarinen gehorchte dem Befehl, trat hin zu seiner Esse, wo er vor dem schon des Himmels Gewölbe geschmiedet, nahm viel Silber und goß daraus eine gewaltige runde Kugel. Die überzog er mit dickem Golde, setzte ein helles Feuer hinein und hieß sie nun ihren Wandel beginnen am Himmelszelt. Darauf schmiedete er unzählige Sterne, gab ihnen mit leichtem Golde ein Ansehen und stellte jeden an seinen Platz im Himmelsraum.
Da begann neues Leben auf der Erde. Kaum sank die Sonne, da stieg auch schon am Himmelsrande der goldene Mond auf, zog seine blaue Straße und erleuchtete das nächtliche Dunkel nicht anders als die Sonne den Tag. Dazu blinkten neben ihm die unzähligen Sterne und begleiteten ihn wie einen König, bis er endlich am anderen Ende des Himmels anlangte. Dann gingen die Sterne zur Ruhe, der Mond verließ das Himmelsgewölbe, und die Sonne trat an seine Stelle, um dem Weltall Licht zu spenden.
So leuchtete nun Tag und Nacht ein gleichmäßiges Licht hoch von oben auf die Erde nieder. Denn des Mondes Angesicht war ebenso klar und rein wie der Sonne Antlitz, und nur gleicher Wärme ermangelten seine Strahlen. Am Tage brannte aber die Sonne oftmals so heiß, daß niemand eine Arbeit verrichten mochte. Um so lieber schafften sie dann unter dem Schein des nächtlichen Himmelswächters, und alle Menschen waren von Herzen froh über das Geschenk des Mondes.
Den Teufel aber ärgerte der Mond gar sehr, denn in seinem hellen Lichte konnte er nichts Böses mehr verüben. Zog er einmal auf Beute aus, so erkannte man ihn schon von fern und trieb ihn mit Schanden heim. So kam es, daß er sich in dieser Zeit nicht mehr als zwei Seelen erbeutet hatte.
Da saß er nun Tag und Nacht und sann, wie er es wohl angriffe, damit es ihm wieder glückte. Endlich rief er etliche Gesellen herbei, aber die wußten auch keinen Ausweg. So ratschlagten sie denn zu dreien voll Eifer und Sorge, es wollte ihnen aber nichts einfallen. Am siebenten Tage hatten sie keinen Bissen mehr zu essen, saßen seufzend da, drückten den leeren Magen und zerbrachen sich die Köpfe mit Nachdenken. Und sieh, endlich kam dem Bösen selbst ein glücklicher Einfall.
»Wir müssen den Mond wieder fortschaffen, wenn wir uns retten wollen. Gibt es keinen Mond mehr am Himmel, so sind wir wieder Helden, wie zuvor. Beim matten Sternenlicht können wir ja unbesorgt unsere Werke betreiben!« »Sollen wir denn den Mond vom Himmel herunterholen?« fragten ihn die Knechte. »Nein«, sprach der Teufel, »der sitzt zu fest daran, herunter bekommen wir ihn nicht! Wir müssen es besser machen. Und das beste ist, wir nehmen Teer und schmieren ihn damit, bis er schwarz wird. Dann mag er am Himmel weiterlaufen, das wird uns nicht verdrießen.«
Dem Höllenvolke gefiel der Rat des Alten wohl, und alle wollten sich sogleich ans Werk machen. Es war aber zu spät geworden, denn der Mond neigte sich schon zum Niedergang, und die Sonne erhob ihr Angesicht. Den andern Tag aber schafften sie mit Eifer an ihrer Arbeit bis zum späten Abend. Der Böse war ausgezogen und hatte eine Tonne Teer gestohlen, die trug er nun in den Wald zu seinen Knechten. Indes waren diese geschäftig, aus sieben Stücken eine lange Leiter zusammenzubinden, und ein jedes Stück maß sieben Klafter. Darauf schafften sie einen tüchtigen Eimer herbei und banden aus Lindenbast einen Schmierwisch zusammen, den sie an einen langen Stiel steckten.
So erwarteten sie die Nacht. Als nun der Mond aufstieg, warf sich der Böse die Leiter samt der Tonne auf die Schulter und hieß die beiden Knechte mit Eimer und Borstwisch folgen. Als sie angekommen waren, füllten sie den Eimer mit Teer, schütteten auch Asche hinzu und tauchten dann den Borstwisch hinein. Im selben Augenblick lugte auch schon der Mond hinter dem Walde hervor. Hastig richteten sie die Leiter auf, der Alte aber gab dem einen Knechte den Eimer in die Hand und hieß ihn hurtig hinaufsteigen, indes der andere unten die Leiter stützen sollte.
So hielten sie nun unten beide die Leiter, der Alte und sein Knecht. Der Knecht aber vermochte der schweren Last nicht zu widerstehen, also daß die Leiter zu wanken begann. Da glitt auch der Mann, der nach oben gestiegen war, auf einer Sprosse aus und stürzte mit dem Eimer dem Teufel auf den Hals. Der Böse prustete und schüttelte sich wie ein Bär und fing an, schrecklich zu fluchen. Dabei hatte er der Leiter nicht mehr acht und ließ sie fahren, so daß sie mit Donner und Gekrach zu Boden fiel und in tausend Stücke schlug.
Als ihm nun sein Werk so übel geraten und er selbst anstatt des Mondes vom Teer begossen ward, da tobte der Teufel in seinem Zorn und Grimm. Wohl wusch und scheuerte, kratzte und schabte er seinen Leib, aber Teer und Ruß blieben an ihm haften, und ihre schwarze Farbe trägt er noch bis auf den heutigen Tag.
So kläglich schlug dem Teufel sein Versuch fehl, aber er wollte von seinem Vorsatz nicht ablassen. Darum stahl er anderntags wiederum sieben Leiterbäume, band sie gehörig zusammen und schaffte sie an den Waldsaum, wo der Mond am tiefsten steht. Als der Mond am Abend aufstieg, schlug der Böse die Leiter fest in den Grund ein, stützte sie noch mit beiden Händen und schickte den anderen Knecht mit dem Teereimer hinauf zum Mond, gebot ihm aber streng, sich fest an die Sprossen zu hängen und sich vor dem gestrigen Fehltritt zu hüten.
Der Knecht kletterte so schnell wie möglich mit dem Eimer hinauf und gelangte glücklich auf die letzte Sprosse. Eben stieg der Mond in königlicher Pracht hinter dem Wald auf. Da hob der Teufel die ganze Leiter auf und trug sie eilig bis hin an den Mond. Und welch ein Glück! Sie war wirklich gerade so lang, daß sie mit der Spitze an den Mond reichte.
Nun machte sich des Teufels Knecht ohne Säumen ans Werk. Es ist aber nichts Leichtes, oben auf einer solchen Leiter stehen und dem Mond mit einem Teerwisch ins Gesicht fahren wollen. Zudem stand auch der Mond nicht still auf einem Fleck, sondern wandelte ohne Unterlaß seines Weges fürbaß. Darum band sich der Mann da oben mit einem Seil fest an den Mond, und da er also vor dem Fall behütet war, ergriff er den Wisch aus dem Eimer und begann, den Mond zuerst von der hinteren Seite zu schwärzen.
Aber die dicke Goldschicht auf dem reinen Mond wollte keinen Schmutz leiden. Der Knecht strich und schmierte, daß ihm der Schweiß von der Stirne troff, bis es ihm nach vieler Mühe endlich doch gelang, des Mondes Rücken mit Teer zu überziehen. Der Teufel unten schaute offenen Mundes der Arbeit zu, und als er das Werk zur Hälfte vollendet sah, sprang er vor Freude von einem Fuß auf den anderen.
Als er so des Mondes Rücken geschwärzt hatte, schob sich der Knecht mühsam nach vorn, um auch hier den Glanz des Himmelswächters zu vertilgen. Da stand er nun, verschnaufte ein wenig und dachte nach, wie er es anfinge, um mit der anderen Seite leichter fertig zu werden. Es fiel ihm aber nichts Gescheites ein, und er mußte es wie zuvor machen.
Schon wollte er sein Werk wieder beginnen, als gerade Altvater aus kurzem Schlummer erwachte. Verwundert nahm er wahr, daß die Welt um die Hälfte dunkler geworden, obgleich kein Wölkchen am Himmel stand. Wie er aber schärfer nach der Ursache der Finsternis ausschaute, erblickte er den Mann auf dem Mond, der eben seinen Wisch in den Teertopf tauchte, um die erste Hälfte des Mondes der zweiten gleichzumachen.
Unten aber sprang der Teufel vor Freuden wie ein Ziegenbock hin und her. »Solche Streiche macht ihr also hinter meinem Rücken!« rief Altvater zornig aus. »So mögen denn die Übeltäter den verdienten Lohn empfangen! Auf dem Monde bist du und sollst du ewig mit deinem Eimer bleiben, allen zur Warnung, die der Welt das Licht rauben wollen.«
Altvaters Worte gingen in Erfüllung. Noch heute steht der Mann mit dem Teereimer im Monde, der deswegen nicht mehr so hell leuchten will wie sonst. Oft wohl steigt der Mond hinab in den Schoß des Meeres und möchte sich reinbaden von seinen Flecken; aber sie bleiben ewig an ihm haften.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER ASCHEWICHT ...

Es lebte einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Die beiden älteren waren recht klug, nur der jüngste war ein Dümmling. Die älteren Söhne standen beim Vater in hoher Gunst, aus dem jüngsten aber machte er sich nicht viel. Auch die beiden älteren Brüder sahen über den Dümmling hinweg und schimpften ihn stets nur Aschewicht.
Das Leben wurde dem Aschewicht zu Hause von Tag zu Tag unerträglicher, darum dachte er schließlich, fort zu gehen und anderswo sein Glück zu versuchen. So überlegte er hin und her, und es fiel ihm nichts Besseres ein als die Königsstadt. Irgend etwas würde sich dort schon finden, womit er sich ernähren könnte. So brach er auf in die Königsstadt.
Auf dem Wege zur Königsstadt hörte der Aschewicht, daß der König wegen der wilden Tiere in großer Sorge sei. Im Walde des Königs sollen ein riesiger Waldochse und ein furchterregendes Wildschwein hausen. Diese bösen Tiere sollen jeden, der sich in den Wald wagt, anfallen. Der König habe schon etliche mutige Männer ausgeschickt, die den wilden Tieren den Garaus machen sollten, aber keiner von ihnen hatte es bisher vollbracht. Schließlich soll der König versprochen haben, er vermähle mit seiner Tochter denjenigen, der den riesigen Waldochsen und das gewaltige Wildschwein besiegt. Viele tapfere Männer sind daraufhin ausgezogen, um ihr Glück zu versuchen, waren aber froh, wenn sie mit dem Leben davonkamen. Deshalb sei der König so in Sorgen.
Da dachte der Aschewicht bei sich: >Wenn's weiter nichts ist, mit den bösen Tieren will ich schon fertig werden! Laßt uns nur sehen!< Er ging ins Königsschloß und verkündete, daß er dem Waldochsen und dem Wildschwein den Garaus machen werde. Die Diener des Königs lachten ihn aus: »Viele tapfere Männer haben es schon versucht, und doch alles umsonst. Da kommst du, der Dümmling, daher! Dich reißen die Tiere doch gleich in Stücke!« Am liebsten wollten die Diener des Königs den Aschewicht wieder nach Hause schicken, doch das durften sie nicht, denn der König hatte strengstens befohlen, wer das Wagnis wünscht, der soll es tun! Und der Aschewicht wollte es wagen, mit dem Ochsen zu kämpfen.
Der vereinbarte Tag rückte heran. Die ganze Stadt lief zusammen, um den Kampf des Aschewichts mit dem Ochsen zu sehen. Sogar der König war gekommen. Als Kampfplatz wählte der Aschewicht den Kirchhof aus, auf dem mehrere hundert Jahre alte Eichen wuchsen. Der Ochse wurde aus dem Wald gelockt. Sobald er den Aschewicht erblickte, stürmte er wutschnaubend auf ihn zu. Der Junge aber tat so, als würde er den Ochsen gar nicht beachten. Schon war der Ochse vor ihm und wollte ihn mit seinen riesigen Hörnern aufspießen. Flink wie ein Eichhörnchen sprang der Aschewicht beiseite. Mit mächtiger Wucht durchbohrten die Hörner des Waldochsen den Eichenstamm. Der Ochse rüttelte und rüttelte an ihm, es half alles nichts, er war gefangen. Da sprang der Aschewicht schnell herbei und schlug dem Ochsen den Kopf ab. Der Aschewicht hatte gesiegt. Alle Leute und sogar der König applaudierten ihm.
Die Diener des Königs spotteten nun wieder: »Den Ochsen hat der Junge zwar besiegt, aber mit dem Schwein wird er doch nicht fertig werden. Schweine bohren ihre Hauer nicht ins Gehölz!« — »Wir werden ja sehen, was sich tun läßt!« sagte der Aschewicht zu den Zweiflern. Er ging in die Kirche hinein und schloß sorgfältig alle Türen und Fenster. Nur eine Tür ließ er offen. Dann sagte er, man solle das Wildschwein aus dem Wald locken. Er selbst blieb an der Kirchtür stehen, um auf das Schwein zu warten.
Das Wildschwein kam bei der Kirche an und bemerkte den Aschewicht zuerst gar nicht. Es rannte um die Kirche herum, und nun gewahrte es den Gegner. Der Junge aber sprang schnell hinter die Tür, und das Schwein sauste an ihm vorbei, geradewegs in die Kirche hinein. Der Junge schlüpfte flink hervor und warf die Tür mit einem Knall zu. Das Wildschwein war in der Kirche gefangen!
Das Volk stand voller Verwunderung da, der König aber lobte: »Was für ein schlauer Bursche! Hat das Schwein in die Falle gelockt! Nicht schlecht, doch wie willst du das Schwein besiegen?« Der Aschewicht lächelte über die Zweifler. Dann begann er, das Schwein vor der Tür zu reizen. Das Schwein hörte ihn und wurde wütend. Es wollte über den Jungen herfallen, aber die Tür war ja zu. Das Schwein rannte in der Kirche umher, konnte jedoch nicht heraus.
Der Aschewicht hatte mit Absicht die Turmluke aufgelassen. Als das Wildschwein die offene Luke sah, lief es die Treppe hinauf in den Turm und schaute von dort herunter. Wie wunderte sich das Volk, als es das Schwein im Turm erblickte. Unten aber setzte der Junge sein Spiel fort. Da wollte das Schwein von oben auf den Jungen springen, doch jener hüpfte flink beiseite. Das Schwein fiel herunter und mit den Beinen so tief in den Erdboden, daß es sich nicht mehr bewegen konnte. Da ergriff der Aschewicht das Schwert und hieb dem Schwein den Kopf ab. Wieder hatte der Dümmling gesiegt. Das Volk umjubelte ihn, auch der König applaudierte ihm.
Nun fragte der Aschewicht den König: »Gibst du mir jetzt deine Tochter zur Frau?« Der König entgegnete: »Was ich versprochen hab', will ich auch halten.« Und so heiratete der Aschewicht die Königstochter. Alle tanzten, daß die Wände wackelten. Hundert Ochsen und tausend Schweine wurden zum Fest geschlachtet. Den Hochzeitstisch deckte man auf dem Hof des Königs, und essen durfte daran, wen es gelüstete. Erst als es zum zweiten Mal Vollmond wurde, machten sich die Gäste auf den Heimweg. Nun hatte es der Aschewicht gut! Er war der Schwiegersohn des Königs, und seine Frau, die Prinzessin, war lieb und schön, so daß er sich keine bessere hätte wünschen können. So lebte er glücklich und zufrieden in den Tag hinein.
Doch der König mochte es nicht, daß seine Schwiegersöhne faulenzten. Eines Tages sagte er zum Aschewicht: »Weißt du, in meinem Walde lebt ein sonderbarer weißer Vogel. Ich möchte ihn gern haben. Wer mir diesen Vogel fängt, bekommt einen reichlichen Lohn. Geh mit den anderen Schwiegersöhnen, und fangt mir den Vogel!« Gähnend erwiderte der Aschewicht: »Gut, ich werde schon gehen!« Den gleichen Wunsch teilte der König auch seinen anderen Schwiegersöhnen mit.
Am nächsten Morgen machten sich die anderen Schwiegersöhne in aller Frühe auf den Weg, um den weißen Vogel zu fangen. Der Aschewicht aber schlief noch fest, ein Bein übers andere geschlagen. Am Vormittag weckte ihn seine Gemahlin: »Steh doch endlich auf! Die anderen sind schon längst im Wald! Vielleicht haben sie den Vogel schon gefangen, und du schläfst immer noch!« Der Aschewicht erwiderte gähnend: »Ein jeder bekommt, was für ihn vorgesehen!«
Endlich stand er auf, frühstückte, nahm ein Stück Brot mit und schlenderte in den Wald, den Vogel zu suchen. Er ging im Walde hin und her, aber keine Spur von dem weißen Vogel. Plötzlich kam dem Aschewicht ein kleines, graues Männchen entgegen. Das graue Männchen sagte: »Sei ein guter Mann, und gib mir etwas zu essen! Ich habe schon den dritten Tag kein Krümelchen in den Mund bekommen!«
Dem Aschewicht war es recht. Er gab seinen Brotsack dem Männchen und meinte: »Da, Väterchen, iß, bis du satt bist! Begnüge dich damit, was ich dir bieten kann!« Das graue Männchen aß mit großem Appetit. Während es aß, fragte es den Aschewicht: »Sag mal, wohin gehst du mit so einem großen Brotbeutel?« Der Aschewicht erwiderte: »Ich soll ebenfalls den weißen Vogel fangen den der König haben will. Die anderen Schwiegersohne des Königs haben sich schon früh morgens aufgemacht, sie werden den Vogel wohl längst gefangen haben. Ich werde mich nur noch ein wenig im Walde umschauen!«
Doch das Männchen tröstete ihn: »Es ist halb so schlimm! Ohne mich werden sie den Vogel nicht fangen. Sammle die herunter gefallenen Brotkrümel auf und streue sie auf die kleine Lichtung hier in der Nähe. Dort werden sich viele Vögel einfinden, um sie aufzupicken, darunter auch der weiße Vogel, nach dem sich der König so sehnt. Du brauchst ihn nur zu fangen. Und hab keine Angst, es wird ein leichtes sein, ihn zu fangen. Wenn du ein andermal meine Hilfe brauchst, komm nur hierher und rufe dreimal: »He, altes Männchen!« Ich werd's schon hören und kommen.«
Der Junge dankte dem Männchen für den guten Rat und tat, wie befohlen. Alsbald kamen viele Vögel herbei geflogen. Der Aschewicht fing den weißen Vogel und lief bis zu dem Weg, den entlang die anderen kommen mußten. Er setzte sich nieder, öffnete seinen Brotbeutel und aß. Dann wartete er und wartete, doch niemand kam vorüber.
Erst am Abend erschienen die anderen Schwiegersöhne und sahen sehr traurig aus. Als sie den Aschewicht erblickten, sagten sie: »Sieh dir den Faulpelz an! Da schläft er, wir aber suchen den Vogel und fallen bald um vor Müdigkeit.« Der Aschewicht entgegnete: »Habt ihr den Vogel nicht gefangen? Sollte ich denn auch so mir nichts, dir nichts im Walde herumbummeln? Ich esse und schlafe, den Vogel aber habe ich längst schon gefangen!« —
»Red keinen Unsinn!« — »Wenn ihr es nicht glauben wollt, schaut her!« sagte der Junge, zog den weißen Vogel aus dem Sack und zeigte ihn den anderen. »Wer hätte es geglaubt, daß ausgerechnet der Dümmling den Vogel fängt!« riefen die anderen voller Verwunderung. Der ältere Schwiegersohn sagte: »Was fängst du mit dem Vogel schon an? Verkaufe ihn lieber uns, wir wollen gut bezahlen!«
Der Aschewicht entgegnete: »Warum nicht, wenn wir uns einig werden?« — »Was verlangst du für den Vogel?« — »Nicht mehr, als ein körnchengroßes Stück vom kleinen Finger.« — Der ältere Schwiegersohn überlegte, es wird wohl weh tun, ein Stückchen vom Finger abzuschneiden, aber ich werde es aushalten, und dann gehört mir der weiße Vogel und die große Belohnung des Königs. So schnitt er sich ein Stück vom Finger ab, der Aschewicht steckte es in die Hosentasche und gab ihm den weißen Vogel dafür. Dieser brachte den Vogel dem König und wurde reichlich belohnt.
Am nächsten Tag sagte der König zu seinen Schwiegersöhnen: »Ihr seid tapfere Männer, denn ihr habt den Vogel gefangen. Aber wirklich tapfere Männer seid ihr erst dann, wenn ihr mir aus dem Wald den wundersamen Hengst bringt. Hunderte vor euch haben ihn schon gejagt, aber keiner konnte ihn bisher fangen. Sollte es euch gelingen, will ich euch reichlich belohnen. Macht euch also auf den Weg!«
Am nächsten Morgen waren die Schwiegersöhne des Königs schon in aller Frühe im Wald, nur der Aschewicht schlief, als hätte er mit all dem gar nichts zu tun. Schließlich weckte ihn seine Gemahlin und sagte: »Steh auf und geh auch in den Wald! Die anderen haben gestern den Vogel gefangen, du aber gar nichts. Versuche es heute mit dem Hengst!«
Der Aschewicht ließ sich Zeit. Schließlich machte er sich auf, und nahm sich einen dick gefüllten Brotbeutel mit. Im Walde ging er zur selben Stelle, wo er das kleine, graue Männchen getroffen hatte. Dort rief er: »He, altes Männchen!« Alsbald erschien das graue Männchen und fragte: »Na, mußt du heute wieder etwas suchen?« Der Aschewicht erwiderte: »Ja, der König möchte den wundersamen Hengst dieses Waldes haben. Hilf mir bitte, den Hengst zu fangen!« —
»Das ist eine Kleinigkeit. Da, nimm das Zaumzeug! Geh ein Stückchen weiter, bis zum Waldesrand. Dort werden Pferde grasen. Wirf dem ersten das Zaumzeug über, und du wirst den gewünschten Hengst haben.« Der Aschewicht tat, wie ihm das Männchen geheißen. Er warf dem ersten Pferd das Zaumzeug über. Und welch Wunder, vor ihm stand ein wunderschöner Hengst mit goldenem Sattel. Der Aschewicht brauchte sich nur in den Sattel zu schwingen und zu der Stelle zu reiten, wo er am anderen Tag die anderen Schwiegersöhne getroffen hatte. Dort machte er halt, band das Pferd an einen Baum und begann zu essen. So aß er, bis die anderen aus dem Walde kamen.
Wie begannen die anderen da zu schimpfen: »Sieh dir den Vielfraß an! Da haut er sich den Bauch voll und denkt gar nicht ans Suchen. Ihm ist es einerlei, daß wir uns die Hacken abrennen. Es ist Zeit, daß wir uns auf den Heimweg machen!« Der Aschewicht erwiderte nur: »Ich werde schon kommen. Ich muß nur noch einmal in den Wald, da muß ich noch etwas erledigen.«
Der Junge nahm seinen Brotbeutel, schritt in den Wald, schwang sich in den Sattel des wundersamen Hengstes und ritt nun zu den anderen. Voller Verwunderung fragten sie ihn: »Wo hast du denn dieses schöne Pferd her?« Der Aschewicht erwiderte: »Wer sucht, der findet!« Die anderen sagten wiederum: »Wir haben doch auch gesucht, haben aber nichts gefunden.« Da meinte der Junge: »Ihr werdet wohl nicht gut genug gesucht haben, wenn ihr nichts gefunden habt.«
Da legten sich die anderen aufs Bitten: »Verkauf uns den Hengst!« »Warum nicht, wenn wir uns einig werden?« — »Was verlangst du?« — »Nichts weiter, als daß der Käufer mir seinen Siegelring gibt.« Der mittlere Schwiegersohn bot ihm viel Geld an, aber der Aschewicht ließ sich nicht erweichen, er wollte nur den Siegelring. Was blieb dem Käufer anderes übrig, als ihm den Ring zu geben. Nun gehörte der schöne Hengst dem mittleren Schwiegersohn, und er brachte ihn dem König. Der König lobte ihn und zahlte ihm eine reichliche Belohnung.
Am nächsten Tag sagte der König wieder zu den Schwiegersöhnen: »Im Wald treibt sich ein ungeheuer großer Bär herum, der viel Schaden anrichtet. Wer den Bär fängt und ihn mir als Beute bringt, bekommt einen Sack voll Gold. Schwiegersöhne, zeigt, daß ihr tapfere Männer seid. Geht und fangt ihn mir!«
Am nächsten Morgen waren die Schwiegersöhne schon in aller Frühe im Wald. Der Aschewicht aber ließ sich Zeit. Er schlief bis in den späten Vormittag. Die Gemahlin aber ließ ihm keine Ruhe, und so machte er sich schließlich auf in den Wald, um den Bären zu fangen. Sobald er im Wald war, rief er wieder: »He, altes Männchen!« Im Handumdrehen war das graue Männchen zur Stelle. »Du willst heute also den Bären fangen?« fragte er den Aschewicht. Der Junge erwiderte: »Das will ich, wenn ich nur wüßte, wo ich ihn finde.« Da sagte das alte, graue Männchen: »Ich werde dir den Weg weisen.
Es ist noch zu früh, du mußt ein wenig warten. Der Bär streicht im Wald umher, es ist schwer, ihn zu fangen. Um Mittag legt sich der Bär ins dichte Gebüsch zur Ruhe, das ist die beste Zeit, um ihn zu töten. Schleiche dich leise zum Gebüsch, schlag dem Bär mit einem Knüppel eins auf die Nase und spring selbst flink beiseite. Der Bär wird aus dem Gebüsch hervorspringen, du aber spring hinein! Ein zweites Mal brauchst du nicht zuzuschlagen, denn der Bär wird beim Gebüsch alle viere von sich strecken. Komm erst dann aus dem Gebüsch hervor, wenn der Bär tot daliegt. Zieh dem Bär das Fell ab und bring es dem König!«
Der Aschewicht tat, wie ihm das Männchen geheißen. Er machte den Bär ausfindig, tötete ihn und zog ihm das Fell ab. Dann warf er sich das Fell über die Schulter und ging zu dem Weg, wo er die anderen auch an den vorigen Tagen erwartet hatte, und begann zu essen. Er mußte lange warten. Schließlich kamen auch die anderen. Spottend fragten sie den Aschewicht: »Na, Dümmling, hast den Bären wohl schon erlegt, daß du Mahlzeit hältst?« Der Aschewicht erwiderte: »Freilich hab ich ihn erlegt.« Die anderen wollten ihm keinen Glauben schenken, als sie aber das Bärenfell sahen, mußten sie es glauben. Wieder begannen sie zu verhandeln: »Verkauf uns das Fell!« — Aber gern.« — »Was verlangst du dafür?« — »Nichts weiter, als daß der Käufer sich ein Loch ins Ohrläppchen machen läßt.«
Ärgerlich sprach der jüngere Schwiegersohn: »Laß doch endlich deine Dummheiten! Was hast du davon, wenn man mir ein Loch ins Ohrläppchen bohrt? Nimm lieber Geld, dann hast du was davon!« Der Aschewicht entgegnete: »Eure Ohren, mein Fell. Macht, was ihr wollt!« Der jüngere Schwiegersohn wollte das Fell aber unbedingt haben. Da half nichts anderes, als daß er sich ein Loch ins Ohr bohren ließ. Dann ging er mit dem Fell zum König und erhielt die versprochene Belohnung.
Bald danach veranstaltete der König ein großes Fest. Geladen waren alle Könige der nächsten Umgebung, geladen waren auch seine Schwiegersöhne, nur der Aschewicht nicht. Der König meinte: »Warum sollte ich ihn zum Fest laden? Was hat er schon Gutes getan? Die anderen haben mir die Tiere gefangen, er hat gar nichts gebracht.«
Traurig ging der Aschewicht am Festtagsmorgen in den Wald. Dort traf er das graue, alte Männchen wieder. Das Männchen fragte ihn: »Was fehlt dir, Söhnchen? Warum bist du so betrübt?« Der Junge entgegnete: »Ich bin traurig, daß ich so dumm gehandelt habe. Ich habe die Tiere zwar gefangen, habe sie aber den anderen Schwiegersöhnen verkauft. Der König meint nun, sie seien die Helden, ich wäre aber ein Nichtsnutz. Er hat mich nicht einmal zum Fest eingeladen. Hab ich nicht Grund genug, traurig zu sein? «
Das Männchen tröstete ihn: »Das macht nichts! Du wirst schon am Fest teilnehmen! Da, nimm diese Erbse! Iß sie auf, und du kannst dich in jedes Tier verwandeln und hin gehen, wohin du willst!« Der Aschewicht bedankte sich beim Männchen für den guten Rat, nahm die Erbse und ging zurück ins Schloß.
Zu Hause angelangt, aß er die Erbse auf und verwandelte sich in einen Floh. Nun konnte er unbemerkt in den Saal gelangen, in dem die Gäste sich versammelt hatten. Da hörte er, wie die anderen Schwiegersöhne sich vor den Gästen brüsteten. Er hörte, wie der eine den Bär erlegt hätte und der andere den Hengst gefangen habe, der dritte aber den Vogel gefunden hätte. Darauf ging der Aschewicht in sein Zimmer, zog sich prächtige Kleider an und begab sich zurück zu den Gästen.
Wie erschraken da die Lügner, als sie den ungebetenen Gast erblickten. Der Aschewicht aber sagte vor allen Gästen zu den anderen Schwiegersöhnen: »Ich habe die Tiere zwar euch gegeben, da ihr damit aber falsche Ehre ernten wollt, muß ich jetzt die Wahrheit sagen. Ich war es, der die Tiere gefangen hat!« Die Schwiegersöhne des Königs wurden böse und riefen: »Er lügt, er lügt!« Dann riefen sie die Wächter, damit sie den Lügner festnehmen sollten.
Der Aschewicht aber nahm aus der Tasche das Stückchen Finger und den Siegelring und sagte: »Seht hier, was man mir für die Tiere gegeben hat. Das Stückchen Finger habe ich für den Vogel und diesen Siegelring habe ich für den Hengst bekommen. Der dritte Schwiegersohn aber ließ sich für das Bärenfell ein Loch ins Ohrläppchen machen!«
Nun traute sich keiner der Schwiegersöhne mehr zu widersprechen. Voller Scham verließen sie das Fest des Königs. Der Aschewicht aber wurde nun in allen Ehren gefeiert. Von diesem Tag an erkannte auch der König den Aschewicht an, und er ernannte ihn zu seinem Nachfolger. Und wenn der Aschewicht nicht gestorben ist, so regiert er noch heute das Königreich.
Quelle: Estland
ZWEI LEICHEN UND EIN SCHWANZLOSES PFERD ...

Es waren einmal zwei Bauernwirte: der eine war reich, der andere war arm. Der Arme ging zum Reichen und bat ihn um ein Pferd, damit er Holz führen könne; er bekam das Pferd auch, aber ohne den Schlitten.
Der Arme nahm es nun, ging in den Wald und band das Holzfuder mit einem Strick an den Schwanz des Pferdes; aber auf der Heimfahrt riß der Pferdeschwanz ab. Der Arme brachte das Pferd wieder zum Reichen zurück und bedankte sich aufs schönste, aber das Pferd hatte keinen Schwanz mehr. - Der Reiche verklagte den Armen vor dem Gericht.
Zum Gericht ging der Reiche mit seiner Frau und seinem Sohn, der Arme wanderte allein hinter ihm drein. Wegen der Kälte betraten sie alle eine Schenke. Der Reiche bestellte sich Bier und Schnaps, um warm zu werden, die Frau mit dem Sohn machte es sich am Ofen bequem, um sich ebenfalls zu wärmen, und der Arme kletterte auf den Ofen.
Der Arme schloß die Augen, um nicht zu sehen, wie der Reiche trank; er schlummerte aber ein, stürzte vom Ofen genau auf den Sohn des Reichen herab und schlug ihn zu Tode. Auf diese Weise war er schon doppelt schuldig. Auf dem Wege zum Gericht mußten sie noch über einen Fluß gehen. Der Arme ging über die Brücke, gerade als ein alter Mann unten auf dem Eise durchfuhr. Der Arme tat einen Fehltritt, stürzte von der Brücke gerade dem alten Mann auf den Kopf und schlug ihn ebenfalls zu Tode. Auf diese Art war er schon dreifach schuldig und dachte, daß man ihn jetzt natürlich hängen werde.
Da fand er am Wege einen Stein, ungefähr ebenso groß wie ein Haufen von dreihundert Talern. Der Arme band den Stein in sein Tuch und sprach zu sich selbst: »Wenn ich einmal zum Tode verurteilt bin, so mag auch mein Richter krepieren: ich werfe ihm mit dem Steine den Schädel ein.«
So kamen sie nun alle zum Galgen ins Gericht. Der arme Mann wartete auf das Urteil und hob seine Hand mit dem Stein in die Höhe, um ihn, wenn er zum Tode verurteilt würde, augenblicklich dem Richter an den Kopf zu werfen. Der Richter aber dachte, daß der Mann ihm dreihundert Taler zeige, und fällte das Urteil folgendermaßen: der Reiche solle sein Pferd dem Armen überlassen, bis dem Pferde wieder ein Schwanz gewachsen sei; auch seine Frau solle er dem Armen geben, bis sie von diesem ein neues Kind geboren habe - dann solle er Pferd, Frau und Kind zurückerhalten; was drittens den alten Mann anlange, so wäre der sowieso bald von selbst gestorben, deshalb könne der Richter darüber kein Urteil fällen.
Damit war das Gericht zu Ende, und alle gingen nach Hause. Am nächsten Morgen eilte der Arme sofort zu dem Reichen und verlangte das Pferd und die Frau, um sich unverzüglich an die vorgeschriebene Arbeit machen zu können. Doch der Reiche bat ihn, sich nicht zu bemühen - er selber wolle schon die Sache mit der Frau in Ordnung bringen und dem Pferde einen Schwanz wachsen lassen. Der Arme war damit nicht einverstanden. Nun, da gab ihm der Reiche dreihundert Taler Abschlagsgeld, und der Arme ging fröhlich nach Hause.
Hinterdrein schickte der Richter seinen Diener nach den dreihundert Talern, der Arme aber klagte, woher er dreihundert Taler nehmen solle. Der Diener erinnerte ihn daran, daß er sie ja im Gericht gezeigt habe. Nun erklärte der Arme: »Ich habe nur einen Stein gezeigt: wenn der Richter nicht zu meinen Gunsten entschieden hätte, so hätte ich ihm mit dem Stein den Schädel eingeworfen. Diesen Stein kann ich ihm freilich mit Vergnügen abtreten.«
Als der Richter das hörte, da war er selber noch froh darüber, daß er es unbewußt verstanden hatte, so zu urteilen, daß er keinen Stein an den Kopf bekommen hatte, und sprach: »Gott sei Dank, daß die Sache noch so abgelaufen ist!«
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen - Livische Märchen
WIE EIN BAUER AUF SEINEN TOD WARTETE ...
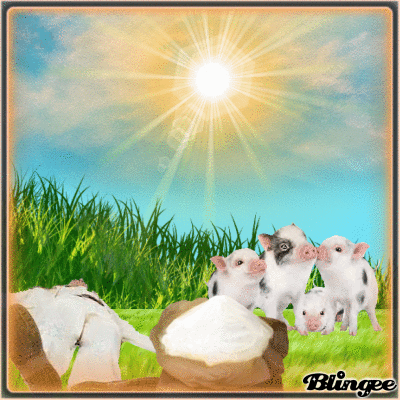
Es lebte einst ein Bauer, dessen Kinder waren längst schon erwachsen und sogar verheiratet. Der älteste Sohn und die Schwiegertochter hatten schon eine Zeit lang darauf gewartet, daß der Vater ihnen das Gehöft abtrete. Doch der Vater war gesund und munter und dachte nicht einmal daran. Im stillen überlegte der Vater jedoch, daß sein letztes Stündchen nicht weit sein konnte und daß der Sohn dann Bauer wurde.
Eines Tages ging er nun zu einem Weisen, um zu fragen, wie lange er noch leben würde. Der Weise schaute ihn aufmerksam an und sagte: »Dreimal wirst du noch niesen, dann kommt der Tod!« Traurigen Sinnes begab sich der Alte auf den Heimweg. Zugleich aber nahm er sich fest vor, sich vorm Niesen zu hüten. Doch schon als er durchs Hoftor trat, spürte er, daß er niesen mußte. Und so nieste er denn auch. »O weh! Zweimal darf ich noch niesen!« seufzte der Alte.
Am nächsten Tag ging der Alte zur Mühle. In der Mühle aber geriet ihm Staub in die Nase, und wieder mußte er niesen. »Was du nicht sagst! Nun darf ich nur noch einmal niesen!« seufzte der Alte. Er eilte schnell aus der Mühle, damit ihm das Unglück nicht noch einmal passiert. Als sein Korn gemahlen war, wurde er herein gerufen, damit er sein Mehl fort schaffe.
Der Alte ging hinein, hob den Mehlsack auf den Buckel und wollte wieder hinaus treten. Da geriet ihm jedoch wieder Mehlstaub in die Nase, und als er zur Tür hinaus war, mußte er niesen. Nun schon zum dritten Mal. »Du liebe Zeit! Nun bin ich tot!« seufzte der Alte, ließ den Mehlsack fallen und sank selbst daneben nieder.
Die Schweine des Müllers sahen nun den Mehlsack an der Erde liegen und ließen es sich schmecken. Der Alte schaute ihnen liegend zu und seufzte: »Ach ihr Übeltäter! Wäre ich am Leben, ich würde es euch schon zeigen! Aber nun bin ich tot und kann euch gar nichts mehr tun!«
Da trat der Müller vor die Tür, sah, daß der Mann lang lag und die Schweine im Mehl wühlten. Erstaunt fragte der Müller: »Was machst du da, Alter?« Der Alte entgegnete: »Was ich da mache? Ich bin tot und kann gar nichts machen. Wäre ich lebendig, würde ich die Schweine weg jagen, aber ein Toter jagt niemanden mehr. Ich bitte dich, jag die Schweine fort!«
Der Müller hörte ihm zu und staunte: »Ach so, du bist also tot! Schade, schade!« Dann nahm der Müller die Peitsche und fuhr damit zwischen die Schweine, vergaß dabei aber auch den Alten nicht. Wie da der alte Bauer aufsprang! Zum Müller sagte er noch: »Hab tausend Dank, daß du mich zum Leben erweckt hast, sonst wäre ich wohl für immer tot gewesen!«
Dann hob er seinen Mehlsack auf den Wagen und fuhr heim. Vom Tod hatte er von nun an nichts mehr hören wollen.
Quelle: Estland
WIE EIN MANN HAUSFRAU WAR ...
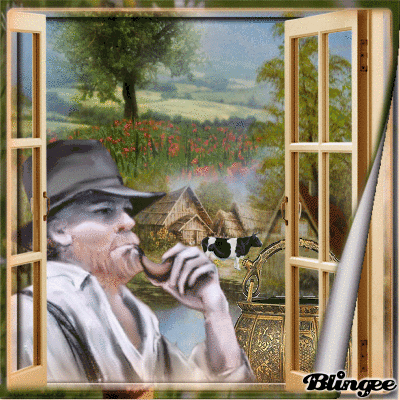
Es lebte einmal ein Mann, der mit seinem Weib ständig unzufrieden war, weil er glaubte, sie hätte es leichter als er. So sagte er: »Ich muß draußen schwer arbeiten, der weilen du daheim hin und her spazierst und nur Zeit vergeudest. Ein wahrlich goldenes Leben!« Das Weib erwiderte: »Wenn du glaubst, ich führte ein goldenes Leben, so könnten wir doch einmal tauschen. Ich werde draußen deine Tagesarbeit verrichten, und du bist statt meiner Hausfrau! Wir werden ja sehen, wer es besser hat!« Dem Mann war es recht. Er sagte: »Ich werde morgen Hausfrau sein, du aber gehst in den Wald mähen!«
Es war gerade ein Sonnabend. Das Weib ging auf die Wiese, der Mann blieb zu Hause. Bevor das Weib sich auf den Weg machte, lehrte es den Mann noch: »Ist der Schatten zwei Schritte lang, komme ich zur Mahlzeit nach Hause. Heute ist Sonnabend, koche uns zu Mittag einen Brei und mache frische Butter dazu. Und vergiß die Kuh nicht! Die Kuh muß auf die Weide!« Der Mann erwiderte lachend: »Weiß schon Bescheid! Werde alles tun, was notwendig, mach dir meinetwegen keine Sorgen!«
Das Weib ging mähen, der Mann aber zündete sich die Pfeife an und dachte: >Ich werde zeitig den Brei aufsetzen.< Er ging, wusch den Kessel aus und kippte Wasser hinein. Die Pfeife jedoch wollte nicht brennen und störte den Mann bei seiner Arbeit. Er zündete sie wieder an und wollte seine Arbeit fortsetzen. Unter dem Kessel entfachte er ein recht großes Feuer, damit der Brei schneller gar wurde. Dann rührte er eifrig um, damit der Brei nicht anbrannte.
Die Kuh hatte der Mann ganz und gar vergessen. Auf einmal begann sie zu muhen. Jetzt fiel dem Mann ein, daß sie noch gar nichts zu fressen bekommen hatte. Der Mann dachte nun, bringe ich die Kuh auf die Weide, brennt der Brei an. Ich müßte erst noch Wasser hinzu schütten, damit er nicht so heftig kocht. Der Mann ging zum Brunnen, holte Wasser und schüttete es in den Kessel. Es war jedoch zuviel Wasser, es floß über den Rand des Kessels und löschte das Feuer. So zündete der Mann das Feuer noch einmal an, doch die nassen Scheite wollten nicht brennen. Und da muhte auch die Kuh schon wieder. Er dachte im stillen, warte, warte schon, ich komme gleich und bringe dich auf die Weide. Aber erst muß ich das Feuer an machen.
Es ging nicht anders, als daß der Mann trockene Scheite holen mußte, bis schließlich unter dem Kessel wieder ein lustiges Feuerchen brannte. Doch da muhte die Kuh schon wieder. Nichts weiter, als schnell zur Kuh. Bei sich dachte der Mann, führe ich die Kuh zur Weide, könnte etwas mit dem Feuer oder dem Brei schiefgehen. Ich werde die Kuh lieber näher am Hause lassen. In der Nähe wächst schönes, saftiges Gras, das kann sie ruhig fressen. Man kann aber der Kuh nicht glauben, denn solange ich hier den Brei koche, kann sie ins Korn laufen. Ich werde die Kuh festbinden müssen.
Der Mann ging und band der Kuh einen Strick um den Hals, um sie dann in der Nähe des Hauses fressen zu lassen. Selbst kehrte er zurück ins Haus, um den Brei weiter zu kochen. Plötzlich fiel ihm ein, daß die Butter noch nicht fertig war. Schnell holte er aus dem Speicher Rahm und Butterfaß und machte sich ans Buttern. Beim Buttern verspürte er auf einmal starken Durst. Der Mann warf den Butterlöffel bei Seite, richtete sich auf und ging aus dem Haus vor den Speicher zum Bierfaß, um sich einen den Durst löschenden Schluck Bier zu gönnen.
Als er aus dem Haus ging, vergaß er jedoch, die Tür zu schließen. Vor dem Haus trollte sich gerade die alte Sau mit ihren sieben Ferkeln. Als sie die Haustür offen stehen sah, marschierte sie zur offenen Tür hinein, die Ferkel hinterdrein. Der Mann machte sich eben am Bierfaß zu schaffen, da sah er, wie die Sau mit den Ferkeln ins Haus spazierte. Sogleich fiel dem Mann ein, daß er die Rahmschüssel auf dem Fußboden hatte stehen lassen, Sau und Ferkel konnten sich daran genug tun. Der Mann sprang auf und lief ins Haus, um die Sau heraus zu treiben. Dabei vergaß er ganz und gar das Bierfaß.
Als der Mann ins Haus gelangte, war die Sau schon am umgekippten Butterfaß und ließ sich den Rahm schmecken. Sofort ergriff der Mann den Besenstiel und setzte der Sau damit eins über. Die Sau fiel daraufhin um, strampelte noch ein wenig mit den Beinen und war tot! Verärgert trieb der Mann die Ferkel aus dem Haus und schaffte auch die tote Sau hinaus. Jetzt erst fiel dem Mann das Bierfaß ein, das er nicht zugedreht hatte. Er lief zum Speicher, um nachzusehen. Das Bierfaß war leer, das Bier floß auf dem Fußboden als Bächlein.
Der Mann schaute sich um, woher er neuen Rahm bekäme, um noch einmal zu buttern. Er fand auch wirklich welchen, und nun begann er von neuem zu buttern. Dann aber dachte er, daß ins Bierfaß neues Wasser hinein muß. Aber was dann, wenn wieder etwas mit dem Butterfaß passiert? Der Mann nahm das Butterfaß mit und stellte es auf den Brunnenrand. Beim Wasserschöpfen stieß er mit dem Eimer dagegen, und das Butterfaß sauste — schwupp! — in den Brunnen. Du liebe Zeit! Nun war der letzte Rahm im Brunnen, woraus sollte er nun Butter machen?
Da fiel ihm zum Glück der Breikessel ein. Er kippte das Wasser ins Bierfaß und ging, nach dem Brei zu sehen. Da quoll aus dem Haus schon dicker, schwarzer Qualm, der Brei war völlig angebrannt. Doch der Mann tröstete sich: »Was macht mir schon der Gestank, Hauptsache, es schmeckt!« So kostete er den Brei und fand, man konnte ihn noch essen. Woher aber Butter nehmen? Vielleicht hatte das Weib welche im Speicher zurückgelegt? Die könnte man an Stelle der frischen Butter nehmen. Man mußte also suchen.
Und der Mann ging in den Speicher. Hier suchte er und suchte, konnte aber nichts finden. Schließlich dachte er, vielleicht hat sie das Buttergefäß in irgendein tiefes Faß gesteckt. Da stand ein hohes und enges Faß, und auf dessen Grund war etwas Mehl. Der Mann langte hinein, um darin das Buttergefäß zu suchen. Zum Unglück aber fiel er Hals über Kopf hinein ins Mehl. Nun konnte er nicht mehr heraus. Da nieste er und nieste, die Nasenlöcher waren voller Mehl, aber an ein Herauskommen war nun einmal nicht mehr zu denken.
Zur Mittagszeit kam die Hausfrau nach Hause. Sie begann, den Mann zu suchen, konnte ihn aber nicht finden. An Stelle seiner sah sie auf dem Hof die tote Sau, der ganze Fußboden des Hauses aber war voller Rahm. Dann erblickte sie in Hofnähe die Kuh, die sich das Bein gebrochen hatte. Die Kuh hatte sich im Strick verfangen und konnte sich nicht mehr bewegen. Der Brei im Kessel war ganz und gar angebrannt. Allein den Mann konnte die Frau nirgends sehen. Schließlich ging sie, um ihn im Speicher zu suchen. Da fand sie ihn, wie er mit dem Kopf im Faß steckte. Das Weib half dem Mann aus dem Faß und säuberte seinen Kopf von der dicken Mehlschicht.
Die gute Frau hat mit ihrem Mann überhaupt nicht geschimpft, obwohl ihm alles so schief geraten war. Sie machten das Haus zusammen sauber, kochten einen neuen Brei und ließen ihn sich schmecken. Und dann war der Tag auch zu Ende. Seitdem war der Mann nie wieder mit seinem Weib unzufrieden, denn er kannte nun selbst die Mühen der Hausarbeit.
Quelle: Estland
DAS GUTSPFERD UND DAS BAUERNPFERD ...

Das Gutspferd und das Bauernpferd waren gute Freunde. Wann immer sie sich trafen, grüßten sie einander höflich. Hatten sie aber ein Weilchen frei, setzten sie sich nieder und plauderten gemeinsam.
Eines Tages aber konnte das Gutspferd seine Eitelkeit nicht bremsen, und es sagte zum Bauernpferd: »Was bist du, Brüderchen, doch von niederer Herkunft. Bald ziehst du den Wagen, bald die Egge, bald den Pflug! Du stinkst ja entsetzlich nach Schweiß! Schau her, wie ich es mache, und nimm dir ein Beispiel an mir. Ich fresse reinen Hafer und fahre nur stolze Herrschaften aus. Sieh, was für schlanke und schöne Beine ich hab! Sieh, wie nett und sauber meine Hufe sind! Sieh, wie mein Fell glänzt, wie mein Nacken sich wölbt und wie die weiße Blesse an meiner Stirn strahlt und leuchtet! Wie fein bin ich doch neben dir, Brüderchen, oder nicht?« —
»Ja, ja, du bist wirklich fein«, nickte das Bauernpferd. »Ich weiß es. Du brauchst es mir nicht erst zu sagen!« rief das Gutspferd, und seine Eitelkeit kannte keine Grenzen. »Und würdest du erst sehen, wie bezaubernd ich im Trab laufe! Und wie flink ich bin! Die Erde schwindet unter meinen edlen Hufen, wenn ich vor dem leichten Federwagen im Galopp davonsause. Du, Brüderchen, wirst wohl nicht sehr flink laufen können?« —
»Nein, nein, das kann ich nicht.« “ — »Ich weiß es. Du brauchst es mir gar nicht erst zu sagen. Du wirst wohl kaum ein Schaf besiegen, würdest du mit ihm um die Wette laufen.« — »Ein Schaf wohl kaum, aber dich ganz bestimmt.« Eine so freche Antwort ärgerte das Gutspferd sehr. Es prustete voll Verachtung, stampfte mit den Hufen und schlug vor: »Wir wollen es probieren.« — »Gut, wollen wir«, sprach das Bauernpferd und war einverstanden.
Sie liefen in die Koppel und vereinbarten, so lange im Kreis zu laufen, bis sie müde wurden. Wer nicht mehr laufen konnte, hatte verloren, wer es länger schaffte, war der Sieger. Das Gutspferd warf den Kopf in den Nacken und sauste davon. Bald hatte es die erste Runde hinter sich, holte das Bauernpferd ein und setzte an ihm vorbei. Dabei wieherte es laut und spottete: »O welch Wunder! Du läufst ja immer noch und willst dich gar nicht ausruhen!« — »Nein, nein, noch nicht!« antwortete das Bauernpferd.
Bald hatte das Gutspferd auch die zweite Runde hinter sich; es holte das Bauernpferd ein und setzte an ihm vorbei. Wieder wieherte es laut und spottete: »Oho, welch Wunder! Du läufst ja immer noch und willst dich gar nicht ausruhen!« — »Nein, nein, noch nicht!« antwortete das Bauernpferd.
Als das Gutspferd das Bauernpferd nach der dritten Runde einholte, wieherte es schon viel leiser, spottete über den Freund aber wie vorher: »Oho-och! Welch... Wunder! Du läufst... ja immer noch... und willst dich... gar nicht... ausruhen.« — »Nein, nein, noch nicht«, antwortete das Bauernpferd und fragte: »Woher aber kommt es, Freund, daß du so keuchst?« — »Bin gerade über einen Grashügel gestolpert«, sagte das Gutspferd.
Bei der vierten Runde sagte das Gutspferd nichts, sondern lief stillschweigend am Bauernpferd vorbei. Das Bauernpferd fragte: »Woher kommt es, Freund, daß du so pustest?« — »Bin eben über einen Baumstumpf gestolpert«, sagte das Gutspferd.
Bei der fünften und sechsten Runde schaffte es das Gutspferd gar nicht mehr, das Bauernpferd einzuholen. Nach der siebenten Runde aber holte das Bauernpferd das Gutspferd ein. Holte es ein, galoppierte vorbei und fragte: »Woher kommt es, Freund, daß du mich vorbeiläßt?«
»Ich habe da einen Gedanken, den muß ich mir gründlich überlegen«, antwortete das Gutspferd. Nach der achten Runde aber bog das Gutspferd von der Wettlaufstrecke ab, legte sich nieder und wälzte sich ausgiebig. Das Bauernpferd fragte: »Es wird doch nichts Schlimmes sein?« — »Eine Bremse hat sich unter die Mücken gemischt, sie hat mich so stark gestochen, daß es mir bis ins Mark fuhr. Werde sie vertreiben und dann wieder weiterlaufen — wir haben ja Zeit.« — »Du hast recht, wir haben Zeit«, nickte das Bauernpferd und setzte seinen Weg fort.
Während der neunten Runde hatte das Gutspferd seinen Lauf immer noch nicht fortgesetzt, es schlenderte verschämt zwischen den Büschen umher und zupfte Grashälmchen. »Es wird doch nicht schon Mahlzeit sein, lieber Freund?« fragte das Bauernpferd. »Ja, der Nebel steigt, mir wurde so flau zumute. Halte du, Bruder, nun auch ein, bis zum Morgen ist Zeit genug, um zu laufen«, sagte das Gutspferd. »Warte, warte noch ein Weilchen, noch etwa zehn Runden und noch ein Dutzend, ich bin ja noch nicht einmal richtig warm geworden«, antwortete das Bauernpferd.
Von diesem Abend an soll das Gutspferd sich nicht mehr so gebrüstet haben.
Quelle: Estland
WIE DER GUTSBESITZER IN DEN HIMMEL KAM ...
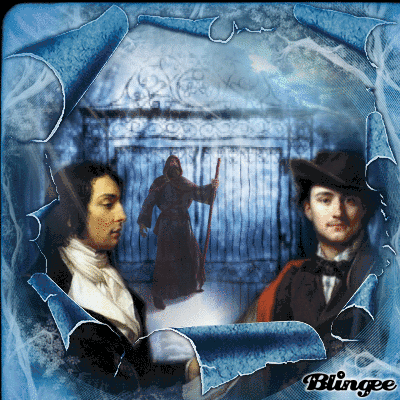
Es war einmal ein Gutsbesitzer. Als sein Stündlein gekommen war, machte er sich auf den Weg nach dem Himmel. Er war schon mehrere Tage unterwegs, da kam er endlich zum Himmelstor; dort klopfte er mit zitternder Hand an. Gleich fragte Petrus: »Wer ist da?« Der Gutsbesitzer erwiderte: »Ich bin ein Gutsbesitzer, komme aus der sündigen Welt und bitte, mich in den Himmel einzulassen.« Petrus antwortete: »Gutsbesitzer werden im Himmel nicht aufgenommen, sie müssen alle direkt in die Hölle wandern, denn der Himmel ist voll von Juden, welche durch Schuld der Gutsbesitzer auf der Reise nach Amerika umgekommen sind.«
Der Gutsbesitzer bat noch mehrere Male, doch Petrus gab immer dieselbe Antwort. Da half es denn schließlich nichts - er mußte in die Hölle wandern, denn auf die Erde wollte er auch nicht mehr zurück. Auf dem Wege zur Hölle kam dem Gutsbesitzer sein alter Advokat entgegen, der fragte ihn: »Was siehst du so mißmutig aus?« Der Gutsbesitzer antwortete: »Wie sollt ich nicht mißmutig sein? Ich wollt in den Himmel kommen, aber Petrus ließ mich nicht zum Tor hinein. Er schickte mich in die Hölle, denn der Himmel soll voller Juden sein.«
Der Advokat sprach: »Komm zurück! Ich will dich schon hinein bringen, hab ich doch auch auf Erden deine Sachen immer gut geführt; ich werde auch mit Petrus schon fertig werden.« Der Gutsbesitzer ließ sich das nicht zweimal sagen. Er ging sogleich mit dem Advokaten zurück. Der Gutsbesitzer und der Advokat langten endlich vor dem Himmelstor an. Der Advokat klopfte ans Tor.
Petrus fragte: »Wer ist da?« Der Advokat antwortete: »Ein alter ehrlicher Gutsbesitzer mit seinem Advokaten.« Petrus sprach: »Ich habe doch schon gesagt, daß Gutsbesitzer nicht in den Himmel kommen!« Der Advokat entgegnete: »Mach das Tor auf und laß wenigstens mich hinein.« Petrus öffnete das Himmelstor, der Advokat ging hinein und sagte zu Petrus: »Geh rasch und ruf mir den lieben Gott selber herbei, ich will ihn persönlich wegen des Gutsbesitzers sprechen; solange du fort bist, bleibe ich hier als Torhüter.« Petrus ging. -
Kaum war er fort, so rief der Advokat mit lauter Stimme in den Himmel hinein: »He! Ich komme grade aus der Hölle, der Teufel versteigert heute alte Kleider!« Kaum hatte er das gesprochen, so stürmten alle Juden zum Himmelstor. Es dauerte nicht lange, so waren sie alle aus dem Himmel hinaus. Jetzt ließ der Advokat den Gutsbesitzer ein, und als Petrus zurück kam, da konnte er nichts dawider sagen, denn Platz war ja genug da.
Seit jener Zeit läßt Petrus aber keinen einzigen Advokaten mehr in den Himmel hinein.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DIE MÜCKE UND DAS PFERD ...
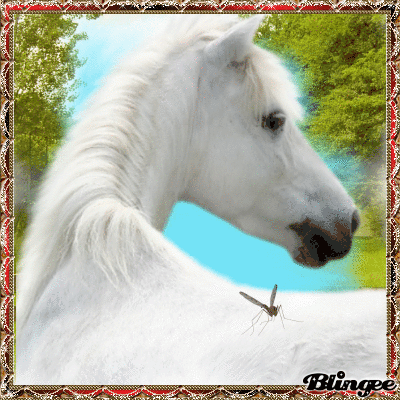
Das Pferd graste auf der Weide, als die Mücke von der Wiese her zu ihm geflogen kam. Das Pferd achtete nicht auf die Mücke, aber die Mücke fragte: »He, Fremder, siehst du mich denn gar nicht?« — »Jetzt sehe ich dich wohl«, erwiderte das Pferd.
Die Mücke betrachtete das Pferd aufmerksam von allen Seiten — den Schwanz, den Rücken, die Hufe, die Beine, den Körper, die Ohren. Dann wiegte sie verwundert den Kopf und sagte: »Ei, ei, mein Lieber, wie groß du bist.« — »Groß bin ich, ja«, nickte das Pferd einverstanden mit dem Kopf. »Und du hast wohl auch viel Kraft, ja?« fragte die Mücke. »Kraft habe ich, ja, viel Kraft«, erwiderte das Pferd. »Die Fliegen werden dir auch nichts anhaben können?« — »Ach was, die Fliegen, die tun mir gar nichts.« —
»Und die Bremsen..., die kommen wohl auch nicht gegen dich an?« — »Ach was, die Bremsen, die schon gar nicht.« Nun plusterte sich die Mücke auf und brüstete sich: »Du kannst so groß sein, wie du willst, du kannst so stark sein, wie du willst — das Mückenvolk, das macht dir den Garaus, als ob es dich gar nicht gegeben hätte!« — »Ach was, wo denkst du hin!« sagte das Pferd. »Doch, doch, es macht dir den Garaus!« versicherte die Mücke.
So stritten sich das Pferd und die Mücke eine ganze Stunde und noch eine zweite — keiner von beiden wollte nachgeben. Schließlich meinte das Pferd: »Lassen wir den Streit und die leeren Worte — wir werden unsere Kräfte messen!« — »Du hast recht, wir werden unsere Kräfte messen«, sprach die Mücke und war einverstanden. Sie flog auf und rief mit heller Stimme: »Hallo, ihr Mücken, fliegt alle herbei! Hallo, ihr Mücken, fliegt alle herbei!«
Oh, wie die Mücken da angeflogen kamen! Sie kamen aus den Birkenwäldern und aus den Fichtenwäldern, aus den Hochmoorwäldern und aus den Sümpfen! Kaum waren sie angelangt, setzten sie sich alle schnurstracks auf das Pferd. Als keine Mücke mehr kam, fragte das Pferd über die Schulter: »Sind nun alle da?« — »Alle sind da, alle sind da!« erwiderte der Anführer der Mücken. »Haben auch alle Platz?« fragte das Pferd. »Alle, alle haben Platz!« erwiderte wiederum der Anführer der Mücken.
Nun legte sich das Pferd nieder und begann sich zu wälzen. Es wälzte und wälzte sich in einem fort und hörte nicht eher auf, bis das ganze Mückenheer tot war. Eine einzige Mücke kam mit dem Leben davon. Taumelnd stieg sie in die Luft, flog zum Anführer der Mücken, stand stramm und meldete, die Hacken zusammenschlagend: »Wir haben den Feind umgelegt! Hätten wir nur noch vier Mann gehabt, die dem Pferd die Beine festgehalten hätten — ich war schon dabei, ihm das Fell abzuziehen.« —
»Brav, brav!« lobte der Anführer der Mücken und sauste wie der Blitz in den Wald, um allen anderen Käfern und Insekten die freudige Nachricht zu überbringen: Das Mückenvolk hat das Pferd besiegt, und ab heute ist das Mückenvolk das mächtigste Volk in der ganzen Welt!
Quelle: Estland
DER LOHN FÜR DIE RETTUNG DES TEUFELS ...

Es ging einmal ein Mann nach Schützenart mit einer Flinte in den Wald. Er kam an einen Fluß. Was sieht er aber da am Flußufer? Ein graues Männchen hat sich dort schlafend lang hin gestreckt und scheint weder von der Erde noch vom Himmel etwas zu wissen.
Der Mann bleibt stehen und denkt nach, wo solch ein Männchen her gekommen sein könne. Plötzlich sieht er aber, daß ein großer Wolf schnaufend an das schlafende Männchen heran schleicht und es zerreißen will. Der Mann läßt das aber nicht zu, sondern schießt den Wolf mit seiner Flinte tot. Und das graue Männchen, welches niemand anders war als Vanapagan, springt plumps! in den Fluß und verschwindet.
Der Mann bleibt stehen und denkt nach: 'Was für ein Teufelsmensch ist das gewesen?' Als bald kommt aber der graue Mann wieder aus dem Wasser hervor, tritt vor den Schützen und fragt: »Hör, was willst du als Lohn dafür, daß du mich gerettet hast?« Der Mann antwortet: »Gib mir aus gutem Herzen das, was du selber willst!« Vanapagan sagte dem Manne, er solle an dem und dem Tage an dieselbe Stelle kommen, und fügte hinzu: »Nimm dann demjenigen mit, der dir am aller nächsten steht!« Der Mann versprach es. Vanapagan war verschwunden, und der Mann ging nach Hause ...
Zur verabredeten Zeit ging er wieder dort hin an das Flußufer, wo er Vanapagan gerettet hatte, und nahm seine Frau mit. Er wartete schon eine Zeit lang auf Vanapagan. Der aber kommt und kommt nicht. Endlich sagt der Mann zu seiner Frau: »Nimm das Messer und such mir den Kopf ab, bis Vanapagan her kommt!« Die Frau tat es. Der Mann schlief sogleich auf dem Schoße seiner Frau ein. Als bald kam auch Vanapagan mit einem Goldkasten. Er sprach zur Frau: »Hör, du hast jetzt ein Messer in der Hand; stoß es deinem Mann in die Kehle, daß er stirbt, dann bekommst du alles Gold für dich allein!«
Die Frau war in ihrem Leichtsinn gleich bereit, ihren Mann zu ermorden. Da legte aber Vanapagan seine Hand vor das Messer und erlaubte es nicht. Dann weckte er den Mann und sprach: »Nun, Mann, sind wir jetzt nicht quitt? Du hast mich vor dem Tode gerettet, als der Wolf mich zerreißen wollte - jetzt habe ich dich vor dem Tode gerettet, denn deine Frau hätte jetzt mit dem Messer deinem Leben ein Ende gemacht, wenn ich dir nicht zu Hilfe gekommen wäre.«
Das Gesicht der Frau war schamrot. Der Mann jedoch sagte: »Wenn die Sache so steht, so sind wir natürlich quitt!« Vanapagan aber sprach wieder: »Nein doch; ich bleibe bei meinem Wort und zahle dir deinen Lohn aus. Ich wollte bloß deine Frau prüfen, ob sie bereit sei, ihren Mann zu ermorden, und zweitens wollte ich dich prüfen, ob du auf meine Worte eingehen wirst. Nimm aber jetzt dieses Gold und geh nach Hause. - Du hättest lieber deinen Hund mitnehmen sollen als deine Frau. Die Frau war bereit, dich zu töten, der Hund hätte das aber nimmer getan und hätte auch keinen Fremden an dich heran gelassen.«
Vanapagan war verschwunden. - Der Mann ging mit seiner Frau nach Hause. Daheim prügelte er sie durch und sagte: »Du leichtsinniges Ding! Du wolltest mich ermorden? Hättest du es dann besser gehabt als jetzt, wenn du mich ermordet und du den Schatz für dich allein genommen hättest? Wart nur, du Galgenstrick! Ich werde dich lehren!«
Darauf lebten sie in ihrem Reichtum zusammen ein glückliches Leben.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
PIKKERS DUDELSACK ...
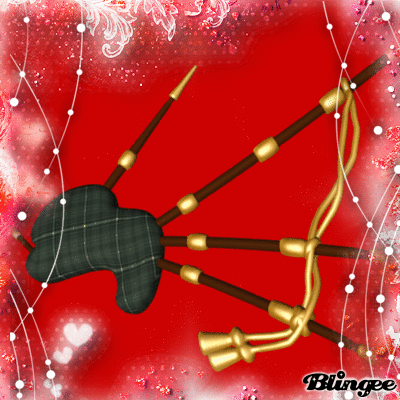
Im Jahre achtzehnhundertsechsundsechzig gab es einen trockenen Sommer. Warum war er wohl so trocken? Waaske, ein Zauberer, erklärte diesen trockenen Sommer folgendermaßen:
An einem warmen Frühlingstage legte sich Pikker in den Sonnenschein schlafen; den Dudelsack legte er an seine Seite und seinen Arm auf den Dudelsack, damit niemand ihm diesen stehlen könne. Vanapagan ging zufällig vorbei und sah Pikker schlafen. Sofort bekam er Lust, den Dudelsack zu stehlen; aber er konnte ihn nicht in seine Hände bekommen, denn Pikkers Arm lag auf dem Dudelsack.
Vanapagan war nicht um einen Rat verlegen, er hatte sogleich einen Plan. Er nahm seinen Sohn auf die Arme und hob ihn empor, damit er den Dudelsack stehle. Aber dem Sohn ging es ganz ebenso, er konnte nicht heran, denn Pikkers Arm lag auf dem Dudelsack! Vanapagan kratzte sich hinter dem Ohr, holte da eine Laus hervor, reichte sie seinem Sohn und hieß ihn, sie hinter Pikkers Ohr zu setzen, damit sie ihn dort beiße; wenn Pikker sich hinter dem Ohr kratze, solle er ihm sogleich den Dudelsack fortnehmen.
So geschah es auch. Die Laus fing an zu beißen; Pikker kratzte sich den Kopf, der Knabe nahm den Dudelsack fort und gab ihn Vanapagan. Dann gingen sie sogleich in die Hölle. Vanapagan verschloß den Dudelsack hinter sieben Schlössern, von wo ihn niemand mehr herausbekommen konnte.
Als Pikker aus dem Schlafe erwachte und seinen Dudelsack nirgends fand, wurde er sehr traurig: woher sollte denn jetzt die Erde ihren Regen bekommen! Pikker erriet gleich, daß Vanapagan den Dudelsack gestohlen hatte; was konnte ihm aber da helfen? Pikker begann zum Zeitvertreib mit seinem Sohn Fische zu fangen. Als sie bis zum Abend gefischt hatten, hatten sie noch keinen einzigen Fisch gefangen.
Plötzlich sah der Sohn, wie ein kleines Männchen unten mit einem Messer ins Zugnetz ein Loch schnitt, die Fische in seinen eigenen Sack laufen ließ und das Loch rasch wieder zunähte. Pikker nahm das kleine Männchen fest. Das war Vanapagans Sohn, welcher sich mit Fischestehlen beschäftigte. Der Knabe begann zu bitten: »Wir haben in der Hölle bald große Hochzeit, denn die Höllentochter heiratet, da haben wir frisches Fleisch nötig.« »Aber anders lasse ich dich nicht frei, es sei denn, daß du versprichst, mich auch zur Hochzeit zu rufen!«
Vanapagans Sohn hatte freilich keine Lust, ihn zu rufen, da er aber sah, daß man ihn anders nicht freilassen würde, so versprach er, Pikker zur Hochzeit einzuladen. Da sagte auch Pikkers Sohn: »Wenn du mich nicht zur Hochzeit einlädst, nehmen wir dir die Fische weg; dann müßt ihr eure Hochzeit ohne frisches Fleisch abhalten.« Dem Knaben tat es leid, die Fische fahren zu lassen, und so lud er Pikkers Sohn ebenfalls zur Hochzeit.
Im Herbste, im Monat August, kamen die Einladungsschreiben. Pikker und sein Sohn sollten in die Hölle zur Hochzeit kommen. Die Hochzeit begann. Die Höllengesellschaft tobte in der größten Hochzeitslust. Schnaps gab es so viel, daß die Hochzeitsgäste darin schwammen. Aller Art Instrumente - Dudelsäcke, Posaunen, Flöten und Trommeln - lärmten durcheinander. Der alte Satan war in bester Laune und blickte auf diese Hochzeitslust, wo alle Höllenbewohner hüpften und sprangen.
Plötzlich kam es Vanapagan in den Sinn, daß er noch einen Dudelsack habe, der hinter sieben Schlössern verschlossen lag. Er ging und brachte auch diesen her, um die Blasmusik zu verstärken. Wohl versuchte er, ihn zu blasen, aber er konnte keinen Ton herausbringen. Pikker schaute hin: »Sieh da, wo mein Dudelsack ist! Könnt ich ihn nur in die Hände bekommen, ich würde euch schon etwas vor blasen!«
Alle Höllenmusikanten versuchten darauf zu blasen, aber keiner konnte den Dudelsack handhaben. Schließlich sprach Pikkers Sohn: »Laßt auch mich probieren, ob ich nicht ein paar Töne herausbringe!« Der Dudelsack wurde Pikkers Sohn übergeben. Der Knabe besah ihn von allen Seiten, dann setzte er ihn an seinen Mund. Alle Hochzeitsgäste versammelten sich um den Knaben, um den neuen Dudelsack hören zu können.
Kreuzmillionendonnerwetter! Als der Knabe los legte, da fuhren Blitze aus dem Dudelsack und Donnergetöse erscholl. Viele der Hochzeitsgäste wurden vom Blitz erschlagen, und die am Leben geblieben waren, sind spurlos verschwunden. Pikker und sein Sohn spazierten durch die leere Hölle und fanden nirgends ein lebendes Wesen. Pikker nahm den Dudelsack und blies darauf so, daß die Hölle krachte.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER TOD AUF DEM APFELBAUM ...
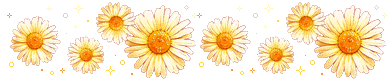
Es war einmal ein alter Mann, der hatte ein kleines Haus. Eines Abends kamen drei Männer und gingen durchs Dorf, und da sie nirgends ein Nachtlager erhielten, so kamen sie auch zu jenem alten Mann. Sie baten ihn um ein Nachtlager, und der Alte antwortete ihnen, sie sollten sich nur hin legen, aber ein Bett könne er ihnen nicht anbieten. Die Männer waren zufrieden und legten sich dort hin.
Der alte Mann machte sich an sein Abendessen - er hatte nur vertrocknete Brotkrusten und Krebsfüße - und bat seine Gäste, mit zu essen, wenn es ihnen schmecke. Und so aßen sie denn alle. Am Morgen, als die Fremden sich zum Fortgehen anschickten, fragten sie den alten Mann, was sie zu zahlen hätten. Der Mann antwortete, daß er keinen Lohn verlange; er habe aber einen Apfelbaum, wenn nur die Äpfel an diesem Baum hängen bleiben wollten! Er habe selbst noch niemals von diesen Äpfeln essen können, denn wenn sie zu reifen anfingen, so verschwänden sie immer alle vom Baume. Die Männer versicherten ihm, daß seine Äpfel von nun an nicht mehr verschwinden würden.
Eines Morgens ging der alte Mann hinaus, um zu harnen, und sah - der Apfelbaum war voll kleiner Knaben, und im Wipfel saß auch noch ein erwachsener Mann. Der Alte fragte ihn: »Freund, wie bist du hier her geraten?« Der Mann antwortete nichts. Nun ließ der Alte die Knaben vom Baume herunter steigen, aber den großen Mann ließ er nicht frei. Der Mann begann aber ihn an zu bitten, und da ließ er ihn ebenfalls gehen.
Kurz darauf kam der Tod zum Alten und sagte, es sei Zeit, daß der Alte mit ihm gehe. Dieser bat, der Tod möge ihm erlauben, noch einige Äpfel mit auf den Weg zu nehmen, und der Tod erlaubte es auch. Aber die Äpfel hingen hoch oben, und der alte Mann konnte nicht hinauf langen. Da kletterte der Tod mit seinen langen Beinen selbst auf den Baum und holte die Äpfel, als er aber hinab steigen wollte, da wurde er nicht mehr frei: wohl schüttelte er den Baum, konnte aber vom Baume nicht los kommen.
Nun begann er den alten Mann zu bitten, dieser möge ihn hinab steigen lassen. Der Alte sagte, er wolle das tun, wenn der Tod ihm noch einige Jahre zu leben vergönne. Und als der Tod endlich vom Baume herab kam, da wußte er nicht, wohin er vor jenem Manne fliehen solle. Und deshalb liebt es der Tod bis auf den heutigen Tag nicht, alte Leute zu holen.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen - Livische Märchen
DIE WUNDERBARE FLÖTE ...
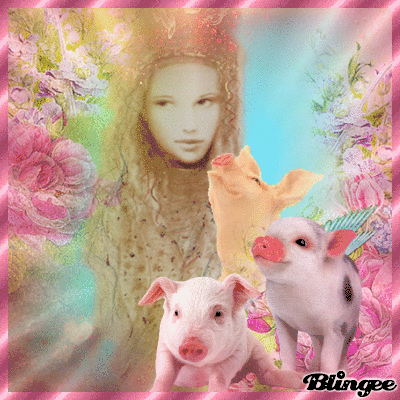
Ein junger Schweinehirt hatte eine so gute Flöte, daß, wenn er sie blies, alles geschah, was er nur wünschte. Einmal war er mit seiner Schweineherde an der Landstraße; er blies die Flöte, und die Schweine tanzten. Da ging eine reiche Kaufmannstochter des Wegs vorbei. Sie war sehr verwundert darüber, daß die Schweine tanzten, und wollte dem Burschen ein Schwein abkaufen. Der Bursche war auch bereit, es zu verkaufen. Er stellte nur die Bedingung, daß die Kaufmannstochter ihm ihr Gesicht zeigen solle.
Die Kaufmannstochter war zufrieden. Sie lüftete ihren Schleier und zeigte dem Burschen ihr schönes Gesicht. Dann ließ sie das Schwein nach Hause bringen. Sie hoffte nun, daß das Schwein zu tanzen anfangen werde, das Schwein tanzte aber gar nicht. Am anderen Tage klagte die Kaufmannstochter dem Burschen ihr Leid: »Hör einmal, Bursche, das gestrige Schwein tanzt gar nicht!« Der Bursche antwortete: »Wohl wahr, jenes tanzt nicht gut, aber die anderen tanzen besser!«
Die Kaufmannstochter wollte sich sogleich ein anderes Schwein kaufen. Der Bursche erwiderte: »Zeigt mir Euren Hals, dann bekommt Ihr ein Schwein, welches tanzt!« Die Kaufmannstochter zeigte ihm ihren Hals. Dann bekam sie ein anderes Schwein. Daheim erzählte der Bursche seinem Herrn, daß der Wolf das Schwein geholt habe.
Die Kaufmannstochter wartete, daß das Schwein zu tanzen anfange, aber sieh mal an! Das Schwein tat nichts, was nicht auch andere Schweine tun. Am nächsten Tage ging die Kaufmannstochter wieder, dem Burschen ihr Leid zu klagen, daß das Schwein nicht tanze. Der Bursch entgegnete: »Das Schwein versteht nicht allein zu tanzen. Nehmt noch ein drittes dazu, das tanzt am aller besten. Dann tanzen sie alle zusammen!«
Die Kaufmannstochter fragte, was das Schwein koste. Der Bursche antwortete: »Zeigt mir Euren Hals bis zu den Armen!« Die Kaufmannstochter zeigte es ihm. Der Bursche sah, daß die Kaufmannstochter unter dem einen Arm Goldhaare hatte, unter dem anderen Silberhaare. Der Bursche gab ihr das dritte Schwein ab. Zu Hause erzählte der Bursche seinem Herrn, daß der Bär das Schwein geholt habe. Der Herr jagte den Burschen fort, weil er jeden Tag sich ein Schwein rauben lasse.
Der Bursche ging seines Weges und blies zum Zeitvertreib seine Flöte. Da sieht er: es kommt ein Wagen, und drei Männer sind darin. Der Bursche bläst die Flöte und denkt: 'Die Pferde sollen tanzen, die Herren sich prügeln!' Sofort begannen die Pferde vor dem Wagen an zu tanzen und die Herren im Wagen sich zu prügeln. Die Pferde liefen aber immer weiter.
Nach kurzer Zeit holte wieder ein Wagen den Burschen ein, ein Herr saß darin, ein schwarzer Hengst war vorgespannt. Der Bursche blies seine Flöte und dachte: 'Möchte jener Herr mich in den Wagen nehmen!' Der Herr hielt sogleich das Pferd an und rief den Burschen in seinen Wagen. Er fragte den Burschen: »Fuhr hier nicht ein Wagen vorbei, in dem drei Herren saßen?« Der Bursche erwiderte: »Freilich fuhr er vorbei, aber die Herren zankten sich untereinander!« Der Herr erklärte: »Wie sollten sie sich denn nicht zanken? Wir fahren alle vier, um die Kaufmannstochter zu freien. Sie zankten sich deswegen, wer von ihnen die Kaufmannstochter bekommen solle.« In solchem Gespräch erreichten sie das Haus des Kaufmanns.
Der Bursche bat: »Ich komme mit in die Stube hinein und krieche unter den Tisch. Wenn Ihr zu essen anfangt, so werft auch mir einige Mundvoll unter den Tisch hinab!« Der Herr versprach es. Die anderen Herren waren schon in der Stube und säuberten ihre blutigen Gesichter und Kleider. Jener, der mit dem Burschen gekommen war, wurde am aller freundlichsten aufgenommen.
Man setzte sich nun an einen prächtigen Tisch, um zu speisen. Während des Essens warf der Herr dem Burschen unter dem Tisch auch etwas zu. Nach der Mahlzeit sprach der Kaufmann: »Nur derjenige bekommt meine Tochter, der ihre besonderen Kennzeichen nennen kann!« Der Bursch unter dem Tisch sprach: »Eure Tochter hat unter dem einen Arm Goldhaare, unter dem anderen Silberhaare!« Der Herr sagte gleich: »Habt ihr es nicht gehört, ich hab es gesagt!«
Die Kaufmannstochter hatte aber deutlich gehört, daß die Stimme unter dem Tisch hervor gekommen war. Man begann zu suchen, fand unter dem Tisch den Burschen und fragte ihn, ob er geantwortet habe. Kühn erwiderte der Bursche, er habe so gesprochen. Dann setzte er sogleich die Pfeife an den Mund und dachte, die Kaufmannstochter soll sich in ihn verlieben.
Sofort sprach die Kaufmannstochter zu den anderen Herren: »Dieser Bursche hat meine besonderen Kennzeichen genannt, deshalb nehme ich ihn zum Mann!« Der Kaufmann war damit zufrieden, die Freier dagegen zogen erbost ihres Weges. Dem Burschen wurden feine Kleider angezogen. Die Hochzeit dauerte ununterbrochen sieben Tage und Nächte. Es wurde genug gegessen und getrunken, genug musiziert und getanzt. Der Bursche lud auch seinen früheren Herrn zur Hochzeit ein, der kam aber nicht.
Nach dem Tode des Kaufmanns erbte der Bursche dessen ganzes Vermögen. Zu der Zeit aber verschwand die Flöte des Burschen. Er hatte sie ja auch nicht mehr nötig, weil er sowieso schon reich genug war.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DES KRÄHENMÄNNCHES HEIRAT ...
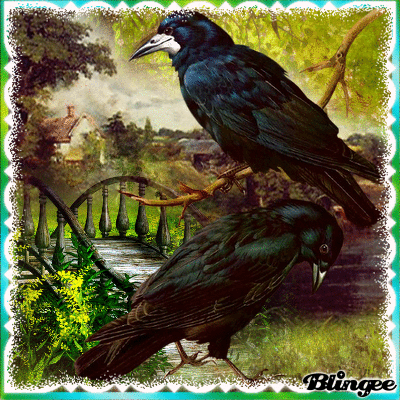
Einmal flog ein Krähenmann aus Järwen nach Harrien auf die Freite. Er erzählte der Braut und deren Eltern, er sei ein reicher Mann, habe große Felder und ganze Haufen von Getreide. Er könne mit seiner Frau ohne Sorgen leben. Den Brautvater und die Brautmutter lud er zu sich ein, seinen Reichtum zu sehen. Sie flogen hin. Der Krähenmann zeigte ihnen alle Kornschober in der Nähe seines Nestes und sagte, dies alles gehöre ihm.
Die Brauteltern flogen nach Harrien zurück und priesen vor der Tochter den Reichtum des Bräutigams. Sie wollten einem so reichen Manne ihre Tochter nicht verweigern. Die Braut selber war auch bereit, nach Järwen zum Krähenmanne zu ziehen. Es wurde also mit der Elster nach Järwen die Botschaft geschickt, die Braut könne abgeholt werden. So gleich flog der järwische Krähenmann nach Harrien und holte seine Braut heim. Die Neuvermählte machte sich sogleich an die Kornschober.
Eines Morgens, als die neu vermählte Krähe gerade oben auf einem Kornschober mit Fressen beschäftigt war, kamen die Menschen mit mehreren Wagen und führten auch den letzten Kornschober fort. Als die Krähe das sah, schrie sie: »Jaak, Jaak! Das Getreide wird fort geführt! Das Getreide wird fortgeführt!«
Ihr Mann hörte das und schrie ihr entgegen: »Jeder führt das Seine fort! Jeder führt das Seine fort!«
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
WIE DER RABE DIE MEISE FREIEN WOLLTE ...
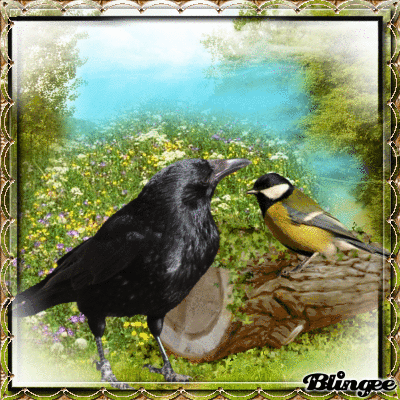
Der Rabe hatte die Meise getroffen und beschloß, sie zu freien. Auch die Meise fand am Raben Gefallen, so war sie einverstanden. Am Abend, als man sich zu Tisch setzte, um sich zu stärken, fragte der Rabe seine Braut: »Sag, warum bist du nur so klein?« — »Ich bin noch sehr jung, ich bin noch sehr jung«, antwortete die Meise. »Du wirst also noch wachsen?« — »Aber ja doch! Natürlich werde ich noch wachsen!«
Nach dem Abendessen wurde es der Braut langweilig. Sie gähnte ohne Unterlaß und sagte schließlich zum Bräutigam: »Es ist so langweilig bei dir, erzähle mir irgendeine Geschichte, damit es nicht mehr so langweilig ist.« — »Gut«, meinte der Rabe und begann sofort zu erzählen: »Im vorigen Jahr wuchs im Dorf hinterm Wald, wo mein Onkel lebt, eine so hohe Bohne, daß die Schnecke daran dreimal zur Regenwolke kletterte, um zu trinken.« — »Ach, was ist das schon für ein Wunder«, sagte die Meise. »Im vorvorigen Jahr hab' ich solch eine lange Erbse gesehen, daß die Heuschrecke daran zur Sonne kletterte, um sich die Pfeife anzuzünden.«
Der Rabe erzählte sofort eine andere Geschichte: »Vor drei Jahren kam im selben Dorf hinterm Wald solch ein Wind auf, daß die Menschen auf allen vieren gingen. Sie konnten diese Gewohnheit erst nach mehreren Monaten loswerden.« — »Ach, was ist das schon für ein Wunder«, sagte die Meise. »Vor fünf Jahren habe ich einen Wind erlebt, daß die Windmühlen ohne Flügel zu sein schienen, so schnell drehten sie sich.«
Da erzählte der Rabe nun die dritte Geschichte: »Vor zehn Jahren soll es solch einen harten Frost gegeben haben, daß die Fichten von den Wurzeln bis zu den Wipfeln entzwei sprangen. « — »Ach, was ist das schon für ein Wunder!« rief die Meise. »Vor ungefähr einem Dutzend Jahren, als ich noch um meine dritten Söhnchen trauerte, gab es um Neujahr solch einen harten Frost, daß der vor dem Ofen den Brotteig knetenden Frau die Hand im Teig einfror und die Suppe im Topf auf dem Herd auf einer Seite kochte, auf der anderen aber zu Eis gefroren war.« —
»So, so, das muß damals ja wirklich ein sehr harter Frost gewesen sein...« meinte der Rabe, seufzte und bat um Erlaubnis, kurz vor die Tür zu gehen. Danach kam er nie wieder.
War es nun die Geschichte mit der Bohne, mit der Erbse oder mit dem Frost, ganz gleich, welche es war, nein, ein solch altes Weib, das das alles gesehen und miterlebt hatte, wollte er nun doch nicht.
Quelle:Estland
DES NEBELBERGES KÖNIG ...
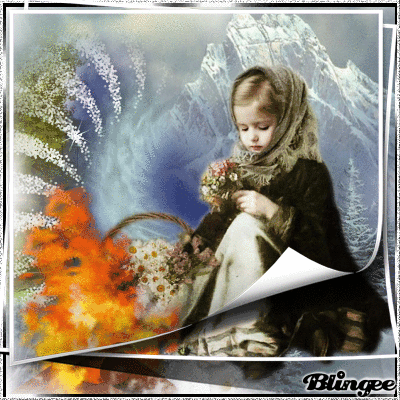
Es waren einmal Dorfkinder auf Nachthütung im Walde. Die Nacht war kalt und neblig, so daß auch am Feuer die erstarrte Hand nicht mehr warm werden wollte. Da sagte eines der Mädchen, das einen aufgeweckten Geist hatte: »Ich will lieber ein Stück Weges laufen, das wird mir mehr Wärme geben als das Sitzen am Feuer.« Mit diesen Worten sprang es auf und lief davon.
Die anderen lachten hinter ihr her und sagten: »Sie wird wohl bald zurück kommen!« Aber der Flüchtling kam nicht wieder. Als die Morgenröte schon am Himmel stand, fingen sie an, das verschwundene Mädchen zu rufen, erhielten aber von keiner Seite her eine Antwort. Die Kinder meinten nun, sie müsse wohl ins Dorf gegangen sein. Als man aber heimkam, war die Vermißte nirgends zu finden. Die Eltern gingen in den Wald, ihre Tochter zu suchen; umsonst aber strichen sie über einen halben Tag lang von einem Flecke zum anderen, sie fanden keine Spur von ihr. Da dachten sie mit Schrecken daran, daß wilde Tiere das Mädchen getötet haben könnten. Sorgenvoll und betrübt gingen sie gegen Abend wieder nach Hause.
Das verloren gegangene Kind war schon eine Strecke weit von den übrigen abgekommen, als es an eine Bergspitze gelangte, auf der ein kleines Feuer brannte, weiter konnte es durch den dichten Nebel nichts sehen. Das Kind dachte, seine Gefährten seien da am Feuer, kletterte den Berg hinan und sah, daß ein graubärtiger, einäugiger Mann ausgestreckt am Feuer lag und es mit einem Eisenstecken schürte. Das Kind erschrak und wollte zurück, aber der Alte hatte es schon bemerkt und rief in strengem Tone: »Bleib stehen, oder ich werfe den Eisenstecken nach dir! Zwar habe ich nur ein einziges Auge, aber das ist ebenso sicher wie die Hand, so daß ich niemals mein Ziel verfehle!«
Das Kind blieb zitternd stehen. Der Alte hieß es näher kommen, und als das Mädchen furchtsam zögerte, stand er auf, nahm es bei der Hand und sagte: »Komm und wärm dich!« Das Mädchen mußte nun wohl mit gehen. Der Alte nahm Weißbrot aus seinem Schultersack und gab es dem Kinde zu essen. Dann klopfte er mit dem Eisenstecken auf den Rasen, und als bald standen zwei hübsche Mädchen am Feuer, als wären sie aus der Erde hervor gewachsen. Es dauerte nicht lange, so hatten sich die Kinder miteinander befreundet, spielten und trieben Kurzweil am Feuer, der Alte aber hatte das Auge geschlossen, als schliefe er.
Als die Morgenröte heraufstieg, trat ein altes Mütterchen heran und sprach zum Dorfkinde: »Heute mußt du bei unseren Kindern zu Gast bleiben und auch die nächste Nacht hier schlafen, dann schicke ich dich wieder nach Hause.« Obwohl sich nun das Dorfkind anfangs geängstigt hatte, so war es dort bald mit den anderen Kindern so bekannt geworden, daß es weder Furcht noch Heimweh mehr empfand. Der Tag verging ihnen spielend, und abends wurden die Kinder miteinander zur Ruhe gelegt. Den anderen Morgen aber kam ein junges Frauenzimmer und sprach zum Dorfkinde: »Du mußt heute nach Hause gehen, denn deine Eltern haben deinetwegen großen Kummer, sie glauben, du seist gestorben.«
Mit diesen Worten führte sie das Kind an der Hand, bis sie aus dem Walde herauskamen. Dann sagte die Führerin: »Von dem, was du gestern und die vorige Nacht gehört und gesehen hast, darfst du kein Wörtchen zu Hause reden, sage nur, du habest dich im Walde verirrt.« Darauf gab sie dem Kinde eine kleine silberne Spange und sagte: »Wenn dich die Lust anwandeln sollte, wieder einmal zu uns zu Gast zu kommen, so hauch nur auf diese Spange, so findest du schon den Weg zu uns!« Das Kind steckte die Spange in die Tasche und dachte auf dem Wege zum Dorfe daran, was wohl die Eltern von der Sache halten würden, da sie ihnen die Wahrheit nicht gestehen dürfe.
In der Dorfgasse gingen zwei Männer an ihr vorüber, welche sie nicht kannte. Als sie in des Vaters Hoftor trat, schien ihr der Ort gänzlich fremd; wo vorher nichts gestanden hatte, da wuchsen jetzt Apfelbäume, an denen schöne Früchte hingen. Auch das Haus erschien ihr fremd. Da trat ein fremder Mann aus der Tür, schüttelte verwundert den Kopf und sagte, so daß das Mädchen auf dem Hofe es hörte: »Ein fremdes Dorfmädchen ist auf unserem Hofe.« Dem Mädchen erschien die Sache wie ein Traum, doch trat sie einige Schritte näher, bis sie an die Türschwelle kam. Als sie ins Zimmer hinein sah, erblickte sie den Vater, der auf der Ofenbank saß; eine fremde Frau und ein junger Mann saßen neben ihm, aber dem Vater waren Bart und Haupthaar ganz grau geworden.
»Guten Morgen, Vater!« sagte die Tochter. »Wo ist die Mutter?« - »Die Mutter, die Mutter?« rief die fremde Frau. »Hilf Gott! Bist du der verlorenen Tiu Geist, oder bist du ein lebendiges Geschöpf wie wir? Ist es denn möglich, daß unser liebes Kind, das uns vor sieben Jahren starb, zum zweiten Male ins Leben zurück kommt?« Tiu konnte aus dieser Rede nicht klug werden. Da erhob sich die fremde Frau von der Bank, streifte Tius Hemdärmel auf, fand auf der Handwurzel eine kleine Brandnarbe und rief dann aus, das Mädchen umhalsend: »Unsere Tiu, unser für tot beweintes Kind, das vor sieben Jahren im Walde verloren ging.« - »Das kann ja nicht sein«, erwiderte Tiu, »ich bin nur eine Nacht und einen Tag von euch weg gewesen, oder zwei Nächte und einen Tag.«
Jetzt gab es genug, sich zu wundern; Tiu sah nun deutlich, daß sie länger weg gewesen war, als sie glaubte, denn sie war jetzt schon größer als ihre Mutter, und Vater und Mutter waren gealtert. Gern hätte sie den Eltern erzählt, was ihr begegnet war, allein sie durfte ja nicht. Endlich sagte sie: »Ich hatte mich verirrt und war unter fremde Leute geraten.« Der Eltern Freude über ihr wieder gefundenes Kind war so groß, daß sie nicht weiter nachforschten, wo es denn gewesen sei.
Den anderen Abend aber, als Vater und Mutter schlafen gegangen waren, ließ es der Tiu keine Ruhe mehr, sie zog die Spange aus der Tasche und hauchte darauf, um Auskunft darüber zu erlangen, was für ein wundersames Ereignis sich mit ihr zugetragen. Als bald fand sie sich wieder am Feuer auf dem Berge, und auch der einäugige Alte war wieder da. »Lieber alter Vater«, bat Tiu, »gib mir Auskunft darüber, was mit mir vor gegangen ist.« Der Alte erwiderte lachend: »Plappern ist Weibersache!«, klopfte mit seinem Stecken auf den Rasen, und das junge Frauenzimmer, welches Tiu nach Hause geleitet und ihr die Spange geschenkt hatte, stand vor ihr.
Sie nahm Tiu bei der Hand und führte sie einige Schritte vom Feuer weg; dort sagte sie: »Da du dir zu Hause nichts hast merken lassen, will ich dir mehr verraten. Der Alte am Feuer ist des Nebelberges König, die alte Mutter, welche du die erste Nacht gesehen hast, ist die Rasenmutter, und wir sind die Töchter. Ich will dir jetzt eine noch schönere bunte Spange geben, sage zu Hause, du habest sie gefunden. Willst du uns sehen, so hauch nur wieder auf die Spange. Heute darf ich dir nichts weiter sagen, aber sei verschwiegen, so wirst du künftig mehr von uns zu hören bekommen. Jetzt geh nach Hause, ehe die Eltern aus dem Schlafe erwachen.«
Als sie am Morgen erwachte, hielt sie das in der Nacht Geschehene für einen Traum, aber die schöne Spange auf ihrer Brust bewies ihr, daß sie nicht geträumt hatte. Indes war ihr das Leben im Dorfe so fremd geworden, daß sie häufig abends, wenn die Eltern schlafen gegangen waren, auf ihre Spange hauchte und sich dadurch, wie sie wünschte, auf den Nebelberg versetzte. Am Tage war sie meist verdrießlich, weil sie sich nach ihrem nächtlichen Glücke sehnte und somit wenig Ruhe hatte. Als der Herbst kam, fanden sich viele Freier ein, aber sie wies sie ab; endlich vor Weihnacht wurde mit dem jungen Manne, welchen sie bei ihrer Rückkehr auf des Vaters Hofe gesehen hatte, Branntwein getrunken. Der Bräutigam blieb als Schwiegersohn im Hause, denn die Eltern waren beide schon betagt.
Im nächsten Jahre brachte Tiu ein Töchterchen zur Welt, es war ein sehr schönes Kind, konnte aber doch der Mutter Herz nicht ausfüllen. Sie sehnte sich stets nach dem Nebelberge zurück und wäre gern hingezogen, wenn sie das Kind hätte allein lassen können. Als aber die Tochter sieben Jahre alt geworden war, kam eine Nacht, wo die Mutter ihr Verlangen nicht mehr zurück drängen konnte, sie hauchte auf die Spange und sah sich auf den Nebelberg versetzt.
Der Rasenmutter Töchter kamen ihr mit Freudengeschrei entgegen. »Warum bist du so lange weggeblieben?« fragten sie. Tiu sagte mit tränenden Augen, daß es ihr nicht möglich gewesen sei, zu kommen, wie wohl ihr Herz großes Verlangen danach getragen habe. »Des Nebelberges König muß uns helfen«, sagten darauf die Mädchen und baten Tiu, nach zwei Wochen wiederzukommen und ihr Töchterchen mit zu bringen. Tiu versprach, es zu tun, wenn es möglich wäre.
Als aber die Zeit heran gekommen war, schlief das Kind so ruhig an des Vaters Seite, daß die Frau nicht das Herz hatte, es mit sich zu nehmen, sie ging deshalb, in dem sie sich der Spange bediente, allein. Der alte König des Nebelberges lag beim Scheine des Feuers am Boden und sagte, als er Tiu erblickte: »Du bist heute zur unglücklichen Stunde ohne dein Kind her gekommen, und es wird dir große Qual daraus erwachsen. Doch kannst du zu guter Letzt noch eine vergnügte Nacht feiern, ehe deine Leidenstage beginnen.« Bei diesen Worten klopfte er mit dem Eisenstecken auf den Rasen, und sofort erschienen der Rasenmutter Töchter, nahmen Tiu mit sich und feierten ein schönes Fest miteinander.
Inzwischen war daheim der Mann erwacht, und als er die Frau nicht im Bette fand, stand er auf und suchte sie auf dem Hofe. Auch hier fand er keine Spur der Verschwundenen. Da entbrannte im Manne der Zorn, denn er glaubte, die Frau sei irgendwo auf bösen Wegen, darum legte er sich nicht wieder hin, sondern ging sofort zu einem Weisen des Dorfes, ihm den Fall zu erzählen und ihn um Rat zu fragen. Als der Weise sich aus einem Weinglase Aufschluß verschafft hatte, sagte er: »Mit deinem Weibe steht es nicht, wie es sein soll, sie geht des Nachts als Werwolf um und hat das gewiß schon lange getrieben, nur daß du es bis heute nicht bemerkt hast. Wenn sie nach Hause kommt, mußt du sie gleich vor Gericht stellen.«
Der Mann fand, als er nach Hause kam, die Frau an der Seite des Kindes ruhig im Bette schlafen, er weckte sie jedoch nicht, um sie über ihren nächtlichen Gang auszufragen, sondern ging vor Gericht, wie der Weise gewollt hatte. Die Frau wurde vor gefordert. Sie weigerte sich, Auskunft darüber zu geben, wo sie vergangene Nacht gewesen sei, wollte auch nicht gestehen, wo sie früher als Kind sieben Jahre lang sich verborgen gehalten, und sagte nur: »Meine Seele ist schuldlos, mehr kann ich nicht sagen.«
Auch später wollte sie ihr Geheimnis nicht verraten, so daß endlich der Spruch gefällt wurde: das Weib ist ein Werwolf, eine Hexe und Übeltäterin, deshalb muß sie den Feuertod sterben. Es wurde dann ein großer Scheiterhaufen errichtet, an welchen man das arme Weib festband, worauf er angezündet wurde. Als aber die Flamme eben aufloderte, fiel so dichter Nebel, daß man die Hand vor den Augen nicht sehen konnte. Als später die Sonnenstrahlen den Nebel auf sogen, fand man den Scheiterhaufen noch unversehrt, das Weib aber war nirgends zu finden, es war, als ob sie im Nebel zerflossen wäre. - Des Nebelberges König hatte sie gerettet.
Wie wohl nun Tiu jetzt auf dem Nebelberge gute Tage hatte, so fand ihr Herz doch keinen Frieden, sondern sehnte sich nach dem zurück gebliebenen Kinde. »Hätte ich mein Töchterlein hier«, so seufzte sie oft, »dann könnte ich glücklich leben, so aber ist das halbe Herz immer bei dem Kinde im Dorfe, und die andere Hälfte lebt in Trauer.« Des Nebelberges König erriet ihre geheimen Gedanken und ließ einst bei Nacht das Töchterlein aus dem Dorfe zur Mutter bringen.
Da waren beide, Mutter und Tochter, vollkommen glücklich und sehnten sich nach nichts mehr. Die Dorfleute und der Mann glaubten, daß die in einen Werwolf verwandelte Frau das Kind bei Nacht fort genommen habe. Der Mann freite eine andere Frau, aber weder seine eigene Wirtschaft noch die anderen Höfe nahmen so guten Fortgang wie sonst; allsommerlich litten sie Schaden durch Dürre, das Getreide und Gras verdarben, weil der erfrischende Nachttau nicht auf den Strich fiel, den die Leute bewohnten.
Des Nebelberges König war zornig darüber, daß sie sein Pflegekind hatten umbringen wollen.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER SCHLANGENKAMM ...
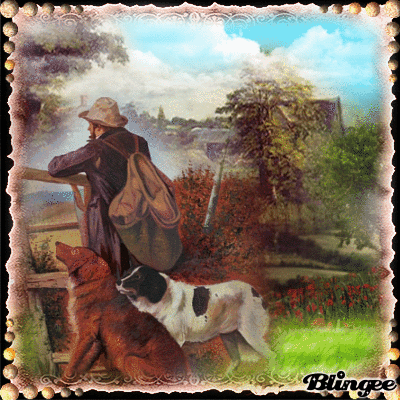
Es ging einmal ein Jäger in den Wald. Dort traf er eine Schlange, die auf dem Kopf einen Kamm hatte. Der Jäger schoß auf sie mit der Flinte. Die Schlange begann zu schreien. Auf ihr Geschrei strömte eine Menge kleiner Schlangen herbei. Wohl schlug der Jäger mit einem Knüttel nach ihnen, das half aber nichts. Endlich warf der Jäger seine eigenen Kleider ihnen zu. Da blieben die Schlangen bei den Kleidern, und der Jäger konnte entfliehen.
Am anderen Tage ging der Jäger wieder dorthin, wo er nach der Schlange mit dem Kamm geschossen hatte. Er fand die Schlange wieder vor. Sie hatte nur noch wenig Leben in sich und konnte nicht mehr entfliehen. Dem Jäger kam der alte Glaube in den Sinn: Wer einen Schlangenkamm aufißt, der versteht alle Vogelsprachen. Der Jäger nahm den Schlangenkamm, ging nach Hause, kochte ihn und aß ihn auf.
Dann ging er hinaus spazieren. Eine Krähe krächzte, und der Mann verstand alles, was die Krähe sprach. Am nächsten Abend ging der Jäger in den Wald auf die Jagd. Im Walde wurden die Hunde des Jägers unruhig und fingen an, um den Herrn herumzuwinseln. Der Herr streichelte sie und fragte sich selbst: 'Wer weiß, was den Hunden fehlen mag?' Der eine Hund öffnete das Maul, und der Jäger verstand sogleich, was der Hund in seiner eignen Sprache sagte: »Diebe kommen heute in unsre Vorratskammer, um zu stehlen!«
Da bekam der Jäger sofort Eile, nach Hause zu gehen. Aber der eine Hund sprach zu dem andern: »Bleib du hier! Ich gehe nach Hause, um die Klete zu bewachen!« Als der Jäger das hörte, ließ er den Hund nach Hause gehen, selber aber blieb er mit dem anderen Hunde im Walde. Der erste Hund kam nach Hause und verscheuchte die Diebe sogleich in den Wald.
Die Hausfrau kam auf das Gebell des Hundes aus der Stube heraus und sah, was geschehen war. Die Hausfrau lobte den Hund und sprach: »Dafür will ich dir etwas Gutes geben, woran du dich satt essen kannst!« Die Hausfrau ging in die Stube. In der Stube fand sie aber kein Wasser. Da nahm sie Spülicht, tat Mehl hinein und setzte es dem Hund vor. Der Hund schnupperte daran, fraß es aber nicht, sondern wollte aus der Stube hinaus.
Die Hausfrau ließ den Hund ins Freie, und der Hund lief zum Hausherrn in den Wald. Der andere Hund fragte ihn: »Nun, wie ging es zu Hause?« Jener antwortete: »Die Diebe hab ich freilich fort gejagt, und die Hausfrau hat mir zu essen gegeben! Aber was soll man da essen! Schmutziges Spülicht mit etwas Mehl!«
Der Hausherr hörte das. Er ging nach Hause und nahm sich seine Frau vor: »Wie darfst du so etwas tun! Der Hund hat unser Eigentum vor dem Diebe behütet, und du setzt ihm schmutziges Wasser vor!« Die Frau fragte ihn: »Wer hat es dir denn gesagt, daß ich das getan habe?« Der Jäger antwortete: »Die Hunde haben es gesagt!« Die Frau entgegnete: »Hunde sprechen doch nicht! Hunde bellen!«
Der Jäger antwortete: »Ich hab einen Schlangenkamm in die Hände bekommen, hab ihn gekocht und aufgegessen. Deshalb versteh ich jetzt die Sprachen der Tiere!« Als der Jäger das gesprochen hatte, fiel er zur Erde und war tot.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DIE GELDMÜHLE ...
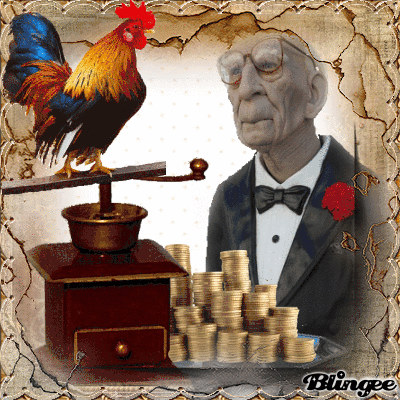
Es war einmal ein alter Mann, der hatte eine Bohne. Er wollte die Bohne verspeisen, die Bohne aber bat ihn, er solle sie nicht essen - lieber solle er sie in die Erde pflanzen. Also pflanzte der Mann sie in einen Topf und stellte ihn auf das Fenster seiner Hütte. Eines Tages sah er nach, wie hoch die Bohne schon gewachsen sei - da reichte sie bis zur Zimmerdecke; er sah am folgenden Tage nach - da reichte sie bis zum Dach; und am dritten Tage reichte sie bis zum Himmel.
Nun kletterte der Mann an der Bohnenranke in den Himmel und sah, wie die Engel Geld mahlten. Er bat, man solle die Geldmühle ihm geben, und er bekam sie auch - nur sagten ihm die Engel, er dürfe die Mühle bloß einmal täglich umdrehen, dann werde er Geld bekommen, wenn er sie öfter drehe, so bekomme er nichts als Staub. Nun, der alte Mann drehte sie auch nur einmal täglich und erhielt auf solche Weise viel Geld.
Die anderen merkten, daß der alte Mann viel Geld hatte, und wurden auf ihn neidisch; und die Mühle wurde dem alten Mann gestohlen. Er hatte aber einen Hahn, der sang, daß die Mühle gestohlen sei und daß ein reicher Bauer das getan habe. Jener Bauer erfuhr, daß irgendwo ein Gut zu verkaufen sei; er wollte es kaufen und brauchte dazu viel Geld, so mahlte er also täglich viele Mal und schüttete alles in den Keller; schließlich dachte er, daß der Keller schon voller Geld sei, als er aber die Tür auftat, da war dort nichts als Staub.
Nun flog der Hahn auf das Dach des Kellers und krähte: »Kleine Herren, Bettelherren, gebt des armen Mannes Geldmühle heraus!« Der Bauer wurde vor Scham sehr böse und sperrte den Hahn in den Kuhstall ein. In der Nacht öffnete der Hahn das Tor, der Wolf sprang in den Stall und fraß alle Kühe auf. Am Morgen sang der Hahn wieder sein altes Lied, der Bauer solle des armen Mannes Geldmühle herausgeben.
Nun sperrte der Bauer den Hahn in den Pferdestall ein. Der Hahn aber öffnete in der Nacht wieder das Tor, der Wolf sprang hinein und zerriß alle Pferde. Und am Morgen sang der Hahn wieder dasselbe alte Lied: »Kleine Herren, Bettelherren, gebt des armen Mannes Geldmühle heraus!«
Da warf der Bauer ihn in den Brunnen, aber der Hahn trank den Brunnen leer und sang immer wieder sein altes Lied. Der Bauer steckte den Hahn in den Ofen, damit er verbrenne, aber der Hahn löschte mit dem Wasser das Feuer und sang immer wieder sein Lied: »Kleine Herren, Bettelherren, gebt des armen Mannes Geldmühle heraus!«
Da nahm der Bauer den Hahn, tötete ihn und aß ihn auf. Doch der Hahn begann sogar in des Bauern Bauch sein Lied zu singen, kam dann aus dem Bauche noch wieder heraus und sang immer: »Kleine Herren, Bettelherren, gebt des armen Mannes Geldmühle heraus!«
Da ging der Bauer hin und gab dem armen Mann sowohl seine Mühle als auch seinen Hahn zurück. Und so mahlt der alte Mann Geld noch bis auf den heutigen Tag.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen - Livische Märchen
DIE TIERE GEHEN ZUR BEICHTE ...
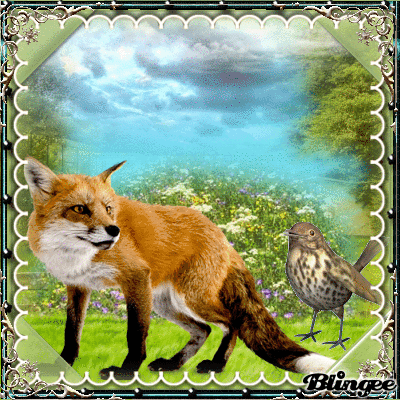
Es war einmal eine Frau, die hatte eine Katze. Die Frau sammelte Milch und sammelte so lange, bis sie einen großen Topf gefüllt hatte. Die Katze kam und stieß den Topf um, mit samt der Milch. »Ich Ärmste«, jammerte die Katze, »was soll ich nun anfangen, wie soll ich Verzeihung erlangen für diese Sünde? Was wird da anderes helfen, ich will gehen, meine Sünden wieder gut zu machen!«
Die Katze ging fort, um zu beichten, und geriet in den Wald; da kam ihr der Hase entgegen, der wünschte ihr einen guten Tag: »Sei gegrüßt, Gevatterin, wohin gehst du?« - »Sei selbst auch gegrüßt! Wohin ich gehe? Ich lebte bei einer Frau, die Frau sammelte Milch, füllte einen ganzen Topf, ich Ärmste stieß ihn um, und nun gehe ich zur Beichte.« - »Ah, zur Beichte! Dann laß mich auch mitgehen!« - »Was hast du denn verbrochen?« - »Ich räumte im Hafer eines Wirtes auf; ein Hahn kann da jetzt dem anderen zu jodeln!« - »In diesem Falle komm nur mit!«
Sie gingen und gingen, da begegnete ihnen der Fuchs: »Seid gegrüßt, Katze und Hase, wohin eilt ihr?« - »Zur Beichte eilen wir!« - »Wirklich zur Beichte! Was bedrückt denn euch das Herz?« - »Ich stieß meiner Hausfrau die Milch um!« - »Ich fraß einem Wirt den Hafer weg.« - »Oh, Gevatterchen, laßt mich auch mitgehen! Mein Herz ist mir auch schwer, ich traf auf eine große Herde Gänse und biß allen den Hals durch!« - »Komm nur mit!«
Da gingen sie nun zu dreien, sie gingen und gingen; da kam ihnen der Wolf entgegen: »Wünsche einen guten Tag, Gevatterchen, wohin geht ihr so zu dreien?« - »Wir gehen zur Beichte, haben viel verbrochen -; ich stieß meiner Hausfrau die Milch um -; ich fraß einem Wirt den Hafer weg -; ich biß Gänsen den Hals durch.« - »Dann laßt mich auch mitgehen; es war eine prächtige Kuh, die riß ich nieder.«
Sie gingen nun zu vieren, da kam ihnen der Bär entgegen; der wollte auch mit: »Es war ein herrlicher Hengst, dem habe ich den Garaus gemacht.« Da gingen sie nun alle und kamen zu einem großen tiefen Grabe, und über das Grab hinweg lag eine Stange. Die Katze sagte: »Wer auf der Stange über das Grab kommt, der hat seine Sünden gut gemacht.«
Die Katze machte selbst den Anfang und war hinüber wie der Wind. Der Hase ihr nach, fiel aber in das Grab. Dann schritt der Fuchs hinüber: bis zur Hälfte kam er, da glitt er hinein. Der Wolf kletterte auf die Stange: er schlug mal mit dem Schwanz, da lag er schon drin. Der Bär versuchte auch sein Glück, doch hatte er kaum die Vordertatzen auf der Stange, da war er schon auf die anderen gefallen mit samt der Stange.
So lebten sie nun einige Zeit im Grabe, da fing der Hunger an, sie zu plagen. Was nun beginnen? Der Fuchs half aus der Verlegenheit: »Wir wollen singen! Wer die leiseste Stimme hat, den fressen wir auf.« Prächtig! Sie fingen an zu singen: der Bär brüllte so auf, daß der Sand von den Wänden rieselte, der Wolf heulte, daß die anderen taub wurden; was konnte neben ihnen der Hase mit seinem Gepiepse! Der Hase wurde verspeist. Der Fuchs hatte überhaupt den Mund nicht aufgetan, er hörte zu und gab das Urteil ab, wie die Stimmen der anderen geklungen hatten.
Mit dieser Nahrung lebten sie einige Tage, da stellte sich wieder das alte Übel ein: der Hunger. Sie fingen wiederum an zu singen. Der Bär brummte wohl so, daß der Boden erzitterte, doch die Stimme des Wolfes ist schriller: der Bär wurde verspeist. Der Fuchs, das schlaue Tier, fraß, soviel er nur konnte, außerdem stopfte er noch von des Bären Eingeweide unter seinen Sitz.
So lebten sie wiederum einige Tage, da fing der Wolf an zu jammern: »Füchschen, Gevatterchen, der Magen knurrt, ich möchte was zum Fressen!« - »Wie soll ich dir helfen, ich selbst fresse schon meine eigenen Eingeweide!« Mit diesen Worten holte er unter seinem Sitz des Bären Darm heraus und verspeiste ein Stückchen.
»Füchschen, Brüderchen, laß mich auch davon schmecken!« - »Meinetwegen, Onkelchen, ich geb dir vom eigenen Körper, das wirst du mir nicht vergessen!« Der Fuchs gab dem Wolf ein Endchen vom Darme, und jener verschlang es gierig - der Fuchs wollte nichts mehr geben und sagte: »Nimm von den deinigen!« - Der Wolf hatte an der Speise Geschmack gefunden; er fing an, die eigenen Gedärme herauszureißen, und endete auf der Stelle.
Der Fuchs blieb allein nach und verspeiste den Wolf; er saß und saß; wie lange aber willst du ohne Essen sitzen! Was nun anfangen? Da sah der Fuchs: ein Star hüpfte am Rande des Grabes; er fing an, dem Star zu drohen: »Hör einmal, Star! Sieh zu, daß du mich aus dem Grabe schaffst, sonst freß ich deine Jungen bis auf das letzte!« - »Aber wie soll ich dich heraus schaffen?« - »Hol Ästlein, wirf Reisig!« Der Star schleppte und schleppte, daß ihm die Augen quollen, bis das Grab gefüllt war und der Fuchs hinaus konnte.
»Hör du, Star, gib mir was zu fressen, sonst freß ich deine Jungen!« - »Wo soll ich was her nehmen?« - »Sieh, da geht eine Mutter mit ihrem Sohn zur Taufe, die tragt in einer Schale Kuchen. Flieg ihnen um den Kopf, immer um den Kopf, dann legt die Mutter den Kuchen nieder und geht eine Rute schneiden.« Der Star flog und flog, die Frau ging, eine Rute zu schneiden, um den Star zu jagen; unter dessen besorgte der Fuchs den Kuchen.
»Hör du, Star, schaff mir zu trinken, sonst freß ich deine Jungen!« - »Wie soll ich das anfangen?« - »Sieh, da fährt ein Mann zur Hochzeit, ein Faß Bier hat er auf dem Wagen; flieg um den Zapfen des Fasses, der Mann schlägt nach dir und schlägt zugleich den Zapfen heraus.« Der Star flog um den Zapfen, der Mann scheuchte ihn mit der Peitsche und schlug den Zapfen heraus: das Bier strömte im Bogen hervor wie nur je aus dem Spundloch; der Fuchs pumpte sich den Magen voll, nahm sich auch den Kopf voll.
»Hör du, Star, jetzt schaff mir, worüber ich lachen kann, sonst freß ich deine Jungen!« - »Aber wie soll ich das machen?« - »Sieh mal, da drischt ein Vater mit seinem Sohn; flattre um den Kopf des Vaters, nur immer um den Kopf des Vaters; der Sohn langt nach dir mit dem Dreschflegel, schlägt dabei dem Vater um die Ohren - dann hab ich zu lachen genug.« Der Star flatterte um den Kopf des Vaters, der Sohn wollte ihn vertreiben und versetzte dabei dem Vater einen gesalzenen Hieb: der Fuchs klatschte vor Freude mit den Tatzen und lachte so, daß ihm der Magen zitterte.
»Hör du, Star, jetzt sieh zu, daß ich springen kann!« - »Aber wie soll ich das machen?« - »Wir wollen aufs Gut! Da wart ich hinter dem Zaun, du gehst hinein und rufst: 'Laßt die Windhunde los, die Windhunde laßt los, der Fuchs ist hinter dem Zaun!' - dann kann ich springen, soviel das Herz nur begehrt.« Sie gingen beide aufs Gut, der Fuchs blieb hinter dem Zaun, der Star rief die Windhunde heraus. Die kamen alle mit Gesaus und Gebraus und fingen an, dem Fuchse nach zu jagen; sie jagten und jagten, doch ohne Erfolg - der Fuchs verschwand wie der Wind und rettete sich in seine Höhle.
In der Höhle fragte er seine Füße: »Was tatet ihr zu meiner Rettung?« - »Wir gruben, wir gruben, damit der Fuchs davon käme.« - »Aber ihr Hinterfüße, was tatet ihr?« - »Wir sprangen, wir sprangen, damit der Fuchs davon käme.« - »Aber ihr Augen?« - »Wir wiesen getreulich den Weg, damit der Fuchs davon käme.« - »Aber du, Nase, was tatest du?« - »Ich schnupperte, ich roch, damit der Fuchs in seine Höhle käme.« - »Aber ihr Ohren?« - »Wir hörten nur und hörten, woher Gefahr käme.« - »Nun, und du, Schwanz?« - »Ich schlug an die Bäume, ich zerrte am Gesträuch, damit man den Fuchs finge.« - »Aha, also das tatest du! Da hast du, Hund, friß den Schwanz auf!« Der Fuchs steckte den Schwanzbüschel aus der Höhle, da wartete auch gerade ein Hund, der schnappte zu, fraß den Schwanz und auch den Fuchs.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER REICHE DRISCHT ...
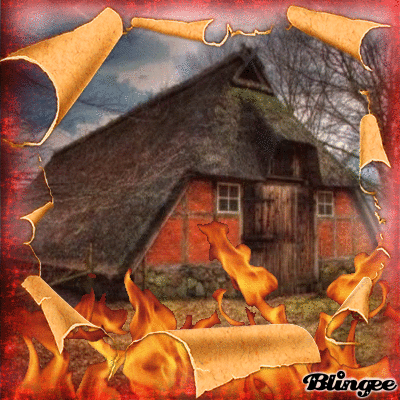
Als Jesus noch auf Erden wandelte, kam er eines Abends mit seinen Jüngern zu einem reichen Bauern und bat ihn um ein Nachtlager. Der Bauer gab ihnen aber keins, sondern sagte, er habe dafür keinen Raum.
Darauf ging Jesus zu einem armen Bauern, um ihn um ein Nachtlager zu bitten. Der Arme antwortete, ein Nachtlager möchte er ihnen wohl um Gottes willen gewähren, er könne aber dennoch keine Fremden beherbergen, weil er morgen dresche. Doch Jesus versprach ihm, mit seinen Jüngern beim Dreschen zu helfen. Unter dieser Bedingung erhielten sie denn auch das Nachtlager.
Als man am Morgen zu dreschen anfing, nahm Jesus einen Kienspan und steckte die trockenen Halme an. Die flammten sofort auf. Der Bauer erschrak bei diesem Anblick furchtbar. Jesus aber ging mit einem Stock ums Feuer herum und sprach: »Sachte, sachte, Laurits, geh nicht ins Lattenwerk!«
Das Feuer hörte das und brannte ruhig und ganz sachte. Als es am Verlöschen war, fand man hier die Körner und dort die Spreu. Der reiche Bauer hörte von diesem Dreschverfahren. Er versuchte es sofort nachzumachen. Sowie er aber die Halme angesteckt hatte, flammte das Feuer augenblicklich auf und wollte aufs Lattenwerk hinüberspringen. Wohl rief der Mann: »Sachte, sachte, Laurits, geh nicht in den Dachraum!« - das half aber gar nichts, das Feuer griff doch in den Dachraum hinein.
Schließlich schrie der Mann, indem er ums Feuer herum sprang: »Laurits, Teufel, was hast du im Dachraum zu suchen!« Aber dennoch brannte das Haus bis auf den Grund nieder.
Diesmal übernachtete Jesus dort in der Nähe. Ein Jünger ging hinaus und sah den Feuerschein. Er kam in die Stube und sprach: »Draußen sieht es böse aus!« Jesus drehte sich aber auf die andre Seite und sprach: »Das hat nichts zu bedeuten; da drischt bloß der Reiche!«
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER KLUGE RATGEBER ...

Einst machte ein Jüngling auf seinem Wanderweg an einem großen Stein Rast, um sich zu stärken, und als er satt war, streckte er die müden Glieder aus und lehnte den Kopf an den Stein. Im Schlaf suchten ihn komische Träume heim. Es war, als hätte an seinem Ohr eine tiefe, summende Stimme gesungen. Noch komischer aber war, daß diese Stimme auch dann weiter sang, als er schon erwacht war. Dem Jüngling schien, als käme die Stimme aus dem Stein oder unter diesem hervor. Er drückte das Ohr fest an den Stein und hörte nun deutlich, daß das Summen aus dem Stein kam.
Als er genauer hin hörte, vernahm er folgende Worte: »Glückskind! Rette mich aus meiner langen langweiligen Gefangenschaft! Siebenhundert Jahre schon muß ich durch einen Zauber hier schmachten, und auch der Tod erlöst mich nicht. Du bist bei Sonnenaufgang am Himmelfahrtstag zur Welt gekommen, und nur du allein kannst mich erlösen, wenn du den guten Willen hast, zu helfen!«
Der Jüngling erwiderte zweifelnd: »Ich weiß nicht, ob Kraft und Wille gleich stark sind. Erzähle mir zuerst, wie du ins Unglück geraten bist, und dann rate mir, wie ich dir helfen könnte.« Das verborgene Stimmchen sagte: »Schneide dort, wo sich drei Güter treffen, vom Vogelbeerbaum einen Zweig, einen Finger dick und eine Spanne lang, nimm ein paar Handvoll Bärlapp und Hexenkraut, zünde alles zusammen an und beräuchere den Stein neunmal im Kreis gegen Sonnenaufgang, so daß kein Fleckchen unberäuchert bleibt. Dann werden sich die Tore meines Kerkers öffnen, und ich werde mich wieder der Sonne und des Windes erfreuen können. Ich werde dir für deine Wohltat grenzenlos dankbar sein und dich zu einem großen Mann machen.«
Der Jüngling überlegte ein Weilchen und sagte dann: »Dem Nächsten in der Not zu helfen, ist eines jeden Menschen Pflicht. Ich weiß zwar noch nicht, ob du ein guter oder ein böser Geist bist, aber ich will dir in deiner Not helfen. Doch bevor ich es tue, mußt du mir schwören, daß keinem Menschen daraus Schaden erwächst.« Das verborgene Stimmchen gelobte dem Jüngling, all seine Wünsche zu erfüllen. Nun ging der Jüngling in den Wald, um das nötige Holz und die Kräuter für die Beräucherung zu suchen. Zum Glück kannte er die Stelle, wo sich drei Güter trafen und die nicht zu weit entfernt war. Es dauerte aber trotzdem bis zum Mittag des nächsten Tages, bis er alles Notwendige beisammen hatte. So war er erst gegen Abend wieder bei dem Stein zurück.
Eine ganze Weile nach Sonnenuntergang begann er, den Stein zu beräuchern, machte, wie geheißen, neun Kreise gegen Sonnenaufgang um den Stein und gab acht, daß auch nicht das kleinste Fleckchen unberäuchert blieb. Als er gerade die neunte Runde beendete, donnerte es plötzlich gewaltig. In diesem Augenblick hob sich der Stein aus der Erde. Aus der Grube des Steins sprang wie der Wind ein kleines Männlein hervor und lief davon wie vom Teufel geritten. Es war aber noch keine fünf Schritte weit, da fiel der Stein ins Loch zurück und überschüttete den Jüngling und das Männlein mit Schutt und Staub. Das Männlein lief zu dem Jüngling, fiel ihm um den Hals und hätte ihm sogar Hände und Füße geküßt, doch jener sträubte sich. Dann setzten sich beide neben den Stein ins Gras, und das gerettete Männlein erzählte, was ihm zugestoßen war.
»Vor langer, langer Zeit war ich ein berühmter Weiser, ich tat den Menschen viel Gutes und wurde dafür reichlich belohnt. Ich heilte Menschen und Tiere, wenn ihnen etwas zustieß. Ebenso vereitelte ich den bösen Hexen das Werk, das sie zum Schaden der Menschen betrieben. Deshalb haßten sie mich und fürchteten sich vor mir wie vorm Feuer, denn ich war ihnen in allem überlegen. So rieten sie hin und her, wie sie meiner mächtig werden könnten, doch ich war jedesmal schlauer und vereitelte somit alle ihre Vorhaben. Schließlich legten sie eine große Menge Geld zusammen und sandten es mit einem Boten ins Nordland, wo sie einen mächtigen Hexenmeister zu Hilfe riefen. Diesem Bösewicht gelang es, mich durch Gerissenheit zu fangen.
Heimlich entwendete er mir mein Werkzeug der Heilkunst und sperrte mich unter diesen Stein, wo ich so lange schmachten sollte, bis das Glück einen Mann herbei führe, der am Himmelfahrtstage bei Sonnenaufgang geboren war. Siebenhundert Jahre mußte ich hier warten, bis der glückliche Augenblick kam, daß du vorbei gingst, meine flehende Bitte zu Herzen nahmst und mich befreitest. Hab Dank, unendlich viel Dank für deine Güte! Ohne Entgelt werde ich dir dienen und dankbar sein, all meine Macht und Weisheit in deine Dienste stellen, bis ich dich so hoch erhoben habe, wie es für einen Sterblichen nur möglich ist.
Habe ich dieses Versprechen erfüllt, werde ich dich um Hilfe bitten, um meinem Feind alles Böse zu vergelten, sollte das Glück ihn mir zu Augen bringen. Bis zu diesem Tag werde ich mich vor den Blicken der Menschen verborgen halten, damit meine Feinde von meiner Befreiung nichts erfahren. Durch Zauberkraft vermag ich, jede beliebige Gestalt anzunehmen. So kann ich mich in einen Floh verwandeln und in deiner Hosentasche leben. Brauchst du jemals Hilfe oder Rat, werde ich hinter dein Ohr springen und sagen, was du zu tun hast. Wegen Speis und Trank brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich habe siebenhundert Jahre ohne einen Bissen unterm Stein verbracht, was sollte mir nun an frischer Luft und bei hellem Sonnenschein fehlen? Laß uns schlafen gehen, morgen früh machen wir uns auf den Weg, unser Glück zu versuchen.«
Als das Männlein nichts mehr sagte, verzehrte der Jüngling sein dürftiges Abendbrot und legte sich zur Ruhe. Als er am nächsten Morgen erwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmelszelt, vom gestrigen Gefährten aber fehlte jede Spur. Schlaftrunken wußte der Jüngling nicht, was er von all dem halten sollte. War das Geschehene Wirklichkeit, oder hatte er nur geträumt?
Als er nun gefrühstückt hatte und sich gerade auf den Weg machen wollte, sah er drei Wanderer des Weges kommen. Diese sahen wie Handwerker aus, und jeder hatte einen Ranzen auf dem Rücken. Plötzlich fühlte der Jüngling ein Kitzeln hinterm Ohr, und eine feine Stimme summte ihm wie eine Mücke zu: »Lade die Wanderer zur Rast ein, und versuche zu erfahren, wohin der Weg sie führt!« Nun erinnerte sich der Jüngling, daß der gestrige Gefährte ihm versprochen hatte, in seiner Hosentasche zu leben und sein Ratgeber zu sein. Also war das Geschehene Wirklichkeit und kein Traum.
Er trat den Wanderburschen entgegen und bat sie freundlich, am Stein Rast zu machen, und falls sie den gleichen Weg hätten, zu viert weiterzuziehen. Die Wanderburschen erzählten ihm nun, daß sich in der Königsstadt vor ein paar Tagen ein großes Unglück zugetragen habe, die einzige Tochter des Königs soll beim Baden im Fluß ertrunken sein. Und obwohl das Wasser an dieser Stelle gar nicht allzu tief gewesen war, konnte man den Leichnam nicht mehr finden, als hätte sich die Königstochter im Wasser aufgelöst.
Wieder verspürte der Jüngling das vertraute Kitzeln hinterm Ohr, und sein geheimer Ratgeber summte ihm zu: »Geh mit ihnen, du kannst dort dein Glück finden!« Der Jüngling folgte dem Rat und gesellte sich zu den anderen. Als sie schon ein gutes Stück des Weges gegangen waren, gelangten sie in einen dichten Kiefernwald. Da sahen sie am Wege einen alten Bastranzen liegen. Der Ohrkitzler sprach: »Heb den alten Bastranzen auf, er wird euch von Nutzen sein!« Obwohl der Jüngling ihm nicht recht Glauben schenken wollte, hob er den Ranzen dennoch auf, hing ihn sich über und sagte schmunzelnd: »Der Mensch soll nicht verschmähen, was er zufallig am Wege findet. Wer weiß, wo dieser alte Ranzen uns zugute kommt.« Die Gefährten lachten darauf und erwiderten: »Von uns aus nimm ihn mit, der leere Ranzen wird deiner Schulter nicht schwer fallen.« .
Aber schon nach einigen Stunden sollten sie die geheimen Kräfte des Ranzens kennen lernen und sich beim Jüngling bedanken, das verschmähte Ding aufgehoben zu haben. Die brennende Mittagssonne trieb den Männern den Schweiß aus den Poren. Sie setzten sich unter einen schattigen Baum zur Rast und gedachten gerade, sich mit ihrer kargen Wegzehrung zu stärken, als der Ohrkitzler seinem Herrn ins Ohr summte: »Befiehl dem Ranzen, die Mahlzeit zu besorgen!« Der Jüngling dachte: >Will er mich auch zum besten haben, warum sollte ich meinen Gefährten einen Streich spielen?< Aber er band den Ranzen ab, legte ihn vor sich aufs Gras, klopfte mit dem Wanderstab darauf und rief: »Ranzen, Ranzen, schaffe uns eine Mahlzeit herbei!«
Hat man je auf der Welt gesehen oder gehört, was jetzt geschah! Die im Scherz gesprochenen Worte wurden wahr. An Stelle des Ranzens stand vor ihnen ein kleines weiß gedecktes Tischlein voller Schüsseln mit allerlei Speisen und vier Löffeln daneben. Und was für leckere Sachen es dort gab! Eine Kraftbrühe aus frischem Fleisch, Schweinebraten, Würstchen und Kuchen aus feinstem Mehl, für den Durst aber Flaschenbier, Schnaps und Honigwein. Die Männer machten sich darüber her, ohne gebeten zu werden, als säßen sie am Hochzeitstisch, denn noch nie im Leben hatten sie eine solche leckere Festspeise zu Munde bekommen. Als sie alle satt waren, verschwand das Tischlein ebenso plötzlich wie es erschienen war, und anstelle dessen lag wieder der alte Ranzen da.
Hatten die drei Gefährten sich anfangs über den Ranzenträger lustig gemacht, so wollte nun ein jeder den Ranzen selbst tragen, und schließlich drohte deshalb sogar ein Streit auszubrechen. Der Finder des Ranzens sagte aber: »Ich habe den alten Ranzen aufgehoben, also glaube ich mit Recht, er gehört mir.« Das konnten die anderen nicht bestreiten, und so mußten sie denn den Ranzen dem Finder überlassen. Doch wollten sie nun nicht mehr, daß der Ranzen so einfach auf dem Rücken getragen wird. Einer der Wanderer, ein gelernter Schneider, nahm Nadel und Faden aus seinem Ranzen und nähte für den alten, zerfetzten Ranzen aus einem Brotbeutel einen Überzug, in den sie den Nahrungsspender behutsam legten, damit er unterwegs nicht zufällig beschädigt würde.
Als die Männer sich nach dem Mittagsmahl ein paar Stunden ausgeruht hatten, machten sie sich eiligst wieder auf den Weg. Ein voller Bauch und ein von Hoffnung beschwingtes Herz sind auf Wanderwegen stets die heitersten Begleiter. Das war auch unseren Wandersleuten anzusehen, die singend und scherzend voran schritten. Am Abend richteten sie unter einem Busch ein Nachtlager, und der Ranzen sorgte wie am Mittag reichlich für Speis und Trank.
Als die Männer sich zur Ruhe legten, war die größte Sorge für sie, wie sie den Ranzen bewachen sollten, daß er nicht einem Bösewicht in die Hände fiel. Zuletzt beschlossen sie, daß alle vier ihren Kopf auf den Ranzen legen und die Beine in Richtung Norden und Süden, Osten und Westen strecken sollten. Der Finder des Ranzens band außerdem noch ein Ende seines Gürtels an den Ranzen und das andere an die linke Hand, so daß er jede Bewegung des Ranzens bemerkt hätte. Obwohl sie ihren Speisespender nicht besser hätten bewachen können, wurden die Männer durch unruhige Träume mehrmals aus dem Schlaf geschreckt, wobei es das erste war, nachzufühlen, ob sich ihr Schatz noch an Ort und Stelle befand.
Am Morgen, bevor sie aufbrachen, schaffte der Ranzen auf Befehl im Handumdrehen das Frühstück herbei. So wiederholte sich das Glück jeden Tag, bis sie nach einer Woche in die Königsstadt gelangten. Dort summte der Ohrkitzler seinem Retter ins Ohr, die Königstochter sei von einem bösen Wassermann entführt und in seine Höhle verschleppt worden, und er versprach, ihm den Weg zu weisen, wo die Jungfrau verborgen gehalten werde.
Zunächst aber riet er dem Jüngling, vor den König zu treten und zu versprechen, er wollte die ertrunkene Königstochter aus dem Wasser holen. Sollte ihm dabei etwas zustoßen und er nicht mit dem Leben zurück kehren, müßte der König sich verpflichten, die Hälfte der versprochenen Belohnung seinen Eltern zu schicken, die andere Hälfte aber unter den Armen der Stadt zu verteilen. Obwohl der König nicht die geringste Hoffnung hegte, nach so langer Zeit auf die Spur der verschollenen Tochter zu kommen, nahm er das Anerbieten des Jünglings voller Freude an und versprach, mit der Belohnung so zu verfahren, wie der Jüngling es wünschte.
Am folgenden Tage sollte der Jüngling sein Glück versuchen. Als sie das königliche Schloß verließen, summte der Ohrkitzler: »Fang dir heute Abend drei Krebse, sie werden dir den Weg weisen!« Der Jüngling tat, wie geheißen. Am nächsten Tag versammelten sich die Menschen in Scharen am Ufer, wo der Jüngling ins Wasser steigen sollte, um die verschwundene Königstochter zu suchen. Auch der König kam in Begleitung vieler würdiger Amtsträger, um dem Versuch des fremden Jünglings zuzusehen. Dann wurde die Kammerjungfer gerufen, die die Stelle zeigen sollte, wo die Königstochter in den Wogen verschwunden war, denn die Jungfer saß an diesem Tag am Ufer und sah mit eigenen Augen, wie sich die traurige Geschichte zugetragen hatte.
Es war gleich zu sehen, daß man an dieser Stelle unmöglich hätte ertrinken können. Das Wasser war keine drei Fuß tief, der Grund fest und die Strömung sehr schwach. Mehr als dreihundert Schritt Fluß abwärts fand man zwar eine sehr tiefe Stelle, aber wie konnte die Königstochter so weit abgekommen sein? Mit rechten Dingen konnte es hier nicht zugehen. Der Ratgeber summte dem Jüngling ins Ohr: »Setze heimlich einen Krebs ins Wasser, und paß auf, welche Richtung er einschlägt!«
Der Jüngling tat augenblicklich, wie ihm geheißen. Er steckte eine Hand ins Wasser, als messe er die Tiefe des Wassers, und setzte dabei einen Krebs hinein, so daß niemand es sah. Der Krebs schwamm etwa zwanzig Schritt Strom abwärts, drehte dann plötzlich nach links und verschwand unter dem Ufer. Der zweite und der dritte Krebs folgten dem Beispiel des ersten. Nun summte der Ratgeber dem Jüngling ins Ohr: »Den Weg kennen wir jetzt, es ist auch unser Weg. Stampfe dreimal mit dem Absatz aufs Ufer und springe dann kopfüber ins Wasser. Wir werden den rechten Weg schon finden!« Der Jüngling tat, wie befohlen, stampfte dreimal auf und sprang kopfüber ins Wasser, daß es nur so schäumte. Das Volk am Ufer harrte still der Dinge, die nun folgen sollten.
Unter dem Ufer fand der Jüngling eine Öffnung zu einer Höhle, in die ein Mensch bequem hinein paßte. »Kriech hinein!« rief der Ratgeber. Als der Jüngling eine Weile mit Mühe voran gekrochen war, wurde der dunkle Gang plötzlich so breit, daß er aufrecht weitergehen konnte. Der Ratgeber riet ihm, mutig voran zu schreiten. Eine Weile später fiel ein Lichtschimmer auf den dunklen Weg, und bald umgab den Jüngling wieder helles Licht. Vor ihm öffnete sich eine weite grüne Wiese, und etwas weiter stand ein großes Wohnhaus aus blauem Stein.
»Merke dir nun gut, was ich dir sage«, sprach der Ratgeber, »und führe alles genau so aus, sonst wirst du die Königstochter nie aus ihrer Gefangenschaft befreien. Die Königstochter lebt dort im blauen Haus des Wassermanns. Zwei Bären bewachen Tag und Nacht das Tor, so daß kein Lebewesen hinein noch hinaus kann. Du mußt sie versöhnen. Nimm deinen Ranzen, und befiehl ihm, sich in einen Bienenstock zu verwandeln, wenn wir bei dem Tor sind. Wirf ihn den Bären zu, und schleiche dich hinter ihren Rücken ins Haus. Dort werden wir weitersehen.«
Als der Jüngling zum Tor gelangte, hörte er das Brummen der Bären und erschrak. Als er aber die Tiere selbst durch einen Spalt des Tores erblickte, rutschte ihm das Herz vollends in die Hosentasche. Dennoch warf er den Ranzen ab und befahl ihm, sich in einen Bienenstock zu verwandeln. Im Handumdrehen stand ein Bienenstock vor ihm, aber so schwer, daß er ihn nicht zu bewegen vermochte. Doch die Bären hatten den Honig gewittert, sie stießen das Tor auf und machten sich über den Bienenstock her, ohne sich um den Jüngling zu kümmern. Dieser eilte hinter ihren Rücken auf den Hof und geradewegs zur Haustür, die zum Glück nicht verschlossen war. Der Ratgeber summte:
»Die rechte Kammertür hat einen goldenen Schlüssel, schließe damit die Tür ab und stecke den Schlüssel ein, dann kann der alte Wassermann nicht mehr heraus. In der linken Kammer mit dem silbernen Schlüssel schmachtet die Königstochter, die du befreien mußt.« Als der Jüngling mit dem goldenen Schlüssel die Tür abgeschlossen hatte, hörte er aus der Kammer ein so fürchterliches Gejaule, daß die Wände wackelten. Er steckte den Schlüssel in die Tasche und eilte zur Tür mit dem silbernen Schlüssel. Als er die Tür öffnete, sah er die Königstochter auf dem Bettrand sitzen und bitterlich weinen. Als sie den fremden Jüngling erblickte, erschrak sie heftig, aber als er ihr erzählte, daß er gekommen sei, um sie zu befreien, lief sie ihm voller Freude entgegen.
Der Jüngling sagte zu ihr: »Wir dürfen nicht länger hier bleiben, wir müssen fliehen, bevor die Bären den Bienenstock leer gemacht haben!« Dann faßte er die Königstochter bei der Hand und zog sie mit sich vor die Tür des Hauses. Die Bären waren so mit dem Bienenstock beschäftigt, daß sie ihr Kommen überhaupt nicht bemerkten. Auf Zehenspitzen schlichen sich die beiden zum Hoftor hinaus. Der Jüngling schloß das Tor von außen ab, so daß die Bären nicht mehr heraus kommen konnten, und sie machten sich flugs auf den Weg.
Der Ratgeber aber summte an seinem Ohr: »Ruf den Ranzen zurück!« Der Jüngling rief: »Ranzen, mein Ranzen, komm heim!« Augenblicks hatte er den Ranzen wieder auf dem Rücken. Als sie zur dunklen und engen Stelle des Weges gelangten, sagte der Jüngling zur Königstochter: »Fürchtet Euch nicht vor der Dunkelheit und der Enge, gleich sind wir da. Im Wasser drückt die Augen zu, bis ich Euch ans Ufer getragen habe.« Nun war der Gang aber viel breiter als beim Hereinkommen, so daß beide ungehindert voran kamen. Im Wasser des Flusses nahm er die Königstochter auf die Arme und trug sie ans Ufer.
Die meisten der Schaulustigen waren schon nach Hause gegangen, denn sie dachten, den Jüngling nie wieder zu sehen. Der König aber saß mit seinem Gefolge noch am Ufer und sprach über das unglückliche Ereignis, als im Wasser plötzlich zwei Köpfe auftauchten. Wer könnte die Freude des Königs beschreiben, als er die für tot gehaltene Tochter quicklebendig vorfand. Der König fiel mal der Tochter, mal ihrem Retter um den Hals und vergoß Freudentränen. Ebenso weinten alle Menschen, die noch da waren, vor Freude. Als die freudige Nachricht aber mit Windeseile in die Stadt gelangte, strömte das Volk in Scharen herbei, um das Wunder selbst zu sehen.
Auf Befehl des Königs mußte der Retter seiner Tochter mit aufs Schloß kommen, wo ihm die königliche Belohnung ausgezahlt wurde, dreimal mehr, als man ihm versprochen hatte. Am Abend, als der Jüngling sich im prächtigen Bett zur Ruhe legen wollte, summte der Ratgeber an seinem Ohr: »Du darfst nicht länger als ein paar Tage hier bleiben, dann müssen wir weiter ziehen, denn nun bist du auf einmal sehr reich geworden. Ich glaube, der König würde mit der Zeit aus dir seinen Schwiegersohn machen, aber das wäre nicht gut. Du bist noch zu jung und unerfahren, es wäre nichts für dich, so hoch in Ehren zu stehen. Laß uns lieber in die weite Welt ziehen, bis du älter und erfahrener wirst!«
Obwohl dieser Rat dem Jüngling nicht besonders gefiel, beschloß er, auch jetzt nach seinem Rat zu handeln. Der König und die Königstochter baten zwar, er möge etwas länger ihr Gast sein, doch er durfte ihnen nicht nachgeben, denn das Männchen hatte ihm anders geraten. Als reicher Mann hätte er nun nicht mehr zu Fuß laufen müssen, sondern hätte in einer schönen Kutsche fahren können, da er aber keine Eile hatte und der Ranzen täglich für Speis und Trank sorgte, wanderte er wie gewohnt mehr zu Fuß als zu Pferde.
Eines Tages, als ihm gerade die Beine müde geworden waren, wurde er wieder hinterm Ohr gekitzelt, und das bekannte Stimmchen summte: »Du wirst verfolgt, und man will dir den Ranzen rauben, denn deine ehemaligen Gefährten haben in der Stadt über den wunderlichen Ranzen geplaudert, und alle möchten ihn nun in ihren Besitz bringen. Such dir eine Keule aus hartem Eichenholz, so lang, daß sie gerade in den Ranzen paßt. An einem Ende mach ihr ein Loch und gieß Blei hinein, dann wirst du einen wackeren Helfer haben, der dich vor deinen Feinden schützt.« Der Jüngling befolgte den Rat noch am selben Tage. Er schnitzte sich eine schwere Keule und steckte sie in den Ranzen.
Am nächsten Vormittag, als der Jüngling gerade durch einen dichten Wald ging, sprangen zehn Mann aus dem Dickicht und wollten ihn berauben. Der Ohrkitzler summte an seinem Ohr: »Hol die Keule aus dem Ranzen!« Der Jüngling holte die Keule hervor, und sieh, welch Wunder! Plötzlich war die Keule wie lebendig. Sie sprang den Räubern auf den Buckel und gerbte ihnen tüchtig das Fell, daß sie mehrere Tage lang lagen, ehe sie wieder laufen konnten.
An einem schönen Sommerabend gelangte der Wandersmann in ein großes Dorf, wo die Jugend sich auf dem Dorfplatz gerade lustig vergnügte. Die einen schaukelten Lieder singend auf der Dorfschaukel, andere schwangen nach der Musik der Ziehharmonika das Tanzbein. Plötzlich spürte der Wandersmann, der dem lustigen Treiben zusah, wie es hinter seinem Ohr kitzelte und summte: »Zu einer glücklichen Stunde sind wir her gekommen, denn auch mein Feind vergnügt sich hier. Wenn es uns gelingt, wie ich es mir gedacht habe, und wenn du genügend geschickt bist, werden wir ihn heute erwischen, und ich werde ihm das heimzahlen, was er verdient hat.
Schau dir genau die Mädchen an, du findest dort eine, die an Stelle von Perlen ein fingerdickes Band um den Hals trägt. Versuche, mit dem Mädchen zu tanzen, und wenn ihr euch am schnellsten dreht, mußt du nach dem bunten Halsband greifen und es zerreißen, auch wenn du das Mädchen dabei erwürgst! Sie ist zäh wie eine Katze, ein wenig drücken schadet ihr gar nichts!« Der Jüngling begab sich sofort auf die Tanzfläche, wo er aber eine Zeit lang suchen mußte, bis er unter den anderen das Mädchen mit dem bunten Halsband fand, dem die Burschen wegen ihrer Schönheit und ihres bauschigen Lockenkopfes wenig Ruhe gönnten.
Sobald unser Jüngling den rechten Augenblick fand, da das Mädchen gerade nicht im Arm eines anderen Burschen war, forderte er es zum Tanz auf. Mitten im größten Schwung griff er mit der rechten Hand nach dem bunten Halsband und zerriß es, daß die Stücke in alle Winde flogen. Ein herzzerreißendes, fürchterliches Wehgeheul — und das Mädchen war verschwunden! Die jungen Leute ringsumher erschraken fürchterlich über das Gebrüll.
Dann sahen sie ein graues Männlein mit einem langen Bart, das flink dem dichten Walde zu lief, und einen anderen, der sich ihm auf den Fersen hielt, so daß der erstere nicht entkommen konnte. Die Entfernung und die Abenddämmerung brachten die beiden den Zurückgebliebenen bald aus den Augen, deshalb setzte das junge Volk allmählich sein Vergnügen wieder fort, als wäre nichts geschehen. Unser Jüngling sah dem lustigen Treiben noch eine gute Weile zu und machte sich dann auf, um für sich ein stilles Fleckchen zu suchen, wo er übernachten könnte.
Er war noch nicht weit aus dem Dorf, als er hinter sich jemanden mit schnellen Schritten kommen hörte. Er schaute sich um und sah, daß ein fremder Mann ihm folgte. »Warte, Brüderchen!« rief der Fremde. »Laß uns gemeinsam gehen! Oder erkennst du mich nicht? Ich bin wieder groß und stark geworden und fremd für dein Auge, doch bin ich wie vorher dein Schuldner, weil du mich aus siebenhundert jähriger Gefangenschaft erlöstest und heute meinen ärgsten Feind in meine Gewalt brachtest, so daß ich nicht mehr in deiner Hosentasche leben muß.«
Nun erzählte er dem Jüngling, wie er seinen Feind im Walde gefesselt habe, der ja nicht mehr entwischen konnte, denn mit dem zerrissenen Zauberhalsband, das nichts weiter als eine lebendige Schlange gewesen, war auch all seine Zauberkraft hin. Dem Feind aber sollte noch ein paar Tage lang mit einem Knüppel das Fell gegerbt werden, damit er den Ort angebe, wo er vor siebenhundert Jahren die drei Königstöchter und einen unermeßlichen Schatz verborgen hatte. »Finden wir den Schatz und die Königstöchter, bist du ein reicher und glücklicher Mann, wenn du es vermagst, die Königstöchter aus ihrem Zauberschlaf zu wecken.« Nach diesem langen Bericht stärkten sich beide aus dem Ranzen und legten sich danach zur Ruhe.
Am nächsten Morgen gingen sie in den Wald, um nach dem gefangenen Zauberer zu sehen. Da stand das arme Männlein, Hände und Beine mit einem starken Strick gefesselt und ein Querholz hinter den Knien, daß es wie ein zusammengerollter Igel aussah. Der weise Mann sprach: »Knüppel aus dem Ranzen!« Da sprang der Knüppel dem gefesselten Zauberer auf den Buckel und schlug drauflos, als wollte er ihm alle Glieder brechen. Der Zauberer flehte um Gnade und versprach, alles zu gestehen. Als man ihn aber nach den Königstöchtern und dem Schatz fragte, sagte er, er habe den Ort nach so langer Zeit vergessen.
Wieder wurde der Knüppel aus dem Ranzen gelassen. Da der Zauberer nun alle Hoffnung auf ein Entkommen verlor, gestand er schließlich, wo die Königstöchter und der Schatz zu finden wären. Der Weise sagte: »Du wirst mein Gefangener sein, bis wir alles gefunden haben. Du kannst aber nicht hierbleiben, wo dich zufällig ein Mensch finden könnte und aus Mitleid deine Bande lösen würde.« Mit diesen Worten hob er sich das Männlein wie ein Knäuel auf die Schulter und trug es an den Rand eines tiefen Abgrundes, wo er es hinab schleuderte, daß seine Knochen krachten. »Warte hier«, lachte der Weise, »bis wir wieder da sind!«
Dem Jüngling erklärte der Weise, daß sie zum gewünschten Ort nur durch Zauberkraft gelangten, weil es sonst zu weit wäre, und der Ranzen würde ihnen als Fuhrwerk dienen. Auf seinen Befehl verwandelte sich der Ranzen in einen Schweinetrog, wo beide gerade so viel Platz hatten, daß sie bequem sitzen oder liegen konnten. An beiden Seiten hatte der Trog Flügel. Als beide Männer drin saßen, erhob sich der Trog bis zu den niedrigsten Wolken und flog in Richtung Süden. Auf Befehl des Weisen spendete der Trog den beiden jeden Tag Speis und Trank wie vorher der Ranzen, so daß es ihnen an nichts fehlte. Auch wurde ihr Schifflein nie müde und eilte Tag und Nacht unaufhaltsam weiter.
Nach einer Woche befahl der Weise dem Trog, daß er sie absetze. Sie waren zu einer unendlich großen heißen Wüste gelangt, wo nichts weiter zu sehen war, als einige Ruinen von alten Wohnstätten. Der Weise verwandelte den Trog nun wieder in den Ranzen und gab ihn seinem Gefährten zu tragen, wobei er sagte: »Du hast noch einen Weg von einigen Tagen vor dir, ich darf dich aber nicht weiter begleiten.« Dann scharrte er unter einem Mauerrest den Sand beiseite, und alsbald kam dort eine Luke zum Vorschein. Als er die Luke anhob, öffnete sich ihnen eine Treppe. Dann fing der Weise eine große Fliege und steckte sie in ein kleines Schächtelchen. Dem Jüngling aber sagte er: »Wirst du gefragt, wer diese oder jene Königstochter sei, dann laß die Fliege los und paß auf, wo sie hinfliegt. Die Fliege wird dir die Jungfrau zeigen, nach der man dich gefragt hat.«
Danach machte sich der Jüngling auf den Weg, mochte es nun Glück oder Unglück bringen. Wie ihm schien, war er dann schon länger als eine Zeit zwischen zwei Mahlzeiten die dunkle Treppe hinab gestiegen, als er Müdigkeit in den Beinen und Hunger im Magen verspürte. Er setzte sich auf eine der Treppenstufen nieder, stärkte sich mit Speis und Trank, ruhte ein wenig und stieg dann weiter in die Tiefe. Nach einer Weile erfaßte sein Auge einen Lichtschimmer, und nach einer halben Stunde gelangte er in eine fremde Gegend, wo er ein stattliches Schloß erblickte. Munter schritt er darauf zu.
Am Tor kam ihm ein kleiner Alter mit grauem Haupt und Bart entgegen und sagte: »Komm, Brüderchen, versuche dein Heil! Kannst du mir sagen, welche die jüngste Tochter des Königs ist, so nimm ihre Hand, und die Schlafenden werden sogleich erwachen. Solltest du dich irren, fällst du in eben solchen Schlaf!«
Der Jüngling trat ein, holte heimlich das Schächtelchen hervor und folgte dem Alten, bis sie ins dritte Zimmer gelangten. Dort schliefen auf einem wunderschönen Seidenbett drei wunderschöne Jungfrauen, die sich aber alle drei so ähnlich sahen, daß man keinen Unterschied hätte machen können. Als der Jüngling sich die Mädchen eine Weile zögernd angeschaut hatte und weder ein noch aus wußte, ließ er die Fliege los. Sie flog im Zimmer hin und her und setzte sich schließlich auf die Stirn des mittleren Mädchens.
Der Jüngling trat näher, nahm die Hand der Jungfrau und sagte: »Das ist die jüngste Königstochter.« Im selben Augenblick erwachten die Königstöchter aus ihrem Schlaf, sie standen auf, und die jüngste Schwester fiel ihrem Retter um den Hals und sagte: »Sei willkommen, liebster Bräutigam, der du uns aus unserem langen Zauberschlaf erlöst hast. Jetzt aber laßt uns heim eilen.«
Auf dem Rückweg konnte der Jüngling nicht mehr die Treppe finden, als sie sich aber eine Weile durch den finsteren Gang getastet hatten, umgab sie plötzlich heller Sonnenschein. An Stelle der Wüste sahen sie grünende Gärten und Wiesen voller Blumen und an Stelle der alten Mauerreste ein stolzes Schloß, umgeben von einer großen Stadt.
Der Weise kam ihnen auf halbem Wege entgegen, nahm den Jüngling bei der Hand und führte ihn ein wenig abseits, an einen kleinen Teich mit klarem Wasser und Büschen am Ufer. »Schau in den Wasserspiegel!« befahl der Weise. Der Jüngling tat, wie geheißen, doch schien ihm, daß seine Augen ihn täuschten. Wohl hatte sein Antlitz sich nicht verändert, nur die prächtigen königlichen Kleider aus Samt und Gold kamen ihm recht fremd vor.
»Wo kommen die prächtigen Kleider her?« fragte der Jüngling. Der Weise erwiderte: »Das war der letzte Dienst, den dir der Ranzen erwiesen hat. Weiterhin brauchst du seine und meine Hilfe nicht mehr, denn in ein paar Tagen wirst du Schwiegersohn des Königs sein und späterhin selbst König werden, wenn der alte König seine müden Augen geschlossen hat. Damit hoffe ich, dir meine Schuld abgetragen zu haben.« — »Mehr als tausendfach!« rief der Jüngling freudig, und sie nahmen voneinander Abschied.
Nach einigen Tagen wurde die Hochzeit der jüngsten Tochter des Königs und des Jünglings gefeiert. Und als nach einem Jahr der alte König für immer die Augen schloß, wurde der Jüngling zum König ernannt, der wohl heute noch regiert, wenn er nicht gestorben ist.
Quelle: Estland
DER HAUSGEIST ...
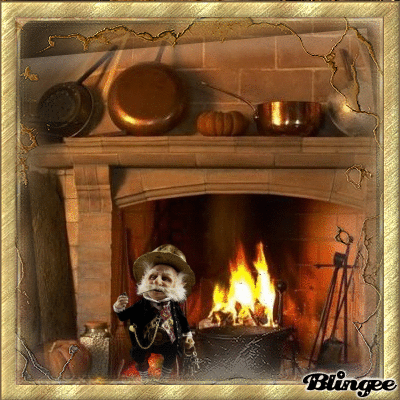
Ein Gutsherr hieß seinen Koch ein leckeres Gericht zubereiten. Da ward denn gleich ein großer Kessel aufs Feuer gesetzt, der sott allerlei Lammfleisch. Vor dem Kessel saß der Koch und schürte das Feuer.
Plötzlich kam unter dem Ofen aus dem Boden ein kleines Männchen hervor und bat den Koch: »Lieber Freund, laß mich ein wenig von der schönen Speise kosten! Ich bin so hungrig, und es ist mir so flau zumut wie einem Fischer!« »Darf's nicht tun«, versetzte der Koch, »wir haben selbst ein großes Hausgesinde!« »Gib mir nur ein Tröpfchen von der Suppe!« bat der Kleine von neuem. »Nun, so nimm!« sagte der Koch und reichte ihm den gefüllten Schöpflöffel hin.
Kaum aber war der Löffel in des Kleinen Hand, so hatte er im Augenblick den ganzen Kessel leer gegessen und war unter dem Ofen verschwunden. Der Koch erschrak. Was sollte er jetzt beginnen? Ging also der Ärmste hin zu seinem Herrn und erzählte ihm unter Jammern und Klagen den Hergang der Sache. Der Herr wollte seiner Rede anfangs keinen Glauben schenken, als aber der Koch bei Leib und Leben die Sache beschwor, ließ der Herr seinen Ärger fahren und befahl dem Koch, den Kessel von neuem aufzusetzen, fügte aber streng hinzu: »Sollte das kleine Männchen wiederkommen, so gib ihm mit dem Löffel tüchtig vor den Kopf!«
Der Koch machte sich ans Werk, und bald stand denn auch ein neues Festgericht auf dem Feuer. Wieder kam das Männchen unter dem Ofen hervor und bat den Koch, etwas von der Speise in das Säckchen zu füllen, das er am Halse trug. »Darf's nicht tun!« sagte der Koch. »Der Herr befahl mir, dich mit dem Löffel auf den Kopf zu schlagen!« »Schlag mich nicht, lieber Freund!« bat der kleine Mann. »Ich will dir auch beistehen, wenn du einmal in Not gerätst. Mein Weib daheim ist krank! Ich habe niemand, der mir ein Essen anrichtet oder Wasser herbei trägt. Laß mich nur einen Schöpflöffel voll Suppe in diesen Sack gießen, um die Arme etwas zu erquicken!«
Der Koch dachte bei sich: 'Er wird ja nicht so unverschämt sein wie vorhin, und wie viel wird denn sein krankes Weib aufessen können!' Er reichte also dem Männchen den Löffel hin. Im Augenblick war die ganze Suppe samt dem Fleisch in des kleinen Mannes Sack, er selbst aber verschwunden und der Kessel leer. Was nun? Der Koch klagte seine Not wieder seinem Herrn und jammerte noch lauter als das erste Mal, aber der Herr ward über die Maßen zornig, schalt ihn heftig und drohte, ihn sogleich aus dem Hause zu jagen, wenn er noch ein drittes Mal seines Amtes nicht besser zu walten wüßte. Den kleinen Mann aber solle er augenblicklich totschlagen, wenn er sich wieder in der Küche zeigen würde.
Abermals stand ein neuer Kessel auf dem Feuer, und abermals erschien das kleine Männchen. Der Koch ergriff den Schöpflöffel und rief: »Du Schelm, der Herr hat mir befohlen, dich auf der Stelle totzuschlagen!« Der Kleine bat: »Tu es nicht, lieber Freund! Wer weiß, ob dich nicht auch Mangel und Hunger dereinst erwarten! Dann will ich wiederum dir helfen, wenn ich es vermag. Mein kleines Kind daheim ist siech und mein krankes Weib gestorben; so habe ich jetzt gar niemanden, der mir Speise kochen oder einen Trunk herbei schaffen könnte. Gib mir doch für mein hilfloses Kind wenigstens einen halben Löffel Suppe!«
Dem Koch ward's wieder weich ums Herz, und wieder meinte der gute Mann: »Wieviel kann denn solch ein elendes Kind essen?« - »Da greif denn zu!« sagte er. Augenblicklich war aber der ganze Kessel wieder leer und der Kleine verschwunden. Jetzt hatte der Koch seinen Lohn zu erwarten. Mit zitternder Stimme meldete er seinem Herrn: »Der kleine Mann hat zum dritten Male die Suppe vom Feuer gestohlen!« »Fort mit dir, du Bösewicht«, schrie der Herr, »da du mir aber bisher treu gedient hast, will ich dir noch gestatten, über Nacht im Hause zu bleiben. Morgen früh aber schnür dein Bündel und troll dich fort!«
Darauf gab der Herr dem Fronvogt Befehl, die Suppe zu kochen, und sagte: »Wenn der Kleine sich abermals zeigen sollte, so schlag ihn auf der Stelle tot!« »Schon gut, Herr«, versetzte der Vogt, »ich will ihn tüchtig treffen!« Der Kessel kam wieder aufs Feuer, und da war auch schon der kleine Mann zur Stelle und bettelte um Suppe. »Also Suppe willst du Schelm?« schrie der Vogt und gab dem Kleinen mit dem Schöpflöffel einen solchen Schlag vor den Kopf, daß er wie ein Knäulchen zurück unter den Ofen rollte. Darauf wurde die Suppe fertig, und der Herr hatte seine Lust daran. »Jetzt wird der Kleine wohl nicht wiederkommen, um sich die Finger zu verbrennen!« sagte er.
Am nächsten Tage lud sich der Koch ein Säckchen mit seinen Sachen auf und schickte sich an, die Küche zu verlassen. Plötzlich stand der Kleine mit verbundenem Kopf vor ihm und sprach: »Komm, Freund, nimm auch von mir Abschied, ich will dir auch etwas auf den Weg mitgeben!« Der Koch folgte auch wirklich dem Männchen. Unter dem Ofen befand sich ein schönes, geräumiges Haus, wo allerlei seltsame Sachen und Geräte umher standen.
Der Kleine führte den Koch durch das erste Gemach in eine Kammer, blieb vor einem Bretterfach stehen und langte eine Schachtel herunter. »Hier, mein Freund«, sprach er zum Koch, »nimm den Lohn für deine Wohltat! Hast du irgend etwas nötig, so klopfe nur mit dem Zeigefinger auf den Deckel der Schachtel und nenne deinen Wunsch!« Der Koch bedankte sich für das Geschenk und kam wieder in die Küche zurück. Da stand auch gerade der Vogt in der Küche.
Der Koch zog sein Schächtelchen hervor, klopfte mit dem Zeigefinger auf den Deckel und sprach: »Einen Brotsack für den Wandersmann!« Augenblicklich war der Brotsack zur Stelle. So schaffte der Koch mit Hilfe des Schächtelchens noch viele andere Dinge herbei, und der Vogt konnte sich nicht genug darüber wundern. Endlich fragte er: »Sag doch, lieber Freund, wo hast du dies prächtige Schächtelchen her?« Der Koch teilte dem Vogt alles mit und ging dann seines Weges. 'Wenn es so steht', dachte der Vogt, 'so muß ich von dem kleinen Mann auch solch ein Schächtelchen haben. Den Backenschlag von gestern will ich schon wieder gut machen. Wart nur, der Kessel muß wieder aufs Feuer!'
Da stand nun der Vogt am Kessel, kochte und wartete, aber der Kleine zeigte sich nicht. Endlich rief der Vogt: »Freund, so komm doch zu Gast!« Sofort war der Kleine da. »Warum rufst du mich?« fragte er. »Ich habe vom Koch noch Speise in Hülle und Fülle zu Hause!« »So koste doch nur, es ist dir ja geschenkt!« sagte der Vogt. Der Kleine kostete von der Speise und sprach: »Schönen Dank! Aber komm jetzt mit mir, ich will dir alles vergelten!« »Was braucht's da vieler Vergeltung!« sagte der Vogt und folgte dem Kleinen mit Freuden. Jetzt erhielt auch der Vogt ein Schächtelchen, verließ aber den kleinen Mann ohne ein Wort des Dankes. Damit lief er zu seinem Herrn und bat ihn achtzugeben, was geschehen würde, wenn er mit dem Finger auf den Deckel klopfe.
Und so begann er zu klopfen. Da flog aus der Schachtel ein kleines Männchen mit einer Eisenkeule heraus, fiel über den Herrn und den Vogt her und hieb so lange auf sie ein, bis beide halbtot am Boden lagen. Dann verschwand er samt der Schachtel. Den Kleinen unter dem Ofen hat aber nachher niemand wiedergesehen.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DIE STIEFMUTTER ...
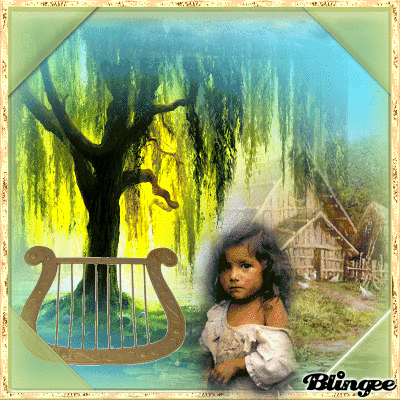
Einem Manne starb seine Frau. Zwei Kinder blieben übrig. Die Kinder waren noch klein, und deshalb nahm der Mann sich eine zweite Frau. Die ging aber mit den Kindern sehr hart um und gab ihnen mehr Prügel als Essen. Das Weib bekam schließlich auch selbst ein paar Kinder, und das machte das Leben der Waisen noch schlechter. Besonders schlimm ging es dem jüngeren Kinde, denn es konnte noch nicht arbeiten; deshalb war die schlechte Stiefmutter immer auf dieses Kind böse. Sie dachte immer nach, wie sie diese Brotesser klein kriegen könne.
Eines Tages war der Mann im Walde mit Holzfällen beschäftigt. Um diese Zeit kam der Teufel und half der Frau einen Rat finden. Der Frau kam ein schrecklicher Gedanke in den Sinn. Sie nahm das jüngere Kind, schlachtete es, schnitt es in Stücke und kochte es. Am Abend kam der Mann nach Hause. Die Frau gab dem Manne das Fleisch des Kindes zu essen. Der Mann aß es und lobte: »Wo hast du solch ein schönes, knuspriges Fleisch hergenommen?« Die Frau antwortete: »Ich habe ein kleines Ferkel geschlachtet.«
Der Mann aß sich satt, ohne auch nur zu ahnen, daß er seines eigenen Kindes Fleisch esse. Das ältere Kind wußte es wohl, wagte aber nicht, es dem Vater zu sagen, weil es die Drohungen der Stiefmutter fürchtete. Als das Essen zu Ende war, fragte der Mann nach dem Kinde. Die Frau antwortete: »Wer weiß, wo es wieder steckt?« und ging dann mit dem größten Eifer, das Kind zu suchen.
Nach dem Essen sammelte das ältere Kind die Knochen des jüngeren vom Tisch zusammen, umband sie mit einem Faden und vergrub sie unter einer Weide, die hinter dem Hause wuchs. Nach einiger Zeit begann an der Weide eine Harfe zu wachsen, und schließlich hörte man auch eine traurige Stimme, die aus der Harfe die Worte sang:
»Die Mutter hat mich umgebracht,
der Vater hat mich gegessen,
die Schwester sammelte meine Knochen,
sie umwand sie mit blauem Faden
und umflocht sie mit rotem Band.«
Diesen Gesang hörte der Vater des Kindes am häufigsten. Endlich fing man an, unter der Weide zu suchen, und fand die Kinderknochen. Nun kam es heraus, daß das Kind ermordet war, und die Mörderin erhielt natürlich ihre Strafe.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DIE DREI GENASFÜHRTEN FREIER ...

Es war einmal eine sehr reiche und schöne Witwe, deren Mann schon vor ein paar Jahren gestorben war. Zu ihr kamen viele Freier, die sie zur Ehefrau wünschten; sie wollte aber vom Heiraten überhaupt nichts mehr wissen. Da kamen nun einmal wieder drei junge Männer, die nacheinander ihre Werbung vorbrachten, die Witwe schickte sie jedoch ebenso heim wie die anderen.
Die Männer gaben sich aber damit noch nicht zufrieden, sondern begannen, der Frau mit weiteren Besuchen lästig zu fallen: ein jeder pries seinen Reichtum und seine Liebe zu ihr, so daß die Witwe ihrer endlich überdrüssig wurde und im stillen Rat hielt, wie sie die Zudringlichen wieder loswerden könne.
Endlich fand sie auch ein gutes Mittel: sie ließ die drei an einem bestimmten Abend einzeln zu sich kommen, einen jeden immer eine Stunde später als den anderen, aber so, daß sie davon einander nichts sagen durften und ihr Kommen geheimhalten mußten.
Am bestimmten Abend kam nun derjenige, der als erster zur Frau geladen war. Die Frau sprach zu ihm: »Wenn du mich wahrhaft liebst, so verbring eine Nacht wie ein Toter in der Stube im Sarge.« Der Mann war's zufrieden, ließ sich Totenkleider anlegen, ging hin und legte sich lang hingestreckt in den Sarg.
Nach kurzer Zeit kam der zweite Freier. Die Frau fragte ihn: »Wenn du mich wahrhaft liebst, willst du da eine Nacht in der Stube an dem Sarge eines Toten wachen?« Der Mann war's zufrieden und versprach, die Wache zu übernehmen. Die Frau legte ihm weiße Kleider um, band ihm zwei Gänseflügel an die Schultern, gab ihm eine brennende Laterne in die Hand und schickte ihn zum Sarge. - Der Mann, der im Sarge lag, schaute hin: »Wovor brauche ich mich nun noch zu fürchten, wenn ein Engel mich zu bewachen kommt?« - und war ganz ruhig.
Hierauf kam zur Witwe der dritte Freier, und sie fragte ihn ebenso wie die andern: »Wenn du mich liebst, willst du mir da eine Leiche aus der Stube tragen?« Der Mann war's zufrieden und sprach: »Und wenn der Teufel sie selbst bewacht, so will ich sie dir holen.« Die Frau schwärzte ihm mit Ruß das Gesicht, band ihm zwei Bockshörner auf den Kopf und schickte ihn in die Stube.
Als er dort eintrat, erschraken alle drei, sowohl er selbst als auch der Engel und der Tote. Endlich fragte der Teufel den Engel: »Was hast du hier zu tun? Heb dich fort von hier! Ich hab den Befehl, diesen Toten in die Hölle zu bringen.« - »Und ich habe den Befehl, diesen Toten zu bewachen«, erwiderte der andere.
Nun erhob sich ein Kampf, und der Teufel begann die Oberhand zu gewinnen. Als der Mann im Sarge sah, daß der Teufel der Stärkere war, da fürchtete er, bei lebendigem Leibe in die Hölle getragen zu werden, sprang entsetzt aus dem Sarg und rannte davon, was er konnte.
Als die Kämpfer sahen, daß der Tote lebendig wurde, erschraken sie so fürchterlich, daß sie an nichts anderes dachten, als ebenso Hals über Kopf davonzulaufen.
Die Witwe, die alles dies aus einem Versteck beobachtet hatte, lachte darüber bis zu Tränen. Seit der Zeit verloren aber die drei alle Heiratslust und ließen die Witwe in Ruh.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DIE DREI GUTEN WORTE ...

Es war einmal ein fauler, alter Mann. Seine Frau webte schöne Decken und schickte den Mann, sie zu verkaufen. Eine Werst von der Stadt kam ihm aus dem Walde ein fremder Mann entgegen und bat: »Peter, gib deine Decke mir.« Peter wollte sie nicht her geben, der andere aber bat: »Gib, gib, ich sage dir ein gutes Wort dafür.« Nun, Peter war auch damit zufrieden und gab die Decke ab; und der Fremde sagte ihm das gute Wort: »Wenn du den Arm auf hebst, so laß ihn nicht sinken!«
Der Fremde verschwand mit der Decke im Walde; Peter kehrte zu seiner Frau heim, die Frau aber begann ihn zu schelten. Brot hatten sie nicht, es war rein um des Hungers zu sterben! Sie besaßen nur noch dreißig Kopeken Geld. Die Frau schickte den alten Mann in die Stadt, um für dieses Geld Garn zu kaufen, damit sie eine neue Decke weben könne.
Wieder webte die Frau eine unbeschreiblich schöne Decke und schickte wieder ihren Mann, diese Decke zu verkaufen; selber hatte sie zwei bis drei Tage nichts gegessen. An derselben Stelle, wo der Mann die erste Decke weg gegeben hatte, kam ihm jetzt wieder der fremde Greis aus dem Walde entgegen und lockte ihm die Decke wieder für ein gutes Wort ab: »Du wirst ins Wasser fallen und nicht ertrinken.«
Als der Mann nach Hause kam, fing seine Frau wieder an zu zanken. Die Frau hatte nur noch fünf Kopeken Geld. Für dieses Geld ließ sie ihren Mann aus der Stadt Garn holen, webte wieder eine schöne Diamantendecke und schickte ihren Mann, diese zu verkaufen. An der alten Stelle - eine Werst von der Stadt - kam ihm aus dem Walde wieder der alte Mann nachgelaufen und rief: »Peter, gib die Decke mir!« Vor Schreck begann Peter vor dem alten Manne zu fliehen, aber dieser lief hinter ihm drein und bat immer wieder: »Peter, gib die Decke mir, gib sie - ich sage dir ein gutes Wort dafür!« So liefen sie nun beide. Peter wollte nicht und wollte nicht die Decke hergeben, aber gerade vor der Stadt gab er sie doch her und bekam für die Decke ein gutes Wort: »Wo eine Weide wächst, da gibt es keinen Wassermangel.«
Nun wagte Peter nicht mehr zu seiner Frau heimzukehren, sondern ging aufs Meer als Matrose. Da erhob sich aber auf dem Meere ein schauerlicher Sturm, und der Kapitän erklärte: »Es ist nötig, einen Mann ins Meer zu werfen.« Man warf das Los - und das Los traf Peter. Der Kapitän versprach, dem Peter die Hälfte der Schiffsladung zu schenken, wenn dieser nur erlaube, sich ins Meer werfen zu lassen. Da erinnerte sich Peter an das Wort des alten Mannes: »Du wirst ins Wasser fallen und nicht ertrinken.« Und Peter ließ sich ins Wasser werfen und ertrank auch wirklich nicht, sondern das Meer warf ihn ans Ufer.
Hier wartete Peter auf das Schiff. Und als der Kapitän mit seinem geretteten Schiffe im Hafen anlangte, da bekam er einen furchtbaren Schreck, denn Peter stand vor ihm auf dem Boulevard, den Kontrakt in der Hand. Nun, da bekam Peter also auch die Hälfte der Schiffsladung.
Dort in der Stadt war zu jener Zeit ein großer Wassermangel, und der König hatte drei Schiffsladungen Schätze dem jenigen versprochen, der die Stadt von dem Wassermangel befreie. Nun erinnerte sich Peter an das andere gute Wort, das er vom alten Manne gehört hatte: »Wo eine Weide wächst, da gibt es keinen Wassermangel.« Peter ging sofort zum König und versprach diesem, das Wasser zu verschaffen: er ging in den königlichen Garten, ließ eine Weide aus dem Boden graben - und sogleich sprudelte unter ihren Wurzeln eine Quelle hervor. Es gab Wasser in Hülle und Fülle, und die Stadt war von dem Wassermangel erlöst; und Peter erhielt die versprochenen Schätze.
Nun kehrte Peter heim. In der Zwischenzeit war sein Sohn zu einem großen Mann heran gewachsen und schlief gerade an der Seite seiner Mutter. Peter hielt ihn für einen Fremden und erhob schon sein Schwert, um ihn zu töten - da kam ihm das dritte Wort in den Sinn, das er vom alten Manne gehört hatte: »Wenn du den Arm aufhebst, so laß ihn nicht sinken!« Peter ließ das Schwert nicht nieder fallen. Da erwachte auch seine Frau, und alles klärte sich auf; sie versöhnten sich miteinander und lebten ein glückliches Leben. Das ist alles.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen - Livische Märchen
FLIEGE UND SPINNE ...
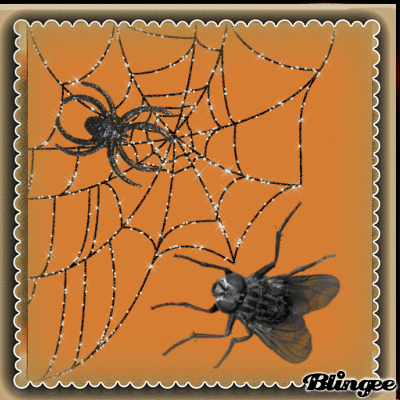
In alten Zeiten gab es auf Erden nur einen König; dem waren nicht nur die Menschen, sondern auch alle Tiere untertan. Damals hatte man noch kein Feuer und mußte nach Sonnenuntergang im Dunkeln weilen und frieren. Man wußte wohl, daß in den Tiefen der Hölle Feuer sei, aber niemand wagte es von dort zu holen. Da versprach der König, daß der, der ihm Feuer aus der Hölle schaffen würde, mit seinen Kindern und Kindeskindern für ewige Zeiten umsonst an allen Tischen sollte essen dürfen, und niemand dürfe es ihm wehren.
Nun versuchten es viele, das Feuer zu erlangen, fanden aber alle dabei ihren Tod. Zuletzt ließ sich die Spinne an ihrem Faden hinab, und es gelang ihr, einen Brand zu entwenden und wieder die Oberwelt zu erreichen. Dort schlief sie ermüdet ein. Die Fliege aber, die durch den Geruch aufmerksam gemacht war, stahl der Schläferin das Feuer, brachte es dem König und erhielt urkundlich den verheißenen Lohn.
Die Spinne suchte nach ihrem Erwachen umsonst das Feuer, niemand wollte ihr glauben, daß sie es aus der Hölle gebracht hatte, und auch der König wies sie ab, da sie ihre Behauptung nicht beweisen konnte. Zuletzt versammelte sie alle Spinnen und forderte sie, da mit ihr auch alle übrigen bestohlen und betrogen seien, zu gemeinsamer Rache an dem ganzen Fliegengeschlechte auf. Sie beschlossen Netze zu spinnen, alle Fliegen darin zu fangen und jeder, die sie erwischen würden, den Kopf abzubeißen. Das tun sie bis zum heutigen Tage, aber die Fliegen haben das Recht, an allen Herrentischen zu essen.
Estland: Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Volksmärchen
DIE KRÄHE UND DER FUCHS ...

Die Heumacher hatten auf der Wiese eine Heugabel aufrecht in den Boden gesteckt vergessen. Es kam der Frühling. Eine Krähe fand die Gabel und baute zwischen deren Zinken ihr Nest.
Der Fuchs sah es und dachte nach, wie er die Krähenjungen aus dem Nest herauskriegen könne. Er begann, der Krähe Furcht einzujagen: »Das ist meine Gabel. Gib mir ein Kind aus dem Neste heraus. Gibst du es nicht, so hau ich die Gabelstange nieder!«
Die Krähe gab aber das Kind nicht her. Da ging der Fuchs unters Nest und schlug mit dem Schwanz an die Gabelstange. Die Krähe sah das und dachte: 'Jetzt haut der Fuchs die Stange nieder und brennt sie mit Feuer!' Sie nahm ein Kind und warf es dem Fuchse hinunter. Auf diese Weise lockte ihr der Fuchs drei Kinder ab.
Endlich merkte die Krähe den Betrug und gab ihm keine Kinder mehr. Der Fuchs beschloß, die Krähe dafür umzubringen. Er legte sich in der Nähe des Krähennestes nieder und stellte sich tot. Auf solche Weise lag der Fuchs zwei Wochen lang an ein und der selben Stelle hingestreckt, so daß ihm auf der einen Seite schon die Haare ausgingen.
Jetzt erst kam die Krähe, um dem Fuchse die Augen auszuhacken. Da sprang der Fuchs vom Boden auf und zerriß die Krähe.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER HUND UND DIE KATZE ...
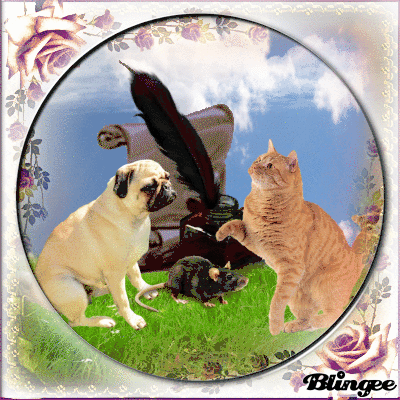
Der Hund und die Katze wollten dem Hausherrn nicht anders dienen als um Fleischkost. Der Hausherr war freilich zuerst dagegen, als er aber schließlich einsah, daß der Handel sonst nicht zustande kommen werde, gab er nach und unterzeichnete mit ihnen einen Kontrakt, worin er sich verpflichtete, dem Hunde und der Katze einmal täglich Fleisch zu geben.
Die Katze nahm den Kontrakt an sich, brachte ihn in den Dachraum und band ihn dort an einen Querbalken. Die Mäuse fanden den Kontrakt und zerknabberten ihn in lauter kleine Stückchen. Nachher, als der Hund und die Katze zum Hausherrn gingen, um von ihm das versprochene Fleisch zu verlangen, da wünschte er den Kontrakt einzusehen; weil aber weder der Hund noch die Katze ihn vorzeigen konnten, ließ sie der Hausherr das Fleisch nicht einmal riechen.
Schließlich entbrannte zwischen dem Hunde und der Katze ein Streit. Der Hund verlangte, die Katze solle den Kontrakt herbei schaffen, denn ohne das hatten sie auch nicht einen Mundvoll Fleisch zu erhoffen. Weil aber die Katze den Kontrakt auf keine Weise herbei schaffen konnte, so wurde seit jenem Tage der Hund zum schlimmsten Feinde der Katze.
Da nun die Katze trotz ihres Mutes dem Hunde nichts anhaben konnte, so begann sie die Mäuse zu verfolgen, weil sie den Kontrakt zerrissen hatten.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER GLÜCKLICHE UND DER UNGLÜCKLICHE ...
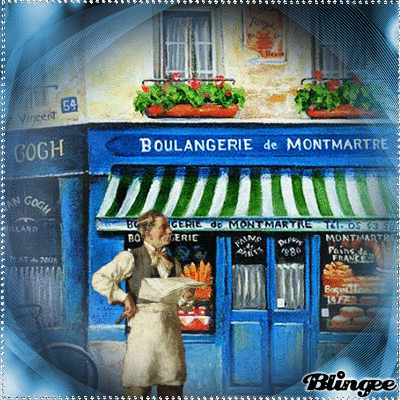
Es waren einmal zwei Bauern, die lebten nicht weit voneinander. Der eine war reich, der andre war arm. Der Arme war freilich auch ein fleißiger Arbeiter, aber dennoch wurde er nicht reicher, als er war.
Einmal ging er in der Nacht aufs Feld, um dort nach zu schauen, aber o Wunder - was sah er da! Er sah, wie ein Mann auf dem Felde des Reichen Roggen säte.
»Was tust du hier?« fragte der Arme.
»Ich säe Roggen!« war die Antwort.
»Nun, wann kommst du denn auf mein Feld säen?« fragte der arme Mann.
»Niemals!«
»Weshalb säst du denn auf dem Felde des anderen?«
»Ja, ich bin eben sein Glück.«
»Nun, wo ist denn mein Glück?« fragte der Arme.
»Dein Glück schläft dort neben jenem großen Stein«, sprach der Sämann.
Der Arme eilte zum Stein, um sein Glück zu wecken.
»Höre, Mann, steh auf und geh Roggen säen!«
»Ich gehe nicht«, antwortete der Schläfer.
»Ja, warum gehst du denn nicht?« fragte der Arme.
»Nun, ich bin doch eben kein Landwirtsglück.«
»Aber du bist doch mein Glück!«
»Ja, freilich«, sagte der Schläfer; »wähl dir nur ein anderes Handwerk, dann werde ich schon dein Glück sein.«
»Was soll ich denn werden?« fragte der Arme.
»Werde Kaufmann!«
Sogleich ging der Mann nach Hause, verkaufte sein Haus und eröffnete in der Stadt einen Laden. Nun bekam er sein Glück und lebt auch heute noch glücklich.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
GUT UND SCHLECHT ...

Zwei Männer unterhalten sich:
»Ist bei euch dieses Jahr der Kohl gut gewachsen?« -
»Jawohl! Die Kohlköpfe waren so groß wie breitkrempige Filzhüte.«
»Das war doch gut!«
»Wieso gut? Eine Ziege kam in den Garten und fraß alles ab.«
»Das war doch schlecht!«
»Wieso schlecht? Ich schlachtete die Ziege und bekam eine Bütte voll Fleisch.«
»Das war doch gut!«
»Wieso gut? Ich fing an, die Schinken zu räuchern, da brannte das Aas von Badstube nieder.«
»Das war doch schlecht!«
»Wieso schlecht? Ich baute mir eine neue Badstube auf.«
»Das war doch gut!«
»Ja, wieso gut? Als ich den letzten Balken legte, da blieb meine lumpige Frau mit dem Bauch darunter eingeklemmt stecken.«
»Das war doch schlecht!«
»Oh, wieso schlecht? Ich nahm mir eine neue Frau.«
»Das war doch gut!«
»Ja, wieso gut? Der verdammte Pfaff hat meine Frau verführt.«
»Das war doch schlecht!«
»Jawohl, schlecht war es und schlecht blieb es! Freilich habe ich den Pfaffen lahm geschlagen und einen Topf voll Geld bekommen, aber eine Frau hab ich nicht mehr!«
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DAS WERWOLFSFELL ...
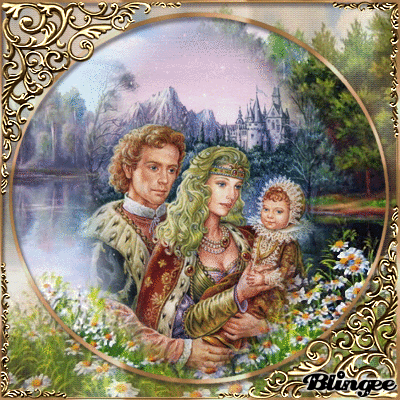
Es war einmal ein König, der hatte zwei Bräute. Die eine heiratete er, die andere ließ er sitzen. Aber dieses andere Mädchen, dem er einen solchen Kummer bereitet hatte, schwor ihm lebenslängliche Rache.
Der König hielt Hochzeit, und nach einem Jahr wurde ihm ein schöner Knabe geboren. Da bekam der König aber die Nachricht, daß er in den Krieg ziehen müsse. Seine kranke Gemahlin mit dem kleinen Sohne blieb zu Hause. Und zu jener Zeit, wo der König im Kriege war, suchte seine andere, verlassene Braut nach einer Gelegenheit zur Rache. Eine alte Zigeunerin lehrte sie neunmal unter den Wurzeln einer Kiefer durch zu kriechen, um sich in einen Werwolf zu verwandeln. Und jenes Mädchen ging hin, kroch neunmal unter den Wurzeln einer Kiefer durch und wurde zu einem Werwolf. Das auf solche Weise erlangte Werwolfsfell wollte sie der jungen Königin überwerfen, sie fand aber auf keine Weise Gelegenheit, bis zur Königin durchzudringen. Da ging sie zu einem Diener des Königs und bat um Arbeit. Der Diener meldete dies der Königin, und die Königin ließ sie anstellen, damit sie den Hof in Ordnung halte. Der Diener ließ das Mädchen sofort ihren Dienst antreten, und nun ging sie herum und lauerte der Königin auf.
Eines schönen Abends säugte die Königin am offenen Fenster ihr Kind - da warf das Dienstmädchen ihr durchs Fenster das Werwolfsfell über. Sogleich wurde die Königin zu einem Werwolf, legte das Kind nieder und schlich in den Wald. Jenes Mädchen stieg nun selbst zum Fenster hinein, nahm das Kind in seine Arme und begann es zu säugen. Sie hatte aber zum Säugen gar keine Milch, und das Kind schrie und weinte gar sehr. Doch ließ das Mädchen keinen Menschen zu sich heran.
Als nun der König nach Hause kam, da klagte man ihm, die Königin lasse niemand in ihre Nähe, wo das Kind doch so sehr schreie. Der König begriff nicht, was seinem guten Weibe so Böses zugestoßen sei; er ging selbst zu seiner Frau und begehrte Einlaß. Jemand tat die Tür auf und ließ den König ein. Die Frau lag platt auf dem Bett, und das Kind schrie ganz schrecklich. Die Frau hatte die Augen geschlossen, und als der König fragte, was ihr fehle, da winkte sie nur mit der Hand und sagte, sie sei sehr krank. Augenblicklich rief der König den Diener und sagte ihm, er solle rasch einen Arzt holen, und war noch über ihn böse, weil er nicht von selbst zur kranken Königin einen Arzt gerufen hatte.
Der Diener verteidigte sich, er sei nicht schuld, denn die Königin selber habe keinen Menschen in ihre Nähe gelassen. Da fragte der König seine Frau, ob sie einen Arzt wolle, und die Frau bat ihn und sagte, sie wolle keinen; und sie sprach zum König kein Wort mehr, sondern winkte nur mit der Hand, daß man sie verlassen solle. Der König konnte nicht heraus bekommen, was seiner Frau fehle; doch ließ er den Arzt holen, und dieser erklärte, die Königin müsse allein sein und niemand dürfe sie stören.
Da saß nun an einem sehr, sehr schönen Abend der alte Diener des Königs draußen auf einem Stein und dachte an seinen kummervollen Herrn. Die Mitternacht kam heran. Da sah der Diener mit seinen eigenen Augen einen Werwolf herankommen. Der Diener saß so regungslos, wie er nur konnte, und wollte sehen, was für ein Tier das eigentlich sei.
Der Werwolf ging geradewegs unter das Fenster der Königin und sprach diese Worte: »Wenn man nur das Kind herausbringen und auf dem Hof niederlegen wollte, dann würde ich es säugen.« Der alte Diener horchte und schaute und begriff nun klar, daß die jetzige Königin nicht die rechte sei, sondern daß hier ein schreckliches, großes Verbrechen geschehen sein müsse. Und der Diener erzählte am Morgen dem Könige alles, was er in der Nacht gesehen und gehört hatte.
In der nächsten Nacht ging der König auch selbst lauschen. Die beiden legten das Kind auf den Erdboden und setzten sich auf den Stein, um den Werwolf zu erwarten. Dieser kam, nahm das Kind und ging damit zur Ecke der königlichen Vorratskammer. Da war ein sehr großer Stein. Dort zog der Werwolf sein Fell aus, legte es auf den Stein, setzte sich darauf und säugte das Kind. Nun sah auch der König deutlich, daß es seine eigene Frau war, und wollte sogleich zu ihr eilen; aber der Diener hielt ihn fest und ließ ihn nicht hin. Als die Frau das Kind gesäugt hatte, brachte sie es zurück, legte es hin und sprach diese Worte: »Noch zwei Abende und dann niemals mehr!« Und sie schlich fort.
Der König nahm sein Kind auf und brachte es in die Stube; dann ließ er durch seine Diener die Königin im Bett festnehmen und ins Gefängnis werfen. Mit dem Diener aber hielt er Rat, wie sie den Werwolf in ihre Hände bekommen sollten. Und sie verabredeten sich, das Kind am Abend wieder hinaus zu tragen und dann in der Nacht den Werwolf dort fest zu nehmen. Sie brachten das Kind auch hinaus und warteten auf das Kommen des Werwolfs. Der Werwolf kam, nahm das Kind auf und ging wieder zum selben Stein, um es zu säugen. Als die Frau das Werwolfsfell ausgezogen hatte und das Kind zu säugen begann, da lief der König hinzu und wollte sie festhalten; aber so wie sie das merkte, warf sie das Kind hin und lief davon und sprach nur noch diese Worte: »Noch morgen Nacht und dann niemals mehr!«
Der König konnte kein Mittel erdenken, um den Werwolf zu fangen. Da gab ihm der alte Diener einen guten Rat: man solle auf dem Stein ein Feuer anlegen und den Stein glühend machen; wenn da der Wolf sein Fell ausziehe und auf den Stein lege, so werde das Fell am Stein haften bleiben, und ohne das Fell werde der Wolf nicht fortlaufen. Das taten sie auch: sie heizten den Stein glühend und warteten, bis der Werwolf kam.
Dieser nahm sogleich das Kind und fing es an zu säugen; er zog sein Fell aus, legte es auf den Stein und setzte sich darauf. Der König aber und sein Diener warteten noch, damit die Frau länger auf dem Stein sitze - dann bleibt das Fell fester am Stein haften. Als die Frau das Kind gesäugt hatte, küßte sie es noch dreimal, legte es nieder und wollte das Fell nehmen, sie konnte es aber nicht, denn das Fell war am Stein haften geblieben. Nun stürmte der König herbei und hielt sie fest und überzeugte sich jetzt, daß es seine rechte Frau war, welche sechs Monate lang das Werwolfsfell getragen hatte.
Da führte der König seine Frau ins Zimmer und ließ jene andere, welche im Gefängnis saß, an einen Pferdeschweif binden, damit das Pferd sie zu Tode trete. Und der König selbst hielt mit seiner ersten Frau zum zweiten Mal Hochzeit; und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen - Livische Märchen
WIE EIN KÖNIGSSOHN ALS HÜTERKNABE AUFWUCHS ...
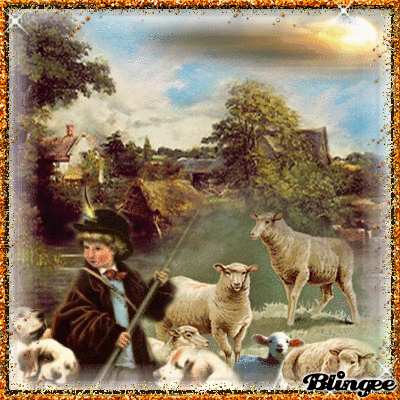
Es war einmal ein König, der seine Untertanen milde und liebreich regierte, so daß niemand im Königreiche war, der ihn nicht gesegnet, und den himmlischen Vater um die Verlängerung seiner Lebenstage angefleht hätte.
Der König lebte schon manches Jahr in glücklicher Ehe, aber kein Kind war den Ehegatten geschenkt worden. Groß war daher seine und sämtlicher Untertanen Freude, als die Königin ein Söhnlein zur Welt brachte, aber die Mutter sollte dieses Glück nicht lange genießen. Drei Tage nach des Sohnes Geburt schlossen sich ihre Augen für immer - der Sohn war Waise, und der König Witwer. Schweren Kummer empfand der König über den Tod seiner teuren Gemahlin, und mit ihm trauerten die Untertanen; man sah nirgends mehr ein fröhliches Antlitz. Zwar nahm der König, auf Andringen seiner Untertanen, drei Jahre später eine andere Gemahlin, aber bei der neuen Wahl war ihm das Glück nicht wieder günstig: ein Täubchen hatte er begraben, und einen Habicht dafür bekommen; es geht leider vielen Witwern so.
Die junge Frau war ein böses, hart herziges Weib, das weder dem Könige noch den Untertanen Gutes erwies. Den Sohn der vorigen Königin konnte sie nicht vor Augen leiden, da sie besorgen mußte, die Regierung werde an diesen Stiefsohn fallen, den die Untertanen um seiner hin geschiedenen Mutter willen liebten. Die tückische Königin faßte darum den bösen Vorsatz, das Knäblein heimlich an einen Ort zu schaffen, wo der König es nicht wieder finden könne; es umzubringen, dazu hatte sie nicht den Mut.
Ein nichtswürdiges altes Weib half für gute Bezahlung der Königin die böse Tat auszuführen. Bei nächtlicher Weile wurde das Kind dem gottlosen Weibe überliefert, und von diesem auf Schleichwegen weit weg gebracht, und armen Leuten als Pflegekind übergeben. Unterwegs zog die Alte dem Kinde seine guten Kleider aus, und hüllte es in Lumpen, damit niemand den Betrug merke. Der Königin hatte sie mit einem schweren Eide gelobt, keinem Menschen den Ort zu nennen, wohin der Königssohn geschafft worden sei. Am Tage wagte die Kindesdiebin nicht zu wandern, weil sie Verfolgung fürchtete; darum dauerte es lange, bis sie einen verborgenen Ort fand, der sich zum Aufenthalte für das königliche Kind eignete.
In ein einsames Waldgehöft, das fremder Menschen Fuß selten betreten hatte, wurde der gestohlene Königssohn als Pflegling getan, und der Wirt erhielt für das Aufziehen des Kindes die Summe von hundert Rubeln. Es war ein Glück für den Königssohn, daß er zu guten Menschen gekommen war, die für ihn sorgten, als wäre er ihr leibliches Kind. Der muntere Knabe machte ihnen oft Spaß, besonders wenn er sich einen Königssohn nannte. Sie sahen wohl aus der reichlichen Bezahlung, die sie erhalten hatten, daß das Knäblein kein rechtmäßiger Sprößling sei, und vom Vater oder von der Mutter her vornehmer Abkunft sein mochte, allein so hoch verstiegen sich ihre Gedanken nicht, daß sie für wahr gehalten hätten, wessen das Kind in seinem einfältigen Sinne sich rühmte.
Man kann sich leicht vorstellen, wie groß der Schrecken im Hause des Königs war an dem Morgen, wo man entdeckte, daß das Söhnchen in der Nacht gestohlen war, und zwar auf so wunderbare Weise, daß niemand es gehört hatte, und daß nicht die leiseste Spur des Diebes zurückgeblieben war. Der König weinte Tage lang bitterlich um den Sohn, den er im Andenken an dessen Mutter um so zärtlicher liebte, je weniger er mit seiner neuen Gemahlin glücklich war. Zwar wurden lange Zeit hindurch aller Orten Nachforschungen angestellt, um dem verschwundenen Kinde auf die Spur zu kommen, auch wurde jedem eine große Belohnung verheißen, der irgend eine Auskunft darüber geben könnte, aber alles blieb vergeblich, das Knäblein schien wie weggeblasen. Kein Mensch konnte das Geheimnis aufklären, und manche glaubten, das Kind sei durch einen bösen Geist oder durch Hexerei entführt. In das einsame Waldgehöft, wo der Königssohn lebte, hatte keiner der Suchenden seine Schritte gelenkt, und eben so wenig konnten die Bekanntmachungen dahin dringen. -
Während nun der Königssohn daheim als Toter beweint wurde, wuchs er im stillen Walde auf und gedieh fröhlich, bis er in das Alter trat, daß er schon Geschäfte besorgen konnte. Da legte er denn eine wunderbare Klugheit an den Tag, so daß seine Pflegeeltern sich oft genug gestehen mußten, daß hier das Ei viel klüger sei als die Henne. Der Königssohn hatte schon über zehn Jahre in dem Waldgehöft gelebt, als er ein Verlangen empfand, unter die Leute zu kommen. Er bat seine Pflegeeltern um Erlaubnis, sich auf eigene Hand sein Brot zu verdienen, in dem er sagte: »Ich habe Verstand und Kraft genug, um mich ohne eure Hilfe zu ernähren. Bei dem einsamen Leben hier wird mir die Zeit sehr lang.« Die Pflegeeltern sträubten sich anfangs sehr dagegen, mußten aber endlich nachgeben, und den Wunsch des jungen Burschen erfüllen. Der Wirt ging selbst mit, um ihn zu begleiten, und eine passende Stelle für ihn ausfindig zu machen.
In einem Dorfe fand er einen wohlhabenden Bauernwirt, der einen Hüterknaben brauchte, und da sich der Pflegesohn gerade einen solchen Dienst wünschte, so wurde man bald einig. Der Vertrag lautete auf ein Jahr, allein es wurde ausdrücklich bedungen, daß es dem Knaben zu jeder Zeit gestattet sein solle, den Dienst zu verlassen und zu seinen Pflegeeltern zurückzukehren. Ebenso konnte der Wirt, wenn er mit dem Knaben nicht zufrieden war, ihn noch vor Ablauf des Jahres entlassen, jedoch nicht ohne Vorwissen der Pflegeeltern.
Das Dorf, wo der Königssohn diesen Dienst gefunden hatte, lag unweit einer großen Landstraße, auf welcher täglich viele Menschen vorbeikamen, Hohe wie Niedere. Der königliche Hüterknabe saß häufig dicht an der Landstraße, und unterhielt sich mit den Vorübergehenden, von denen er Manches erfuhr, was ihm bis dahin unbekannt geblieben war. Da geschah es eines Tages, daß ein alter Mann mit grauen Haaren und langem weißen Barte des Weges kam, als der Königssohn auf einem Steine sitzend die Maultrommel schlug; die Tiere grasten indeß, und wenn eines derselben sich zu weit von den übrigen entfernen wollte, so trieb des Knaben Hund es zurück.
Der Alte betrachtete ein Weilchen den Knaben und seine Herde, trat dann einige Schritte näher und sagte: »Du scheinst mir nicht zum Hüterknaben geboren zu sein.« Der Knabe erwiederte: »Mag sein, ich weiß nur soviel, daß ich zum Herrscher geboren bin, und hier vorerst das Geschäft des Herrschens erlerne. Geht es mit den Vierfüßlern gut, so versuche ich weiterhin mein Glück auch wohl mit den Zweifüßlern.« Der Alte schüttelte wie verwundert den Kopf und ging seiner Wege.
Ein anderes Mal fuhr eine prächtige Kutsche vorbei, in der ein Frauenzimmer mit zwei Kindern saß: auf dem Bocke der Kutscher und hinten auf ein Lakai. Der Königssohn hatte gerade ein Körbchen mit frisch gepflückten Erdbeeren in der Hand, welches der stolzen deutschen Frau in die Augen fiel, und ihren Appetit reizte. Sie befahl dem Kutscher zu halten, und rief gebieterisch zum Kutschenfenster hinaus: »Du Rotzlöffel! bring die Beeren her, ich will dir ein paar Kopeken zu Weißbrot dafür geben!« Der königliche Hüterknabe tat, als ob er nichts hörte, und auch nicht glaubte, daß ihm der Befehl gelte, so daß die Frau ein zweites und ein drittes Mal rufen mußte, was aber auch nur in den Wind gesprochen war. Da rief sie dem Lakaien hinter der Kutsche zu: »Geh und ohrfeige diesen Rotzlöffel, damit er gehorcht.« Der Lakai stürzte hin, um den erhaltenen Befehl auszuführen.
Noch ehe er ankam, war der Hüterknabe aufgesprungen, hatte einen tüchtigen Knüppel ergriffen, und schrie dem Lakai zu: »Wenn dich nicht nach einem blutigen Kopf gelüstet, so tue keinen Schritt weiter, oder ich zerschlage dir das Gesicht!« Der Lakai ging zurück, und meldete, was ihm begegnet war. Da rief die Dame zornig: »Schlingel! willst du dich vor dem Rotzlöffel von Jungen fürchten? Geh und nimm ihm den Korb mit Gewalt weg, ich will ihm zeigen, wer ich bin, und werde auch noch seine Eltern bestrafen lassen, die ihn nicht besser zu erziehen verstanden.« - »Hoho!« rief der Hüterknabe, der den Befehl gehört hatte, »so lange noch Leben in meinen Gliedern sich regt, soll niemand mir mit Gewalt nehmen, was mein rechtmäßiges Eigentum ist. Ich stampfe jeden zu Brei, der mir meine Erdbeeren rauben will!« So sprechend spuckte er in die Hand, und schwang den Knüppel um den Kopf, daß es sauste. Als der Lakai das sah, hatte er nicht die geringste Lust, die Sache zu probieren; die Frau aber fuhr unter schweren Drohungen davon, versichernd, daß sie diesen Schimpf nicht ungeahndet lassen werde.
Andere Hüterknaben, welche den Vorfall von Weitem mit angesehen und angehört hatten, erzählten ihn am Abend ihren Hausgenossen. Da gerieten alle in Furcht, daß man auch ihnen zu nahe tun könnte, wenn die vornehme Frau sich vor Gericht über die törichte Widerspenstigkeit des Burschen beklagte, und es zur Untersuchung käme. Den Königssohn schalt sein Wirt und sagte: »Ich werde nicht für dich sprechen; was du dir eingebrockt hast, kannst du auch ausessen.« Der Königssohn erwiederte: »Damit will ich schon zurecht kommen, das ist meine Sache. Gott hat mir selber einen Mund in den Kopf, und eine Zunge in den Mund gesetzt, ich kann selber für mich sprechen, wenn es not tut, und werde euch nicht bitten, mein Fürsprecher zu sein. Hätte die Frau auf geziemende Weise die Erdbeeren verlangt, ich hätte sie ihr gegeben, aber wie durfte sie mich Rotzlöffel schimpfen? Meine Nase ist noch immer eben so rein von Rotz gewesen wie die ihrige.«
Die Frau war in die Stadt des Königs gefahren, wo sie nichts Eiligeres zu tun hatte, als sich bei Gericht über das unverschämte Benehmen des Hüterknaben zu beschweren. Man schritt auch ungesäumt zur Untersuchung, und es wurde Befehl gegeben, das Bürschlein samt seinem Wirt vors Gericht zu bringen. Als die Gerichtsdiener ins Dorf kamen, um den Befehl auszuführen, sagte der Königssohn: »Mein Wirt hat mit dieser Sache nichts zu schaffen; was ich getan habe, das muß ich auch verantworten.«
Jetzt wollte man ihm die Hände auf den Rücken binden, und ihn als Gefangenen vor Gericht führen, aber er zog ein scharfes Messer aus der Tasche, trat rasch einige Schritte zurück, richtete die Spitze des Messers auf sein Herz, und rief aus: »Lebend soll mich niemand binden! Ehe eure Hand mich bindet, stoße ich mir das Messer ins Herz! Meinen Leichnam mögt ihr dann binden, und damit machen, was ihr wollt; so lange ich noch Atem habe, soll kein Mensch mir einen Strick oder eine Fessel anlegen! Vor Gericht will ich gern erscheinen, und Auskunft geben, als Gefangenen lasse ich mich nicht fortführen.«
Seine Kühnheit setzte die Gerichtsdiener dermaßen in Schrecken, daß sie nicht wagten, ihm nahe zu kommen; sie fürchteten, es möchte ihnen zur Last fallen, wenn der Knabe in seinem Trotze sich umbrächte. Und da er ihnen gutwillig folgen wollte, so mußten sie sich zufrieden geben. Unterwegs wunderten sich die Gerichtsdiener täglich mehr über den Verstand und die Klugheit ihres Gefangenen, denn dieser wußte in allen Dingen besser Bescheid als sie selber. Noch viel größer war die Verwunderung der Richter, als sie den Hergang der Sache aus dem Munde des Knaben vernahmen; er sprach so klar und bündig, daß man ihm Recht geben und ihn von aller Schuld frei sprechen mußte.
Auch der König, an den sich die vornehme Frau jetzt wandte, und der sich auf ihre Bitten die ganze Sache auseinander setzen ließ, mußte den Richtern beistimmen, und den Burschen straflos lassen. Jetzt wollte die vornehme Frau bersten vor Zorn, sie geberdete sich wie eine Katze, die wütend auf einen Hund schnaubt, so ein Rotzlöffel von Bauernjungen sollte ihr gegenüber Recht behalten! Sie klagte ihre Not der Königin, von der sie wußte, daß sie ungleich härter war als der König. »Mein Gemahl,« sagte die Königin, »ist eine alte Nachtmütze, und seine Richter sind all' zusammen Schafsköpfe! Schade, daß ihr eure Sache vor Gericht brachtet, und nicht lieber gleich zu mir kamt; ich hätte euren Handel anders geschlichtet und euch Recht gegeben. Jetzt, da die Sache durch's Gericht entschieden und vom Könige bestätigt ist, bin ich nicht mehr im Stande, der Sache öffentlich eine bessere Wendung zu geben, aber wir müssen sehen, wie wir ohne Aufsehen über den Burschen eine Züchtigung verhängen können.«
Da fiel es der Frau zur rechten Zeit ein, daß auf ihrem Gebiete eine sehr böse Bauerwirtin angesessen war, bei der kein Knecht mehr bleiben wollte; auch gab der Wirt selber zu, daß es bei ihnen ärger hergehe als in der Hölle. Wenn man das naseweise Bürschlein auf diesen Hof als Hüterknaben geben könnte, so würde ihm das gewiß eine schwerere Züchtigung sein, als irgend ein Richterspruch ihm zuerkennen könnte. »Ich will die Sache gleich so einrichten, wie ihr wünscht,« sagte die Königin, ließ einen zuverlässigen Diener rufen, und gab ihm an, was er zu tun habe. Hätte ihre Seele geahndet, daß der Hüterknabe der von ihr verstoßene Königssohn sei, so hätte sie ihn ohne weiteres töten lassen, ohne sich um König oder Richterspruch zu kümmern.
Der Bauerwirt hatte kaum den Befehl der Königin erhalten, als er auch den Hüterknaben seines Dienstes entließ. Er dankte seinem Glücke, daß er noch so leichten Kaufes davon gekommen war. Der Königin Diener führte nun den Burschen selber auf den Bauernhof, auf welchen sie ihn wider seinen Willen verdungen hatte. Die tückische Wirtin jauchzte auf vor Freude, daß die Königin ihr einen Hüterknaben geschafft, und ihr zugleich frei gestellt hatte, mit ihm zu machen was sie wollte, weil das Bürschlein sehr halsstarrig und in Gutem nicht zu lenken sei. Sie kannte des neuen Mühlsteins Härte noch nicht, und hoffte, in ihrer alten Weise mit ihm zu mahlen. Bald aber sollte das höllische Weib inne werden, daß ihr dieser Zaun denn doch zu hoch war, um hinüber zu kommen, sintemal das Bürschlein einen gar zähen Sinn hatte, und kein Haar breit von seinem Rechte vergab.
Wenn ihm die Wirtin ohne Grund ein böses Wort gab, so erhielt sie deren gleich ein Dutzend zurück; wenn sie die Hand gegen den Knaben aufhob, so raffte dieser einen Stein oder ein Holzscheit, oder was ihm gerade zur Hand war, auf und rief: »Wage es nicht, einen Schritt näher zu kommen, oder ich schlage dir das Gesicht entzwei, und stampfe deinen Leib zu Brei!« Solche Reden hatte die Hausfrau in ihrem Leben noch von niemanden, am wenigsten aber von ihren Knechten gehört; der Wirt aber freute sich im Stillen, wenn er ihren Hader mit anhörte, und stand auch seiner Frau nicht bei, da der Knabe seine Pflicht nicht versäumte. Die Wirtin suchte nun den Hüterknaben durch Hunger zu zähmen, und weigerte ihm die Nahrung, aber der Knabe nahm das Laib mit Gewalt, wo er es fand, und melkte sich dazu Milch von der Kuh, so daß sein Magen kein Nagen des Hungers verspürte. Je weniger die Wirtin mit dem Hüterknaben fertig werden konnte, desto mehr suchte sie ihr Mütchen am Manne und dem Gesinde zu kühlen.
Als der Königssohn sich dieses heillose Leben, das einen Tag wie den anderen war, einige Wochen lang mit angesehen hatte, beschloß er, der Wirtin alle ihre Schlechtigkeit heimzuzahlen, und zwar in der Weise, daß die Welt den Drachen gänzlich los würde. Um seinen Vorsatz auszuführen, fing er ein Dutzend Wölfe ein, und sperrte sie in eine Höhle, wo er ihnen alle Tage ein Tier von seiner Herde vorwarf, damit sie nicht verhungerten. Wer vermochte der Wirtin Wut zu beschreiben, als sie ihr Eigentum dahin schwinden sah, denn der Knabe brachte alle Abende ein Stück Vieh weniger nach Hause, als er am Morgen auf die Weide getrieben hatte, und antwortete auf alle Fragen nichts weiter als: »Die Wölfe haben's zerrissen!« Die Wirtin schrie wie eine Rasende, und drohte, das Bürschlein den wilden Tieren zum Fraß vorzuwerfen, aber der Knabe entgegnete lachend: »Da wird ihnen dein wütiges Fleisch besser munden!« Darauf ließ er seine Wölfe in der Höhle drei Tage lang ohne Futter, trieb dann in der Nacht, als alles schlief, die Herde aus dem Stalle und statt der selben die zwölf Wölfe hinein, worauf er die Tür fest verschloß, so daß die wilden Bestien nicht heraus konnten. Als die Sache soweit in Ordnung war, machte er sich auf die Socken, da ihm der Hirtendienst schon längst zuwider geworden war, und er jetzt auch Kraft genug in sich fühlte, um größere Arbeiten zu unternehmen.
O du liebe Zeit! was begab sich da am Morgen, als die Wirtin in den Stall ging, um die Tiere heraus zu lassen und die Kühe zu melken. Die vom Hunger wütend gewordenen Wölfe sprangen auf sie los, rissen sie nieder und verschlangen sie samt ihren Kleidern mit Haut und Haar, so daß nichts weiter von ihr übrig blieb, als Zunge und Herz, diese beiden taugten nicht einmal den wilden Bestien, weil sie zu giftig waren. Weder Wirt noch Gesinde betrübten sich über dieses Unglück, vielmehr war jeder dem Geschicke dankbar, das ihn von dem Höllenweibe befreit hatte.
Der Königssohn hatte einige Jahre die Welt durchstreift, und bald dies bald jenes Gewerbe versucht, er hielt sich aber an keinem Orte lange aus, weil ihn die Erinnerungen seiner Kindheit, die ihm wie lebhafte Träume vorschwebten, stets daran mahnten, daß er durch seine Geburt einem höheren Stande angehöre. Von Zeit zu Zeit traf er wieder mit dem alten Manne zusammen, der ihn schon damals ins Auge gefaßt hatte, als er noch Hüterknabe war. Als der Königssohn achtzehn Jahr alt war, trat er bei einem Gärtner in Dienst, um die Gärtnerei zu erlernen.
Gerade zu der Zeit ereignete sich etwas, was seinem Leben eine andere Wendung geben sollte. Die ruchlose Alte, welche ihn auf Befehl der Königin geraubt und als Pflegekind in das Waldgehöft gebracht hatte, beichtete auf ihrem Totenbette dem Geistlichen, den von ihr verübten Frevel, denn ihre unter der Last der Sünde seufzende Seele fand nicht eher Ruhe, als bis sie die böse Tat aufgedeckt hatte. Sie nannte auch den Bauernhof, auf welchen sie das Kind gebracht hatte, konnte aber nichts weiter darüber sagen, ob das Kind am Leben geblieben oder gestorben sei. Der Geistliche machte sich eilig auf, dem König die Freudenbotschaft zu bringen, daß eine Spur seines verschwundenen Sohnes gefunden sei. Der König verriet niemanden, was er erfahren, ließ augenblicklich ein Pferd satteln und machte sich mit drei treuen Dienern auf den Weg.
Nach einigen Tagen erreichten sie das Waldgehöft; Wirt und Wirtin bekannten der Wahrheit gemäß, daß ihnen vor so und so langer Zeit ein Kind männlichen Geschlechts als Pflegling übergeben worden, und daß sie gleichzeitig hundert Rubel für das Aufziehen des selben erhalten hätten. Daraus hätten sie freilich gleich geschlossen, daß das Kind von vornehmer Geburt sein könne, aber das sei ihnen niemals in den Sinn gekommen, daß das Kind von königlichem Geblüte sei, vielmehr hätten sie immer nur ihren Spaß daran gehabt, wenn das Kind sich selbst einen Königssohn genannt hätte.
Darauf führte der Wirt selbst den König in das Dorf, wohin er den Knaben als Hirtenjungen gebracht hatte, wie wohl nicht aus eigenem Antriebe, sondern auf Verlangen des Knaben, der an dem einsamen Orte nicht länger hatte leben mögen. Wie erschrak der Wirt, und noch mehr der König, als sich in dem Dorfe der Knabe, der zum Jüngling herangewachsen sein mußte, nicht fand, und man auch keine nähere Auskunft über ihn erhalten konnte. Die Leute wußten nur soviel zu sagen, daß der Knabe auf die Klage einer vornehmen Dame vor Gericht gestellt, von diesem aber freigesprochen und los gelassen worden sei. Später aber sei ein Diener der Königin erschienen, der den Knaben fortgeführt und in einem anderen Gebiete in Dienst gegeben habe.
Der König eilte dahin, und fand auch das Gesinde, in welchem sein Sohn eine kurze Zeit gewesen war, darnach aber war er entflohen, und man hatte nichts weiter von ihm gehört. Wie sollte man jetzt aufs Geratewohl weiter suchen, und wer war im Stande, den rechten Weg zu weisen?
Während der König noch voller Kümmernis war, daß sich hier alle Spuren verloren, trat ein alter Mann vor ihn hin - der selbe, der schon mehrere Male mit dem Königssohne zusammen getroffen war - und sagte, er sei einem jungen Manne, wie man ihn suche, dann und wann begegnet, und habe ihn anfangs als Hirten und später in mancherlei anderen Handtierungen gesehen; und er hoffe, die Spur des Verschwundenen zu finden. Der König sicherte dem Alten reiche Belohnung zu, wenn er ihn auf die Spur des Sohnes bringen könne, befahl einem der Diener, vom Pferde zu steigen, und hieß den Alten aufsitzen, damit sie rascher vorwärts kämen. Dieser aber sagte lächelnd: »So viel wie eure Pferde laufen können, leisten meine Beine auch noch; sie haben ein größeres Stück Welt durchwandert, als irgend ein Pferd.«
Nach einer Woche kamen sie wirklich dem Königssohn auf die Spur, und fanden ihn auf einem stattlichen Herrenhof, wo er, wie oben erzählt, die Gärtnerei erlernte. Grenzenlos war des Königs Freude, als er seinen Sohn wieder fand, den er schon so manches Jahr als tot beweint hatte. Freudentränen rannen von seinen Wangen, als er den Sohn umarmte, ihn an seine Brust drückte und küßte. Doch sollte er aus des Sohnes Munde eine Nachricht vernehmen, welche ihm die Freude des Wiederfindens schmälerte und ihn in neue Betrübnis versetzte.
Der Gärtner hatte eine junge blühende Tochter, welche schöner war als alle Blumen in dem prachtvollen Garten, und so fromm und schuldlos wie ein Engel. Diesem Mädchen hatte der Königssohn sein Herz geschenkt, und er gestand seinem Vater ganz offen, daß er nie eine Dame von edlerer Herkunft freien, sondern die Gärtnerstochter zu seiner Gemahlin machen wolle, sollte er auch sein Königreich aufgeben müssen. »Komm nur erst nach Hause,« sagte der König, »dann wollen wir die Sache schon in Ordnung bringen.«
Da bat sich der Sohn von seinem Vater einen kostbaren goldenen Ring aus, steckte ihn vor aller Augen der Jungfrau an den Finger und sagte: »Mit diesem Ringe verlobe ich mich mit dir, und über kurz oder lang komme ich wieder, um als Bräutigam dich heim zu führen.« Der König aber sagte: »Nein, nicht so - auf andere Weise soll die Sache vor sich gehen!« - zog den Ring wieder vom Finger des Mädchens und hieb ihn mit seinem Schwerte in zwei Stücke. Die eine Hälfte gab er seinem Sohne, die andere der Gärtnerstochter, und sagte: »Hat Gott euch für einander geschaffen, so werden die beiden Hälften des Ringes zu rechter Zeit von selbst ineinander schmelzen, so daß kein Auge die Stellen wird entdecken können, wo der Ring durch gehauen war. Jetzt bewahre Jeder von euch seine Hälfte, bis die Zeit erfüllt sein wird.«
Die Königin wollte vor Wut bersten, als ihr Stiefsohn, den sie für immer verschollen glaubte, plötzlich zurück kehrte, und zwar als rechtmäßiger Thronerbe, da dem Könige aus seiner zweiten Ehe nur zwei Töchter geboren waren. Als nach einigen Jahren des Königs Augen sich geschlossen hatten, wurde sein Sohn zum König erhoben. Wie wohl ihm die Stiefmutter schweres Unrecht zugefügt hatte, wollte er doch nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern überließ die Strafe dem Gericht Gottes.
Da nun die Stiefmutter keine Hoffnung mehr hatte, eine ihrer Töchter mittels eines Schwiergersohnes auf den Thron zu bringen, so wollte sie wenigsten eine fürstliche Jungfrau aus ihrer eigenen Sippschaft dem Könige vermählen, aber dieser entgegnete kurz: »Ich will nicht! ich habe meine Braut längst gewählt.« Als die verwitwete Königin dann erfuhr, daß der junge König ein Mädchen von niederer Herkunft zu freien gedenke, stachelte sie die höchsten Räte des Reichs auf, sich einmütig dagegen zu stemmen. Aber der König blieb fest und gab nicht nach.
Nachdem man lange hin und her gestritten hatte, gab der Konig schließlich den Bescheid: »Wir wollen ein großes Fest geben, und dazu alle Königstöchter und die anderen vornehmen Jungfrauen einladen, so viel ihrer sind, und wenn ich eine unter ihnen finde, welche meine erwählte Braut an Schönheit und Züchten übertrifft, so will ich sie freien. Ist das aber nicht der Fall, so wird meine Erwählte auch meine Gemahlin.«
Jetzt wurde im Königsschloß ein prächtiges Freudenfest hergerichtet, welches zwei Wochen dauern sollte, damit der König Zeit hätte, die Jungfrauen zu mustern, ob eine derselben den Vorzug vor der Gärtnerstochter verdiene. Alle fürstlichen Frauen der Umgegend waren mit ihren Töchtern zum Feste gebeten, und da der Zweck der Einladung allgemein bekannt war, hoffte jedes Mädchen, daß ihr das Glückslos zufallen werde. Schon näherte sich das Fest seinem Ende, aber noch immer hatte der junge König keine gefunden, die nach seinem Sinne war.
Am letzten Tage des Festes erschienen in der Frühe die höchsten Räte des Reichs wieder vor dem Könige und sagten - auf Eingebung der Königinwitwe - wenn der König nicht bis zum Abend eine Wahl getroffen habe, so könne ein Aufstand ausbrechen, weil alle Untertanen wünschten, daß der König sich vermähle. Der König erwiederte: »Ich werde dem Wunsche meiner Untertanen nachkommen und mich heute Abend erklären.« Dann schickte er ohne Vorwissen der anderen einen zuverlässigen Diener zur Gärtnerstochter, mit dem Auftrage, sie heimlich her zu bringen, und hier bis zum Abend versteckt zu halten.
Als nun am Abend des Königs Schloß von Lichtern strahlte, und alle fürstlichen Jungfrauen in ihrem Feststaat den Augenblick erwarteten, der ihnen Glück oder Unglück bringen sollte, trat der König mit einer jungen Dame in den Saal, deren Antlitz so verhüllt war, daß kaum die Nasenspitze heraus sah. Was allen aber gleich auffiel, war der schlichte Anzug der Fremden: sie war in weißes feines Leinen gekleidet, und weder Seide, noch Sammet, noch Gold war an ihr zu finden, während alle anderen von Kopf bis zu Fuß in Sammet und Seide gehüllt waren. Einige verzogen spöttisch den Mund, andere rümpften unwillig die Nase, der König aber tat, als bemerkte er es nicht, löste die Kopfhülle der Jungfrau, trat dann mit ihr vor die verwitwete Königin und sagte: »Hier ist meine erwählte Braut, die ich zur Gemahlin nehmen will, und ich lade euch und alle, die hier versammelt sind, zu meiner Hochzeit ein.«
Die verwitwete Königin rief zornig aus: »Was kann man auch Besseres erwarten von einem Manne, der bei der Herde aufgewachsen ist! Wenn ihr da wieder hin wollt, dann nehmt die Magd nur mit, die wohl verstehen mag, Schweine zu füttern, sich aber nicht zur Gemahlin eines Königs eignet - eine solche Bauerndirne kann den Thron eines Königs nur verunehren!« - Diese Worte weckten des Königs Zorn, und streng entgegnete er: »Ich bin König und kann tun, was ich will; aber wehe euch, daß ihr mir jetzt meinen früheren Hirtenstand ins Gedächtniß zurück riefet; damit habt ihr mich zugleich daran erinnert, wer mich in diesen Stand verstoßen hat. Indeß, da kein vernünftiger Mensch die Katze im Sacke kauft, will ich noch vor meiner Trauung allen deutlich machen, daß ich nirgends eine bessere Gemahlin hätte finden können, als gerade dieses Mädchen, das fromm und rein ist wie ein Engel vom Himmel.«
Mit diesen Worten verließ er das Zimmer, und kam bald darauf mit eben dem Alten zurück, den er von seinem Hirtenstande her kannte, und der den König später auf die Spur seines Sohnes gebracht hatte. Dieser Alte war ein berühmter Zauberer Finnlands, der sich auf viele geheime Künste verstand. Der König sprach zu ihm: »Liebster Zauberer! offenbart uns durch eure Kunst das innere Wesen der hier anwesenden Jungfrauen, damit wir erkennen, welche unter ihnen die würdigste ist, meine Gemahlin zu werden.«
Der Zauberer nahm eine Flasche mit Wein, besprach ihn, bat die Jungfrauen, in der Mitte des Saales zusammen zu treten, und besprengte dann den Kopf einer Jeden mit ein paar Tropfen des Zauberweins, worauf sie alle stehenden Fußes einschliefen. O über das Wunder, welches sich jetzt auftat! Nach kurzer Zeit sah man sie sämtlich verwandelt, so daß keine mehr ihre menschliche Gestalt hatte, sondern statt ihrer allerlei wilde und gezähmte Tiere erschienen, einige waren in Schlangen, Wölfe, Bären, Kröten, Schweine, Katzen, andere wieder in Habichte und sonstige Raubvögel verwandelt. Mitten unter allen diesen Tiergestalten aber war ein herrlicher Rosenstock gewachsen, der mit Blüten bedeckt war, und auf dessen Zweigen zwei Tauben saßen. Das war die vom Könige zur Gemahlin erwählte Gärtnerstochter.
Darauf sagte der König: »Jetzt haben wir einer Jeglichen Kern gesehen, und ich lasse mich nicht durch die glänzende Schale blenden!« Die Königinwitwe wollte vor Zorn bersten, aber was konnte es ihr helfen, da die Sache so klar da lag. Darauf räucherte der Zauberer mit Zauberkräutern, bis alle Jungfrauen aus dem Schlafe erwachten, und wieder Menschengestalt erhielten. Der König erfaßte die aus dem Rosenstrauche hervorgegangene Geliebte, und fragte nach ihrem halben Ring, und als die Jungfrau ihn aus dem Busen nahm, zog auch er seinen halben Ring hervor, und legte beide Hälften auf seine Handfläche; augenblicklich verschmolzen sie mit einander, so daß kein Auge einen Riß oder irgend ein Merkmal der Stellen entdeckte, wo die Schneide des Schwertes den Ring einst getrennt hatte.
»Jetzt ist auch meines heimgegangenen Vaters Wille in Erfüllung gegangen!« sagte der junge König, und ließ sich noch an dem selben Abend mit der Gärtnerstochter trauen. Dann lud er alle Anwesende zum Hochzeitsschmaus, aber die fürstlichen Jungfrauen hatten erfahren, welches Wunder sich während ihres Schlafes mit ihnen begeben, und gingen voller Scham nach Hause. Um so größer war der Untertanen Freude, daß ihre Königin von Innen und von Außen ein untadelhaftes Menschenbild war.
Als das Hochzeitsfest zu Ende war, ließ der junge König eines Tages sämtliche Oberrichter des Reiches versammeln und fragte sie, welche Strafe ein Frevler verdiene, der einen Königssohn heimlich habe weg stehlen, und in einem Bauernhofe als Hüterknaben aufziehen lassen, und der außerdem noch den Jüngling schnöde gelästert habe, nachdem ihn das Glück seinem früheren Stande zurück gegeben. Sämmtliche Richter erwiederten wie aus einem Munde: »Ein solcher Frevler muß den Tod am Galgen erleiden.« Darauf sagte der König: »Nun wohl! Rufet die verwitwete Königin vor Gericht!«
Die Königinwitwe wurde gerufen und das gefällte Urteil ihr verkündet. Als sie es hörte, wurde sie bleich wie eine getünchte Wand, warf sich vor dem jungen Könige auf die Knie und bat um Gnade. Der König sagte: »Ich schenke euch das Leben, und hätte euch niemals vor Gericht gestellt, wenn es euch nicht eingefallen wäre, mich noch hinter her mit eben dem Leiden zu schmähen, welches ich durch euren Frevel habe erdulden müssen; in meinem Königreiche aber ist eures Bleibens nicht mehr. Packt noch heute eure Sachen zusammen, um vor Sonnenuntergang meine Stadt zu verlassen. Diener werden euch bis über die Grenze begleiten. Hütet euch, jemals wieder den Fuß auf mein Gebiet zu setzen, da es Jedermann, auch dem Geringsten, frei steht, euch wie einen tollen Hund tot zu schlagen. Eure Töchter, die auch meines heimgegangenen Vaters Töchter sind, dürfen hier bleiben, weil ihre Seele rein ist von dem Frevel, den ihr an mir verübt habt.«
Als die verwitwete Königin fort gebracht war, ließ der junge König in der Nähe seiner Stadt zwei hübsche Wohnhäuser aufbauen, von denen das eine den Eltern seiner Frau, und das andere dem Wirt des Bauernhofs geschenkt wurde, der den hilflosen Königssohn liebevoll aufgezogen hatte. Der als Hüterknabe aufgewachsene Königssohn und seine aus niederem Geschlecht entsprossene Gemahlin lebten dann glücklich bis an ihr Ende, und regierten ihre Untertanen so liebevoll wie Eltern ihre Kinder.
Estland: Friedrich Reinhold Kreutzwald: Estnische Märchen
WIE EINE KÖNIGSTOCHTER SIEBEN JAHRE GESCHLAFEN HAT ...

Einmal war eines großen Königs Tochter plötzlich gestorben, und Trauer und Wehklagen erfüllte das ganze Land. An dem Tage, wo die Tote eingesargt werden sollte, kam aus fernen Landen ein weiser Mann (Zauberer) in die trauernde Königsstadt. Er schloß aus der allgemeinen Bekümmerniß, daß hier etwas Besonderes vorgefallen sein müsse und fragte, was denn die Bewohner so sehr drücke. Als er Auskunft erhalten hatte, begab er sich in den königlichen Palast, nannte sich einen weisen Arzt und bat um Zutritt zum Könige. Schon auf der Schwelle rief er mit starker Stimme: »Die Jungfrau ist nicht tot, sondern nur müde, laßt sie eine Zeit lang ruhen.« Als der König diesen Ausspruch gehört hatte, befahl er dem Fremden, näher zu treten. Der Zauberer aber sagte: »Die Jungfrau darf nicht zu Grabe gebracht werden. Ich werde einen Glaskasten machen, darin wollen wir sie betten und ruhig schlafen lassen, bis die Zeit des Erwachens heran kommt.«
Der König war höchlich erfreut über diese Rede und versprach dem Zauberer reichen Lohn, wenn seine Verheißung sich erfüllen würde. Dieser machte darauf einen großen Glaskasten, legte seidene Kissen hinein, bettete die Königstochter darauf, schloß den Deckel und ließ den Kasten in ein großes Gemach tragen, jedoch Wachen vor die Tür stellen, damit niemand die Schlafende wecke.
Nachdem dies geschehen war, sagte der Zauberer zum Könige: »Sendet jetzt überall hin und lasset allen Glasvorrat aufkaufen, dann werde ich einen Ofen bauen, der größer sein wird als eure Königsstadt, und in welchem wir unser Glas zu einem Berge zusammen schmelzen wollen. Wenn sechs Jahre verstrichen sind, und der Lerchensang den siebenten Sommer ankündigt, dann sendet Boten nach allen Richtungen hin, und lasset bekannt machen, daß es jedem jungen Manne erlaubt sei, sich als Bewerber um eure Tochter einzufinden. Wer von den Freiern dann, sei es zu Pferde, oder auf seinen eigenen Füßen, des Glasberges Gipfel erklimmt, der muß euer Schwiegersohn werden. Wenn nämlich der auserkorene Mann kommt, was binnen sieben Jahren und sieben Tagen geschehen wird, dann wird eure Tochter aus dem Schlafe erwachen und dem Jüngling einen goldenen Ring geben. Wer euch diesen Ring bringt, und wäre es der geringste eurer Untertanen, ja auch eines Tagelöhner's Sohn, dem müßt ihr eure Tochter zur Gemahlin geben, sonst wird sie in ewigen Schlaf versinken.«
Der König versprach, sich in allen Stücken nach dieser Vorschrift zu richten, und gab sofort Befehl, in allen angrenzenden Ländern den Glasvorrat anzukaufen. Als das sechste Jahr ablief, war so viel Glas beisammen, daß es eine Fläche von einer Meile sieben Klafter hoch bedeckte. Inzwischen hatte der Zauberer seinen Schmelzofen fertig, der so hoch war, daß er fast an die unterste Wolkenschicht reichte. Der König stellte ihm zweitausend Arbeiter zur Verfügung, welche das Glas in den Ofen taten. Hier schmolz es, und die Hitze wurde so stark, daß Sümpfe, Flüsse und kleine Seen austrockneten, ja selbst in Quellen und tiefen Brunnen eine Abnahme des Wassers zu bemerken war.
Während nun der Zauberer seinen Glasberg zusammenschmilzt, wollen wir in eine Bauernhütte treten, die nicht weit von der Königsstadt liegt, und wo ein alter Vater mit seinen drei Söhnen wohnt. Die beiden älteren Brüder waren gescheite, gewiegte Burschen, der jüngste aber etwas einfältig. Als der Vater erkrankte und sein Ende heran nahen fühlte, ließ er seine Söhne vor sein Lager treten und sprach folgendermaßen: »Ich fühle, daß mein Heimgang heran naht, deßhalb will ich euch meinen letzten Willen kund tun. Ihr, meine lieben älteren Söhne, sollt gemeinschaftlich Haus und Acker bestellen, so lange ihr nicht beide heiratet. Die Herrschaft zweier Herdesköniginnen würde einen Riß in's Hauswesen bringen. Denn ein altes wahres Wort sagt: 'Wo sieben unbeweibte Brüder friedlich bei einander leben, da wird es zweien Frauen zu eng; sie müssen sich zausen.' Tritt aber dieser Fall ein, so sollt ihr Haus und Felder unter einander teilen. Euer jüngster Bruder aber, der weder zum Wirt noch zum Knecht taugt, soll bei euch Obdach und Nahrung finden, so lange er lebt. Zu diesem Behufe vermache ich euch beiden meinen Geldkasten. Euer jüngster Bruder ist zwar etwas kurz von Verstande, aber er hat ein gutes Herz, und wird euch eben so willig gehorchen, wie er mir immer gehorcht hat.«
Die älteren Brüder versprachen mit trockenem Auge und geläufiger Zunge des Vaters Willen zu erfüllen, der jüngste sprach kein Wort und weinte bitterlich. »Noch Eins will ich sagen,« fuhr der Vater fort - »wenn ich tot bin und ihr mich begraben habt, so erweiset mir als letzten kleinen Liebesdienst, daß jeder von euch eine Nacht an meinem Grabe wacht.« Beide älteren Brüder versprachen mit trockenem Auge und geläufiger Zunge, des Vaters Willen zu erfüllen, der jüngste sagte kein Wort und weinte bitterlich. Bald nach dieser Unterredung hatte der Vater seine Augen auf immer geschlossen.
Die beiden älteren Brüder richteten ein großes Gastmahl an und luden viele Gäste ein, damit der tote Vater mit allen Ehren bestattet werde. Sie selbst waren guter Dinge und aßen und tranken wie auf einer Hochzeit, während ihr dritter Bruder still weinend am Sarge des Vaters stand; als der Sarg dann weg getragen und in's Grab gesenkt wurde, da war dem jüngsten Sohne zu Mute, als wären nun alle Freuden abgestorben und mit dem Vater begraben.
Spät am Abend, als die letzten Gäste fortgegangen waren, fragte der jüngste Bruder, wer die erste Nacht am Grabe des Vaters wachen würde. Die anderen sagten: »Wir sind müde von der Besorgung des Begräbnisses, wir können heute Nacht nicht wachen, aber du hast nichts Besseres zu tun, also geh du und halte Wache.« Der jüngste Bruder ging ohne ein Wort zu sagen zum Grabe des Vaters, wo alles still war und nur die Grille zirpte. Um nicht einzuschlafen, ging er leisen Schrittes auf und ab. Es mochte um Mitternacht sein, als es wie von einer klagenden Stimme aus dem Grabe tönte:
»Wessen Schritt ist's, der da schüttet
Groben Kiessand auf die Augen,
Schwarze Erde auf die Brauen?«
Der Sohn verstand die Frage und antwortete:
»Das ist ja dein jüngster Knabe,
Dessen Schritt ist's, der da schüttet
Groben Kiessand auf die Augen,
Schwarze Erde auf die Brauen.«
Die Stimme fragte weiter, warum die älteren Brüder nicht zuerst zur Wacht gekommen seien, worauf der jüngste sie entschuldigte, sie hätten, ermüdet von der Beerdigung, heute nicht kommen können. Wieder hob des Vaters Stimme an: »Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, darum will ich dir auch deinen Lohn nicht vorenthalten. Es wird bald eine Zeit kommen, wo du dir bessere Kleider wünschen wirst, um in die Gesellschaft vornehmer Leute kommen zu können. Dann tritt an mein Grab, stampfe mit deiner linken Ferse dreimal auf den Grabhügel und sprich: 'Lieber Vater, ich bitte um meinen Lohn für die erste nächtliche Wacht.' Dann wirst du einen Anzug und ein Pferd erhalten. Aber sage deinen Brüdern nichts davon.«
Mit Tagesanbruch ging der Grabeswächter heim, frühstückte etwas, um sich zu stärken, und legte sich dann nieder, um zu ruhen. Als am Abend die Zeit herankam, fragte er bei den Brüdern an, wer von ihnen die Nacht am Grabe des Vaters wachen würde. Die Brüder antworteten spöttisch: »Nun es wird wohl niemand kommen, um den Vater aus dem Grabe zu stehlen. Wenn du aber Lust hast, so kannst du ja auch diese Nacht dort wachen. Aber mit all deinem Wachen wirst du den Vater nicht wieder ins Leben zurückrufen.« Der jüngste Bruder wurde über diese lieblose Rede noch betrübter und verließ mit Tränen in den Augen das Gemach.
Auf dem Grabe des Vaters war alles ruhig, wie gestern Nacht, nur die Grille zirpte im Grase. Damit er nicht einschliefe, ging er leisen Schrittes auf und ab. Es mochte wohl Mitternacht sein, die Hähne hatten schon zweimal gekräht, als eine klagende Stimme aus dem Grabe sich vernehmen ließ:
»Wessen Schritt ist's, der da schüttet
Groben Kiessand auf die Augen,
Schwarze Erde auf die Brauen?«
Der Sohn verstand die Frage und erwiederte:
»Das ist ja dein jüngster Knabe,
Dessen Schritt ist's, der da schüttet
Groben Kiessand auf die Augen,
Schwarze Erde auf die Brauen.«
Die Stimme fragte weiter, warum keiner der älteren Brüder gekommen sei, und der jüngste entschuldigte sie, sie seien von dem Tagewerk zu ermüdet, um zu wachen.
Wieder hob des Vaters Stimme an: »Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, darum werde ich dir auch deinen Lohn nicht vorenthalten. Bald wird eine Zeit kommen, wo du dir einen noch besseren Anzug wünschen wirst, als den, welchen du dir gestern verdient hast. Dann tritt nur dreist an mein Grab, stampfe mit deiner linken Ferse dreimal auf den Grabhügel und sprich: 'Lieber Vater, ich bitte um meinen Lohn für die zweite nächtliche Wacht!' Sofort wirst du einen prächtigeren Anzug und ein schöneres Pferd erhalten, so daß die Leute ihre Augen nicht von dir weg wenden mögen. Aber sage deinen Brüdern nichts davon.«
Mit Tagesanbruch ging er von der Grabeswacht nach Hause, fand die beiden älteren Brüder noch schlafend, frühstückte etwas, um sich zu stärken, streckte sich dann auf die Ofenbank hin und schlief, bis die Sonne schon etwas über Mittag stand. Als am Abend die Zeit wieder heran nahte, fragte er die Brüder, wer von ihnen die Nacht am Grabe des Vaters wachen würde? Sie lachten und antworteten spöttisch: »Wer die wohlfeile Arbeit zwei Nächte getan hat, der kann sie auch die dritte Nacht tun. Der Vater wird aus seinem Grabe nicht davon laufen, und noch weniger werden die Leute kommen, ihn zu stehlen. Wäre er noch bei vollem Verstande gewesen, so hätte er einen Wunsch dieser Art gar nicht geäußert.« Der jüngste Bruder war sehr betrübt über ihre lieblose Rede, und ging wieder mit tränenden Augen davon.
Auf dem Grabe des Vaters war alles still, wie die beiden Nächte zuvor, nur die Grille zirpte im Grase, und die Schnepfe meckerte unter hohem Himmel. Um nicht einzuschlafen, ging der Grabeswächter leisen Schrittes auf und ab. Es mochte Mitternacht sein, die Hähne hatten schon zweimal gekräht, da rief wieder die klagende Stimme aus dem Grabe:
»Wessen Schritt ist's, der da schüttet
Groben Kiessand auf die Augen,
Schwarze Erde auf die Brauen?«
Der Sohn verstand die Frage und erwiederte:
»Das ist ja dein jüngster Knabe,
Dessen Schritt ist's, der da schüttet
Groben Kiessand auf die Augen,
Schwarze Erde auf die Brauen.«
Die Stimme fragte wieder, weßwegen die älteren Brüder nicht gekommen seien, und erhielt dieselbe Antwort wie gestern.
Aber des Vaters Stimme hob wieder an: »Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, ich will dir den deinigen nicht vorenthalten. Bald wird eine Zeit kommen, wo du an dir selbst erfahren wirst, daß der Mensch, je mehr er hat, desto mehr begehrt. Einem guten Sohne aber, der seinem Vater auch nach dem Tode noch Liebe erwies, müssen alle Wünsche erfüllt werden. Anfangs wollte ich meine verborgenen Schätze unter deine Brüder teilen, jetzt bist du mein einziger Erbe. Wenn dir deine prächtigen Kleider und Pferde, die ich dir für die erste und zweite nächtliche Wacht zum Lohne versprach, nicht mehr gefallen, so tritt dreist an mein Grab, stampfe mit deiner linken Ferse dreimal auf den Grabhügel und sprich: 'Lieber Vater, ich bitte um meinen Lohn für die dritte nächtliche Wacht!' und augenblicklich wirst du die aller prächtigsten Kleider und die aller kostbarsten Pferde erhalten. Alle Welt wird mit Bewunderung auf dich blicken, deine älteren Brüder werden dich beneiden und ein großer König wird dich zum Schwiegersohne wählen. Aber sage deinen Brüdern nichts davon.«
Mit Tagesanbruch ging der Grabeswächter nach Hause und dachte bei sich selbst: so eine Zeit wird für mich Armen wohl niemals kommen. Als er dann ein wenig gefrühstückt hatte, um sich zu stärken, streckte er sich auf die Ofenbank, schlief ein und erwachte erst, als die Sonne schon in den Wipfeln des Waldes stand.
Während er schlief, sprachen die älteren Brüder untereinander: »Dieser Nachtwacher und Tagschläfer wird uns nie zu was nützen, wozu füttern wir ihn? Wir täten besser, das Futter einem Schweine zu geben, das wir zu Weihnacht schlachten können.« Der älteste Bruder setzte hinzu: »Werfen wir ihn aus dem Hause, er kann vor fremder Leute Türen sein Brot betteln.« Da meinte aber der andere, das würde doch nicht gut angehen, und würde ihnen selber Schande bringen, wenn sie, als wohlhabende Leute, den Bruder betteln gehen ließen. »Lieber wollen wir ihm die Brosamen von unserm Tische hinwerfen, satt soll er nicht dabei werden, aber auch nicht Hungers sterben.«
Inzwischen hatte der Zauberer seinen Glasberg fertig geschmolzen, und der König hatte überall bekannt machen lassen, daß jeder junge Mann kommen dürfe, sich um seine Tochter zu bewerben, daß aber nur dem jenigen die Jungfrau ihre Hand reichen würde, der zu Pferde oder auf eigenen Füßen den Gipfel des Glasberges erklimmen würde. Der König ließ nun ein große Gelage anrichten für alle die Gäste, die sich einfinden würden. Das Gelage sollte drei Tage währen; für jeden Tag wurden hundert Ochsen und siebenhundert Schweine geschlachtet, und fünfhundert Fässer Bier gebraut. Die aufgestapelten Würste ragten gleich Wänden, die Hefebrote und Kuchen bildeten Haufen, so hoch wie die größten Heuschober.
Die schlafende Königstochter wurde in ihrem Glaskasten auf den Gipfel des Glasberges getragen. Von allen Seiten strömten Fremde herbei, teils um das Wagestück zu versuchen, teils um das Wunder mit anzusehen. Der glänzende Berg strahlte wie eine zweite Sonne, so daß man ihn schon viele Meilen weit aus der Ferne erblickte.
Unsere alten Bekannten, die beiden älteren Brüder, hatten sich Festkleider machen lassen und gingen auch zum Gastmahl. Der jüngste mußte zu Hause bleiben, damit er in seinem elenden Aufzug den schmucken Brüdern keine Schande mache. Aber kaum hatten sich die älteren Brüder auf den Weg gemacht, so ging der jüngste an des Vaters Grab, tat, wie die Stimme ihn gelehrt hatte, und sprach: »Lieber Vater, ich bitte um meinen Lohn für die erste nächtliche Wacht!« - In dem nämlichen Augenblick, wo die Bitte über seine Lippen kam, stand ein ehernes Roß da mit ehernem Zaum, und auf dem Sattel lag die schönste glänzende Rüstung, vollständig vom Scheitel bis zur Sohle, und alles paßte so gut, als wäre es auf seinen Leib gemacht.
Um Mittag kam der eherne Mann auf seinem ehernen Pferde an den Glasberg, wo Hunderte und Tausende standen, aber kein Einziger war im Stande, auch nur einige Schritte den glatten Berg hinauf zu kommen. Der eherne Reiter drängte sich durch die Menge, ritt ein Drittel des Berges hinauf, als wäre es geschwendetes Land, kehrte dann um, grüßte den König und verschwand wieder. Manche Zuschauer wollten bemerkt haben, daß die schlafende Königstochter ihre Hand regte, als der eherne Mann hinauf ritt. Beide Brüder konnten am Abend nicht genug von der wunderbaren Tat des ehernen Mannes und seines ehernen Pferdes erzählen. Der jüngste Bruder hörte ihre Reden schweigend an, ließ sich aber nicht merken, daß er selber der Mann gewesen war.
Am anderen Morgen gingen die Brüder mit Sonnenaufgang wieder fort, um die Gasterei nicht zu versäumen. Die Sonne stand in Südost, als der jüngste Bruder an das Grab des Vaters kam; er tat nach der Vorschrift und sagte: »Lieber Vater, ich bitte um meinen Lohn für die zweite nächtliche Wacht!« In dem nämlichen Augenblicke, wo die Bitte über seine Lippen kam, stand ein silbernes Pferd da mit silbernem Zaum und Sattel, und auf dem Sattel lag die prächtigste glänzendste silberne Rüstung, vollständig vom Scheitel bis zur Sohle, und Alles paßte so gut, als wäre es auf seinen Leib gemacht.
Am Mittag kam der silberne Mann mit seinem Silberpferde an den Glasberg, wo Hunderte und Tausende standen; aber kein Einziger war im Stande, auch nur einige Schritte auf den glatten Berg hinauf zu kommen. Der silberne Reiter drängte sich durch die Menge, ritt ein gut Stück über die Hälfte den Glasberg hinauf, der für die Hufe seines Pferdes wie geschwendetes Land zu sein schien, kehrte um, grüßte den König und war gleich darauf wieder verschwunden. Heute hatten die Leute deutlich gesehen, daß die schlafende Königstochter bei der Annäherung des silbernen Mannes ihren Kopf bewegt hatte.
Die Brüder waren am Abend nach Hause gekommen, und konnten nicht genug Rühmens machen von des silbernen Mannes und seines Silberpferdes wunderbarer Tat, meinten aber doch zuletzt, es könne kein wirklicher Mensch sein, sondern alles sei nur ein Zauberblendwerk. Der jüngste Bruder hörte ihren Reden still zu, ließ sich aber nichts davon merken, daß er selbst der Mann gewesen war.
Am anderen Morgen waren beide älteren Brüder mit Tagesanbruch wieder fort gegangen. An diesem Tage hatte sich noch mehr Volks versammelt, weil heute die sieben Jahre und sieben Tage um waren, nach deren Ablauf die Königstochter aus ihrem langen Schlaf erwachen sollte. Die Sonne stand schon ziemlich hoch, als der jüngste Bruder an des Vaters Grab ging. Er tat nach der Vorschrift und sprach: »Lieber Vater, ich bitte um meinen Lohn für die dritte nächtliche Wacht.« In demselben Augenblicke, wo diese Bitte über seine Lippen kam, stand ein goldenes Pferd da mit goldenem Zaum und Sattel, und auf dem Sattel lag die schönste goldene Rüstung, vollständig vom Scheitel bis zur Sohle, und alles paßte so gut, als wäre es auf seinen Leib gemacht.
Um Mittag kam der goldene Mann mit seinem Goldpferde an den Glasberg, wo Hunderte und Tausende standen, doch kein Einziger war im Stande, auch nur einige Schritte den glatten Berg hinaufzukommen. Weder der eherne Reiter noch der silberne hatten Spuren auf dem Berge zurückgelassen, der glatt geblieben war wie zuvor. Der goldene Reiter drängte sich durch die Menge, ritt den Berg hinauf bis zum Gipfel, und der Berg schien für die Hufe seines Pferdes wie geschwendetes Land zu sein. Als er oben angekommen war, sprang der Deckel des Kastens von selbst auf, die schlafende Königstochter richtete sich empor, zog einen goldenen Ring von ihrem Finger und gab ihn dem goldenen Reiter. Dieser aber hob die Jungfrau auf sein Goldpferd und ritt mit ihr langsam den Berg hinunter. Dann legte er sie in des Königs Arme, grüßte anmutig und war im nächsten Augenblick verschwunden, als wäre er in die Erde gesunken.
Des Königs Freude könnt ihr euch leicht vorstellen. Am anderen Tage hatte er, dem Rat des weisen Mannes zufolge, überall bekannt machen lassen, daß der, welcher der Prinzessin goldenen Ring zurück bringen würde, sein Schwiegersohn werden sollte. Von den Gästen waren die meisten zur Nacht da geblieben, um zu sehen, wie die Sache ablaufen werde. Auch unsere alten Freunde, die älteren Brüder, waren darunter und ließen sich die Bewirtung trefflich munden. Aber ihr Erstaunen war nicht gering, als sie sahen, wie ein schlecht gekleideter Mann, in dem sie bald ihren verschmähten Bruder erkannten, an den König heran trat. Dieser Bettler trug in der Tat den Ring der Königstochter an seiner Hand. Da bereute der König seine Zusage, denn so etwas hatte er nicht ahnden können.
Aber der Zauberer sagte zum Könige: »Der Jüngling, den ihr seines schlechten Aufzuges wegen für einen Bettler haltet, ist der Sohn eines mächtigen Königs, dessen Land weit entfernt liegt. Er wurde drei Tage nach seiner Geburt von einer bösen Frau des Rõugutaja mit einem Bauernsohn vertauscht; dieser starb jedoch schon im ersten Monat, während der gestohlene Königssohn in einer Bauernhütte aufwuchs und seinem vermeintlichen Vater immer gehorsam war.«
Der König war durch diese Auskunft zufrieden gestellt, und ließ einen großen Hochzeitsschmaus anrichten, der vier Wochen dauerte. Später vererbte er alle seine Reiche auf seinen Schwiegersohn. Sobald dieser nur die Bauernkleider abgelegt hatte, benahm er sich gar nicht mehr einfältig, sondern seinem Stande gemäß und als kluger Herr. Seine Einfalt war ihm ja nicht angeboren, sondern das böse Weib hatte sie ihm angetan.
Sonntags zeigte er sich dem Volke in seiner Goldrüstung auf seinem goldenen Roß. Seine vermeintlichen Brüder waren vor Neid und Wut gestorben.
Estland: Friedrich Reinhold Kreutzwald: Estnische Märchen
DAS VERGESSENE KIND ...
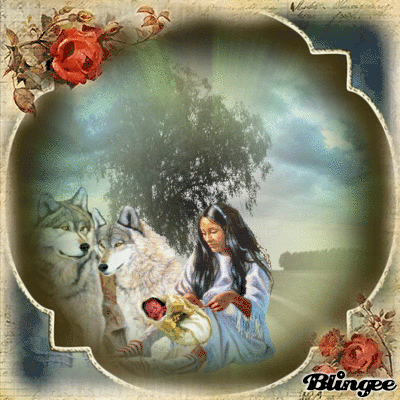
Eine Mutter ging mit zum Mähen in die Wiesen. Alle anderen Frauen hatten ihre Kinder zu Hause gelassen. Sie aber war erst ein Jahr verheiratet und außerstande, sich in ihrem Glück von dem Kind zu trennen. Darum band sie es in einem Tuch auf dem Rücken und nahm es mit.
Draußen machte sie ihm ein weiches Bett von Gras, im Schatten einer Birke. Alle drei Stunden kam sie und tränkte es. Jedes mal richtete sie das Bett so, dass es mit dem Schatten des Baumes weiter rückte.
Es war ein heißer Tag. Als ein Gewitter schwarz heranzog, eilten alle, möglichst viel Arbeit hinter sich zu bringen. Am Abend waren sie schon ein gutes Stück von der Birke abgekommen. Ganz klein und fern stand die Birke am Horizont. Aber die Mutter sah immer dahin und lachte und sang dazwischen mit den anderen Frauen, trotz des Schweißes, der ihr vom Gesicht rann.
Als Feierabend gemacht wurde und man den Rückweg antrat, war die Lustigkeit aufs Höchste gestiegen. Man sang ein Liebeslied. Jede wusste einen neuen Vers. Dann fingen sie an, selber Verse hinzu zu dichten, die, nach dem eine vorgesungen hatte, alle nach sangen.
Als sie vor den Häusern des Dorfes angekommen waren und im Blitzschein die Männer vor den Türen standen und nach den Frauen ausschauten, fiel es der jungen Mutter ein, dass sie ihr Kind unter der Birke vergessen hatte.
Ohne ihren Mann zu begrüßen, schrie sie auf:>> Herr Jesus!<< und, wie von dem niederschüttenden Regen verfolgt, jagte sie den weiten Weg zurück. Es war schwarze Nacht geworden. Immer nur, wenn ein Blitz vom Himmel traf, zeigten sich die einzelnen Bäume und der ferne Waldrand.
Die junge Mutter lief immerzu, durch Dornen und Sumpfwasser. Ihre Haare hatten sich gelöst, der Sturm trieb sie vor ihrem Gesicht her. Sie lief so schnell, dass sie, ohne die Füße zu bewegen, über den Erdboden hin zu wehen schien.Weil ihr oft Zweige ins Gesicht schlugen, lief sie mit geschlossenen Augen und verlor doch die Richtung der Birke nie.
Wölfe kamen hinter ihr her. Wölfe kamen von beiden Seiten. Sie hörte ihren Atem. Einer war so nahe, dass er nach ihrem Kleid schnappte. Ohne an Furcht zu denken, die Kleider zerrissen, die Haare voller Dornen und Blätter, Knie und Hände blutig gefallen, erreichte sie endlich die Birke.
Im Blitzschein sah sie ihr Kind im Schoß einer Frau liegen, rotbäckig, den Kopf auf die Seite gelegt und im Traum lachend. Die Mutter wollte aufschreien und streckte die Hände aus, aber ohne einen Laut hervor bringen zu können, brach sie in die Knie. Da wich die fremde Frau, die für einen Augenblick nach der Mutter hin sah, vom Kind fort und entwehte wie ein Schatten. Die Wölfe kamen heran gestürzt. Aber statt sich auf die Frau zu werfen, zogen sie, wie auf einen Befehl und aufbellend wie Hunde, die ihren Herrn begrüßten, dem Schatten der Frau nach, bis aller Schatten in der Ferne verhallte.
Als die junge Mutter ihr Kind in die Arme riss, fand sie um seinen Hals ein goldenes Kettchen, zierlicher gearbeitet, als irgendwelche Menschenhände vermöchten. Nur ein uraltes Weib in einem Nachbardorfe wusste, wer die fremde Frau war: Laima, die Göttin der Vorzeit.
Märchen aus Lettland
DER BÖSEN TOCHTER UND DAS WAISENMÄDCHEN ...
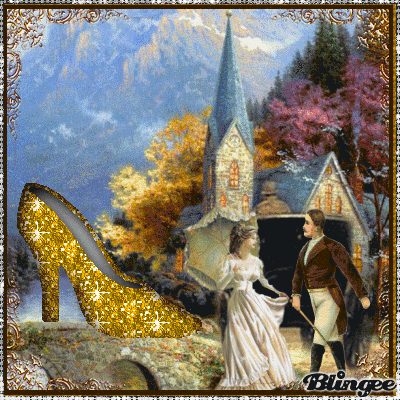
Eine Mutter hatte eine Tochter. Sie lebten und lebten und gingen einmal zu Gast; und da geschah es, daß sie vom Wege abirrten. Die Böse gesellte sich zu ihnen; sie schleppte die Mutter, sie schleppte auch die Tochter hinweg. Sie lebten bei der Bösen; da tötete die Böse die Mutter, kochte sie in einem Kessel und verzehrte sie. Die Tochter weinte und weinte, die Mutter rief: »Kindlein, weine nicht, nimm meine Gebeine und schlag sie in ein weißes Tuch!« Die Tochter sammelte unter dem Tisch der Mutter Gebeine, da kam die Böse hinzu: »Was machst du da? Weshalb ißt du nicht?« - »Ich hab schon an den Knochen genug.«
Am Sonnabend heizte man die Badestube. Die Böse sagte zu ihrer Tochter und zum fremden Mädchen: »Wer von euch ihr Haar schneller trocknet, die nehme ich morgen mit in die Kirche.« Sie gingen in die Badestube, sie wuschen sich rein; der Bösen Tochter drehte sich den Kopf ab und trocknete sich schnell das Haar. Am Sonntag fuhr die Böse mit ihrer Tochter zur Kirche, das Waisenmädchen blieb zu Haus; sie weinte und weinte; da fragten der Mutter Gebeine: »Was ist das, ist es ein warmer Regen?« - »Das ist kein warmer Regen, das sind meine Tränen!« - »Hast du's schwer, Töchterchen?« - »Schwer, schwer, Mütterlein.« - »Geh in den Schweinestall, da wirst du finden, was dich erfreut.«
Die Tochter ging in den Schweinestall: da erhielt sie herrliche Kleider, erhielt goldene Schuhe; vor der Kutsche warteten die Pferde, das Mädchen brauchte sich nur hineinzusetzen und fuhr zur Kirche; sie betete ihre Gebete und eilte wieder nach Haus. Unterwegs schaute ein Bursche: »Woher mag doch dieses schöne Mädchen sein, herrliche Kleider, eine prachtvolle Kutsche?«
Wie die Böse mit ihrer Tochter aus der Kirche kam, war das Waisenmädchen schon bei der Arbeit und fragte: »Nun, was habt ihr in der Kirche Neues gehört, gesehen?« - »Wir haben manches gesehen, was deine Augen nicht gesehen haben: ein Mädchen fuhr zur Kirche, schön war sie, stolz, herrliche Pferde hatte sie vor der Kutsche; wir konnten nicht in ihre Nähe, so drängte sich das Volk um sie; doch sie schaute nicht einmal hin; sie fuhr weg, niemand weiß, wohin.«
So lebten sie und lebten sie, bis wieder der Sonnabend da war. Man heizte die Badestube. Die Böse sagte wieder zu den Mädchen: »Wer von euch schneller ihr Haar trocknet, die werde ich morgen mitnehmen zur Kirche, die andere bleibt zu Haus.« Sie gingen in die Badestube. Der Bösen Tochter machte es natürlich keine Mühe, ihr Haar zu trocknen, sie drehte sich einfach den Kopf vom Leibe und trocknete dann das Haar.
Am Sonntag fuhr die Böse mit ihrer Tochter zur Kirche, die Waise blieb zu Haus. Sie ging wieder zu den Gebeinen der Mutter, sie weinte, weinte sehr bitter; die Gebeine sagen: »Oh, es fällt wohl warmer Regen!« - »O nein, es fallen meine bitteren Tränen!« - »Hast du es denn so schwer, Töchterchen?« - »Schwer, ja, Mütterchen.« - »Nun, tritt in den Schweinestall, da findest du vielleicht, was dich erfreut.« Das Mädchen trat in den Schweinestall und erhielt dort schöne Kleider, goldene Schuhe, eine Kutsche mit prachtvollen Pferden. Das Mädchen setzte sich in die Kutsche, fuhr zur Kirche, betete inbrünstig, betete unter vielen Tränen. Dann fuhr sie wieder dem Hause zu. Der Bursche schaute wieder und spähte: »Wohin mag sie doch fahren?« Nichts sah er, verschwunden war sie; das Mädchen saß schon zu Hause bei der Arbeit.
Die anderen kamen auch bald nach Hause und erzählten, welch eine Pracht sie erschaut; heute seien sie schon etwas näher gekommen. »Du Armselige, du hast gar nichts gesehen!« - »Wo soll ich, arme Waise, weder komm ich zur Kirche noch anderswohin!« Es kam der dritte Sonnabend; man ging in die Badestube; der Bösen Tochter hatte ihr Haar wieder schneller trocken: sie drehte nur den Kopf vom Leibe und trocknete dann. Am Sonntag mußte natürlich die Waise zu Hause bleiben, die anderen fuhren zur Kirche. Die Waise weinte bitter bei der Mutter Gebeinen. Die Gebeine fragten: »Ist das ein warmer Regen?« - »Nein, das sind meine bitteren Tränlein!« - »Geh, Tochter, in den Schweinestall, da erhältst du, was dich erfreuen soll.« Die Tochter ging in den Schweinestall und erhielt noch prächtigere Kleider als früher, erhielt goldene Schuhe; sie setzte sich in die Kutsche, fuhr zur Kirche, betete in der Kirche inbrünstig, betete von ganzem Herzen; wie sie gebetet hatte, fuhr sie wieder dem Hause zu.
Doch der Bursche hatte erspäht, wohin sie fuhr; er versteckte sich unter einer Brücke, und als das Mädchen vorbeifuhr, kam er unter der Brücke hervor und hielt die Pferde an: »Wohin fährst du? Wer bist du?« - »Halte mich nicht an, ich muß schnell nach Hause fahren.« - »Ich komme zu dir auf die Freite!« - »Du wirst mich nicht erkennen!« - »Gib mir einen Goldschuh, wem dieser paßt, die will ich heiraten.« Das Mädchen gab ihm einen Goldschuh. Der Bursche nahm den Schuh und ging auf die Freite: »Wem dieser Schuh paßt, die soll die Meine werden.« Die Böse gab den Schuh ihrer Tochter; dieser paßte der Schuh nicht, ihr Fuß war zu groß. Da nahm die Mutter ein Beil, hieb ihr eine Zehe ab, brachte das Mädchen zum Freier: »Hier ist die Deinige!« Der Bursche nahm sie und erkannte nicht, daß es eine Fremde war.
Schon fuhr er, da sah er: am Wege ein Apfelbaum, voll goldener Äpfel, ein kleiner See, goldene Fische darin. Diese Apfelbäume, diese goldenen Fische - alles war entstanden aus den Eingeweiden der Mutter des armen Mädchens, als die Böse sie getötet hatte. Der Freier erblickte die Äpfel, die Fische und sagte: »Wer mir einen Apfel holt, wer mir einen Fisch holt, die will ich heiraten.« Die Tochter der Bösen ging, um das Verlangte zu holen, konnte es aber nicht: der Apfelbaum schlägt sie, der Fisch schwimmt weit weg in den See. Da kam das Waisenmädchen, nahm den Apfel, nahm das Fischlein, gab sie dem Freier und sang selbst dazu:
»Bringet als letzte,
haltet für die geringste -
werfet nieder meinen Goldschuh!«
Der Freier erkannte die Seinige, er hielt an, warf der Bösen Tochter in den See und nahm das Waisenmädchen mit sich.
Nach einiger Zeit begab sich die Böse zur Tochter, um zu sehen, wie es mit der jungen Frau Gesundheit stehe. Als sie zum See kam, sah sie: unter der Brücke wuchs ein hoher Rohrstengel hervor; dieser war entstanden aus der Tochter Nabel. Die Böse dürstete; als sie unter die Brücke ging, um ihren Durst zu löschen, da sang das Rohr:
»Mütterchen, Mütterchen,
reiß mich aus der Erde,
Mütterchen, Mütterchen!«
Die Mutter erkannte, wer das sang; sie riß das Rohr heraus, und die Tochter war sofort am Leben. Dann fuhren sie zum Schwiegersohn; da stillte die Mutter gerade ihr kleines Kindlein. Die Böse warf der Frau eine Wolfshaut über; die Frau wurde zur Wölfin und lief weg in den Wald. Die Böse bettete unter die Decke statt der Frau ihre eigene Tochter, doch diese hatte dem Kinde keine Nahrung zu bieten; das Kind schrie, es schrie so, daß es traurig anzuhören war. Die Hirtin aber hatte dieses alles gesehen, sie nahm das Kind, trug es zum Walde und sang:
»Mütterchen, Mütterchen,
komm und biet die Brust dem Kindlein!
Judas läßt dein Kindlein saugen
morgens an dem Stuteneuter,
mittags saugt es an der Spindel!«
Eine Wölfin kam aus dem Dickicht und warf ihre Haut auf einen Stein; es war des Kindes Mutter; sie bot ihrem Kind die Brust und verschwand dann wieder im Walde. Am zweiten Tage brachte die Hirtin das Kind wieder zum Walde, um es stillen zu lassen. Sie sang:
»Mütterchen, Mütterchen,
komm und biet die Brust dem Kindlein!
Judas läßt dein Kindlein saugen
morgens an dem Stuteneuter,
mittags saugt es an der Spindel!«
Wieder kam die Wölfin aus dem Walde, warf ihre Haut auf den Stein, stillte das Kind und verschwand darauf. Doch der Mann hatte es zufällig gesehen; er kam zur Hirtin: »Was ging hier vor sich?« Die Hirtin entdeckte ihm alles: »Zwei Personen kamen zu dir zu Gast, die andere blieb, deine Frau wurde in eine Wölfin verwandelt.«
Der Mann ging, um sich das Los werfen zu lassen; wie die Weise ihn lehrte, so führte er es aus: er brannte den Stein heiß, brannte ihn glühend. Die Frau kam wiederum ihr Kind stillen; sie warf die Wolfshaut auf den Stein, diese verbrannte sofort. Der Mann hatte wieder seine Frau und brachte sie nach Hause; doch der Bösen Tochter erschlug er mit dem Schwert.
Da fing er wiederum mit seiner Frau an zu leben, und die Böse kam nicht mehr, um ihnen nachzustellen.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER GEIZIGE KÖNIG ...
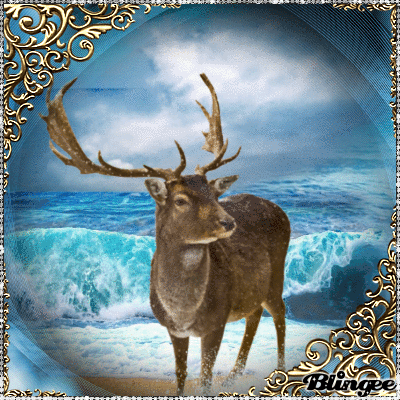
Es war einmal ein König. Das war solch ein Geizhals - keinem Bettler gab er jemals etwas, sondern sagte nur immer, die Bettler sollten arbeiten gehen und sich Geld verdienen.
Neben seinem Schloß befand sich ein großer Park, und dahin verirrte sich einmal ein großer Hirsch. Der König wollte den Hirsch erlegen und begann auf ihn zu schießen, traf ihn aber nicht, und der Hirsch flüchtete ins Meer. Der König zog sich nackt aus und fing an, den Hirsch im Wasser zu verfolgen. Die Kleider des Königs blieben am Ufer liegen, es kam ein Dieb hinzu und trug sie fort - und auf diese Weise blieb der König nackt. Den Hirsch aber hatte er gefangen; so nahm er nun dessen Fell, hüllte sich ein und ging nach seinem Schloß zurück; doch die Wachen ließen ihn nicht mehr hinein - sie glaubten nicht, daß er ihr König sei.
Bald begann der König Hunger zu spüren; es half nichts anderes - er mußte dienen gehen. Er verdingte sich also bei einem Bauern als Knecht. Dort mußte er aber sehr früh aufstehen und zur Arbeit gehen. Daran war er nicht gewöhnt und schlief länger. Nun, der Bauer gab ihm auch keine Arbeit mehr, sondern jagte ihn fort. Darauf bot der König sich einem anderen Bauern als Pferdehirt an; er dachte, dies sei eine leichte Arbeit, blieb aber wieder schlafen, die Pferde liefen in den Weizen, und der Bauer jagte ihn wieder fort. Dann wurde er Schweinehirt, aber auch die Schweine gingen bald in die Kartoffeln und bald in die Erbsen, und der Bauer jagte den Hirten fort.
Schließlich fand der König nirgends einen Dienst mehr. Er wanderte nun einsam seinen Weg; da kam ihm ein blinder Bettler entgegen und klagte, er habe niemand, der ihn zum Schlosse des Königs leite, wo eine große Bettlerbewirtung zu erwarten stehe. Nun ging der König als Wegweiser des Bettlers hin und wurde auch mit dem Bettler zusammen ins Schloß eingelassen. Dort war ein König, der saß mit den Bettlern an einem Tisch und aß mit ihnen zusammen. Der fragte den geizigen König: »Hast du nun gelernt, König zu sein?« Und er selber stand auf und ging hinaus und ließ ihn an seiner Stelle wieder als König zurück.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen - Livische Märchen
DER BETTLER UND DIE REICHE BÄUERIN ...
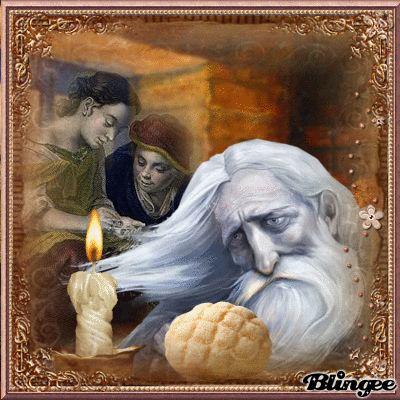
Es kam einmal auf einen Bauernhof ein Bettler und bat um ein Nachtlager. Die Bäuerin jagte aber den Bettler kreischend und schimpfend davon. Der Bettler machte, daß er davon kam, denn die Bäuerin drohte, die Hunde auf ihn zu hetzen.
Der Bettler ging zu einer armseligen Hütte und bat auch dort die Hausfrau um ein Nachtlager. Die Frau sprach: »Wohin wirst du Armer gehn! Komm nur herein! Ich habe freilich selbst nur wenig Brot, aber einem Armen muß man immer etwas abgeben!«
Als der Bettler in die Stube kam und die Kinder der armen Bäuerin sah, da fragte er: »Warum haben deine Kinder so schrecklich schmutzige Hemden an?« Die Bäuerin antwortete: »Ich bin eine arme Witwe und habe fünf Kinder zu ernähren. Soviel Geld hab' ich nicht, daß ich jedem zwei Hemden anschaffen könnte!« Darauf erwiderte der Bettler nichts.
Als die Abendmahlzeit kam, wurde er zum Essen gerufen. Er sagte aber, er sei krank, und kam nicht. Am Morgen legte der Bettler das Brot aus seinem eigenen Sack auf den Tisch und sprach: »Was du zu tun anfängst, das tu bis zum Abend!«
Das arme Weib begriff die Worte des Bettlers nicht. Sie hatte etwas Leinwand und dachte: 'Vielleicht reicht es doch wenigstens einem Kinde zu einem Hemd.' Sie ging ins Dorf, um ein Ellenmaß zu suchen und damit die Leinwand zu messen, ob sie auch zu einem Hemde reiche oder nicht.
Sie bekam das Ellenmaß. Als sie nach Hause kam, sagte sie: 'Wenn schon der Bettler sagt, daß meine Kinder zu zerlumpt sind, was mögen da erst die anderen Leute sagen!' Als sie nach Hause kam, ging sie sogleich zur Vorratskammer. Aber wie erschrak sie, als sie die Tür nicht aufmachen konnte! Schließlich sprengte sie die Tür mit einer Stange auf. Aber was sah sie da! Die Kammer war voll von Leinwandrollen. Da begann die Frau sogleich, die Leinwand zu messen. Am Abend, als die Sonne unterging, war sie mit dem Messen des letzten Stückes fertig. Nun erst begriff sie die Worte des Bettlers. In der Eile des Messens hatte sie nicht einmal Zeit gehabt nachzudenken, woher all dieses Zeug plötzlich in ihre Vorratskammer gekommen sei.
Am Abend, als sie das Ellenmaß zurückbrachte, erzählte sie der reichen Bäuerin, wie sie auf das Wort des Bettlers hin unendlich viel Leinwand bekommen habe. Als die reiche Bäuerin das hörte, sprach sie zum Knecht: »Spann rasch das Pferd an und hol uns den Bettler her! Den Armen muß man immer helfen.« Der Knecht mußte fahren. Als er am nächsten Tage den Bettler auffand, wollte dieser zuerst nicht kommen. Als der Bettler aber hörte, daß der Knecht den strengen Befehl habe, ohne ihn nicht zurück zu kehren, setzte er sich in den Wagen und fuhr mit.
Die Bäuerin nahm den Bettler diesmal mit der größten Freundlichkeit auf. Sie überließ dem Bettler ihr eigenes Lager und gab ihm zu essen und zu trinken. Nun hatte der Bettler ein goldenes Leben. Er aß, trank und schlief, soviel er nur konnte. Ans Fortgehen dachte er überhaupt nicht mehr. Die Geduld der Bäuerin fing aber schon an, zu Ende zu gehen. Fortjagen konnte sie den Bettler freilich nicht, denn dann wäre ja alles umsonst gewesen.
Zur Freude der Bäuerin machte sich der Bettler am Morgen des vierten Tages auf den Weg. Die Bäuerin ging hinaus, ihn zu geleiten. Als der Bettler schon zum Tore hinausgehen wollte, fragte ihn die Bäuerin: »Was werd' ich heute zu tun anfangen?« Der Bettler antwortete: »Was du zu tun anfängst, das tu bis zum Abend!« Die Bäuerin ging in die Stube, um das Ellenmaß zu holen und sich ans Leinwandmessen zu machen. Plötzlich wurde es ihr aber notwendig, ihren Magen zu erleichtern. Damit mußte sie sich nun bis zum Abend beschäftigen. Erst nach Sonnenuntergang kam sie in die Stube zurück.
Sie hatte den Bettler mehrere Tage gefüttert - und gar nichts dafür bekommen! Die Habsucht hatte sich selbst gestraft.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DAS KLUGE WEIB ...
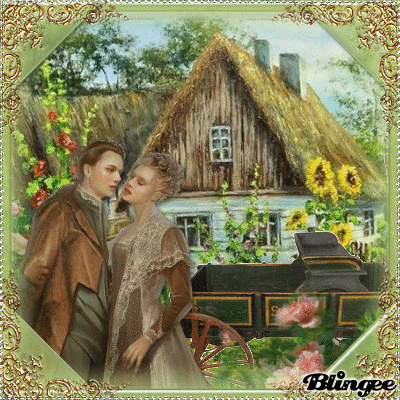
Es war einmal ein reicher Mann und ein armer Mann. Der Reiche hatte ein großes Stück Land und der Arme ein kleines, dafür aber viele Kinder. Nun grub der Arme um sein eigenes Land einen tiefen Graben, damit seine Kinder nicht aufs Land des Reichen gehen sollten. Einmal ließ der Reiche seine Kuh weiden. Die Kuh ging in den Graben, um Wasser zu trinken, und brach sich ein Bein. Der Reiche ging auf das Gericht klagen, aber das Gericht konnte in der Sache kein Urteil fällen. Da sagte der Richter, er wolle drei Rätsel aufgeben; wer sie in drei Tagen zu raten vermöge, der habe den Streit gewonnen. Und diese drei Fragen waren: Wer ist der Reichste? Wer kann am schnellsten laufen? Und was ist das Süßeste?
Nun kam der arme Mann in Sorgen nach Hause. Er hatte aber eine erwachsene Tochter, und die fragte ihn: »Was für eine Sorge hast du?« Der Vater erzählte die Sache, und die Tochter antwortete: »Vater, sei nur ganz ruhig.« Und die Tochter lehrte ihn, was er antworten solle. Nach drei Tagen gingen der Arme und der Reiche zum Richter. Dieser fragte sogleich: »Nun, wie steht es mit den Rätseln?« Der Reiche beeilte sich, sofort mit Eifer zu antworten: »Der Reichste, das seid Ihr selbst, Herr Richter; am schnellsten laufen kann der Hengst, den ich zu Hause habe; und ich habe so viel Honig, daß die ganze Kleete davon voll ist - aber Süßeres als Honig gibt es nichts.« Darauf antwortete der Arme: »Der Reichste ist Gott; am schnellsten laufen können die menschlichen Gedanken; und das Süßeste ist der Schlaf.«
Nun sprach der Richter: »Du hast recht!« Doch fragte er den Armen, wer ihn diese Weisheit gelehrt habe. Dieser antwortete: »Meine Tochter.« Da sprach der Richter: »Nun, wenn deine Tochter so klug ist, so soll sie morgen zu mir kommen, nicht bekleidet und nicht nackt, nicht zu Pferd und nicht zu Fuß, nicht auf dem Wege und nicht am Rande des Weges; ihr Pferd binde sie zwischen dem Winter und dem Sommer an, und 'Guten Tag' sage sie weder draußen noch in der Stube.«
Nun war der arme Mann noch mehr in Sorgen. Er ging nach Hause und sagte zur Tochter, jetzt sei es mit ihm aus. Die Tochter fragte, was ihm fehle, und der Vater erzählte, auf welche Weise die Tochter zum Richter kommen sollte. Die Tochter lachte nur und sagte, der Vater möge sich keine Sorgen machen. Am anderen Tage wickelte die Tochter sich in ein Netz - und war also weder bekleidet noch nackt; dann nahm sie einen Ziegenbock und bestieg ihn, aber ihre Füße berührten den Boden - also war sie weder reitend noch zu Fuß; der Bock ging, indem er den einen Fuß auf den Wegrand, den anderen auf den Weg setzte - so war es also weder das eine noch das andere; den Bock band sie auf dem Hofe des Richters zwischen einem Schlitten und einem Wagen an - so befand er sich also zwischen Winter und Sommer; und den Richter grüßte sie, während sie mit dem einen Fuß dies seits, mit dem anderen jenseits der Schwelle stand. Und so sah der Richter, wie klug das Frauenzimmer war. Er befahl, ihr schöne Kleider anzuziehen, damit ein Diener sie heirate. Aber als das Mädchen schöne Kleider angelegt hatte und der Herr es ansah, da gefiel es ihm selbst sehr gut, und er heiratete es selber.
Nach der Hochzeit ging der Herr von Hause fort und verbot seiner jungen Frau, jemandem Recht zu sprechen, und er drohte, sie fortzujagen, wenn sie das Verbot nicht hielte. Als der Herr fort war, kamen zwei Männer aufs Gericht. Der eine hatte vom anderen ein Wagenrad geliehen und wollte irgendwohin fahren, in der Nacht aber warf die Stute ein Füllen, und am Morgen konnte er nirgends hinfahren. Er brachte das Rad zurück, doch der andere verlangte Bezahlung: »Wenn er das Rad nicht gegeben hätte, so hätte auch die Stute kein Füllen gehabt.« - Und die Frau des Richters sprach den beiden das Urteil.
Nun kam der Richter nach Hause und sagte, die Frau solle sich jetzt packen, weil sie dem Verbot nicht gehorcht habe; aber einen Gegenstand dürfe sie noch mitnehmen. Da bat das Weib: »Könnten wir nicht ebenso, wie zur Hochzeit, alle Verwandten zusammen rufen, ihnen Speisen und Getränke vorsetzen und danach voneinander scheiden?« Nun, der Herr ging auch darauf ein und rief die Verwandten zusammen. Alle kamen, aßen und tranken, die Frau aber bewirtete ihren Mann fortwährend mit Schnaps, bis der Herr betrunken war. Da nahm die Frau einen kleinen Karren, auf dem im Garten Sand geführt wurde, legte den Richter hinein und karrte ihn ins Haus ihres eigenen Vaters hinter den Ofen, selbst aber legte sie sich nebenbei schlafen.
In der Nacht fragte der Herr, an welchem Ort er sich befinde. Die Frau antwortete: »Schlaf nur, du wirst es schon am Morgen sehn!« Der Herr fragte zum zweitenmal, an welchem Ort er sich befinde. Da sagte die Frau: »Du befindest dich hinter dem Ofen meines Vaters.« Der Herr fragte: »Wie bin ich denn hierher geraten?« Die Frau antwortete: »Natürlich habe ich dich hergebracht. Du erlaubtest mir ja, einen Gegenstand mitzunehmen, ich fand, daß der wertvollste Gegenstand du bist, und nahm dich mit.« Der Herr stand auf, nahm seine Frau unter den Arm und ging auf sein Gut zurück und freute sich, daß er eine so kluge Frau hatte.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen - Livische
JOKIMA UND SEIN VATER GRUMPIS ...
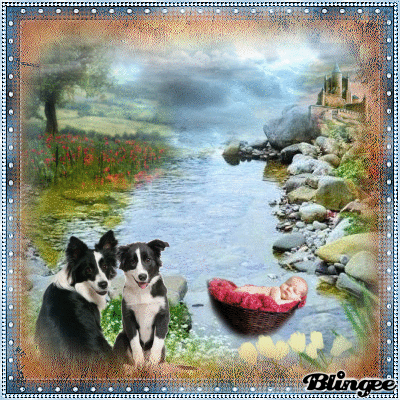
Grumpis war ein reicher Bojare. Er wohnte nicht weit von der Stadt Veliuona am Nemunas (Njemen). Als ihm sein erster Sohn geboren wurde, gab er ihm den Namen Jokimas. Aber als der Sohn gerade geboren war, fing er zu der selben Stunde an, mit lauter Stimme zu lachen. Und der Vater fragte: "Mein Sohn, warum lachst du verständig wie ein Großer?" Und der Sohn sagt: "Wenn ich groß bin, dann wirst du, Vater, mir Wasser zum Gesicht waschen bringen und meine Mutter ein Handtuch zum Abtrocknen!" Und nachdem er das gesagt hatte, sprach er nichts mehr, und sein Verstand war so wie bei allen kleinen Kindern. Aber der Vater nahm diese Worte übel auf und sagte zu seiner Frau: "Hast du gehört, was unser Sohn gesagt hat? Wenn er groß geworden ist, dann sind wir ein Nichts! Am besten, wir schaffen ihn uns jetzt gleich vom Halse!"
So flocht er aus Binsen einen kleinen Wiegenkorb und warf das Kindlein in den Nemunas. Es schwamm Strom ab nach Rusne unweit der preußischen Grenze. Da jagten gerade zwei Söhne eines Bojaren, und als ihre Hunde den Wiegenkorb in Ufernähe auf dem Wasser sahen, fingen sie an zu bellen. Darauf gingen die beiden Bojarensöhne hin, um nach zu sehen. Und als sie einen schönen kleinen Jungen fanden, trugen sie ihn nach Hause. Seinen Namen fanden sie auf einem Stück Papier, das in den Korb gelegt war - Jokimas ist sein Name.
Da zogen die Bojaren ihn groß und unterrichteten ihn wie ihre eigenen Söhne. Als er schon zwanzig Jahre alt war, ging er immer auf die Jagd, denn dieses Handwerk hatte er ja gelernt. Einmal, als sein zwanzigstes Jahr begonnen hatte, geschah es, dass er allein zur Jagd auszog. Doch da er in der Nähe des Hauses kein Wild fand, ging er tiefer hinein in die Wälder. Er geriet in ein großes Dickicht, ging vergebens hier hin und dort hin und begriff schließlich, dass er sich verirrt hatte. Als er auf einem Baum ein Rabenweibchen sah, wollte er auf sie schießen, doch sie sagte: "Lieber Jokimas, schieße nicht auf mich!"
Und sofort ließ sich das Rabenweibchen vom Baum herab, flog ihm zu Füßen und hieß ihn mit ihr gehen: "Komm", sagte sie, "fürchte dich nicht davor, wohin ich dich führen werde. Ich bin eines reichen Fürsten Tochter in einem verwunschenen Schloss. Doch dir war es schon bestimmt, als du noch nicht geboren warst, ich werde deine Frau, und du wirst einen großen Palast mit einer Stadt haben, aber drei Nächte lang werden dich Teufel furchtbar quälen und peinigen. Doch du selbst wirst nichts spüren: ich werde an deiner Stelle leiden. Es wird dir nur so scheinen. Sie wollen dich zum Sprechen bringen, aber du musst schweigen, auch wenn du viele Qualen dadurch erdulden musst, dass du Schreckliches mit ansiehst. Doch fürchte nichts, ich werde alles für dich vollbringen."
Indem sie so sprach, führte das Rabenweibchen Jokimas zu einem hohen Berg. Der Berg tat sich auf wie eine Tür, und sie gingen hinein. In der Erde fand er ein Schloss. Dort gab es Gold und Silber, doch herrschte eine schreckliche Finsternis. Als sie nun Jokimas hineingeführt hatte, gab sie ihm den ganzen Tag zu essen und zu trinken wie dem vornehmsten Herrn, doch am Abend musste sie hinausgehen und Jokimas allein den Qualen überlassen. Und sie schärfte ihm ein, zu schweigen und nichts zu sagen, was auch immer vor seinen Augen geschehen würde. Sie ging also hinaus, und er blieb allein zurück.
Da kamen um die neunte Abendstunde von allen Seiten die Teufel herbei geflogen und fingen an ein wildes Fest zu feiern. Doch als sie Jokimas entdeckten, begannen sie ihn zu schlagen und zu bespeien. Das taten sie bis zum ersten Hahnenschrei, und danach verschwand der Spuk plötzlich. Als aber Jokimas von den Teufeln geschlagen wurde, schwieg er und sagte kein Sterbenswörtchen. Am Morgen kam das Rabenweibchen - von den Füßen bis zum Gürtel war sie ein Mensch geworden. Und die anderen Gemächer, in denen Verwunschene mit den Dienern eingeschlossen waren, auch die taten sich von selbst auf, und alle Diener, Lakaien und Zimmerjungfern waren bis zum Gürtel weiß. Und alle verwunschenen Dinge wurden schöner.
So nahte die zweite Nacht. Wieder bat die Jungfrau Jokimas, dass er schweigen und kein Sterbenswörtchen sagen sollte, denn in der zweiten Nacht gäbe es noch größere Qualen. Und als sie so gesprochen hatte, ging sie wieder hinaus. Um die neunte Stunde kamen die Teufel wieder in Scharen angeflogen, alle Gemächer voll, und als sie dort Jokimas fanden, wollten sie ihn hinausjagen. Doch er ging nicht. Da fingen die Teufel an ihn zu würgen, ihn mit Hühnermist zu bewerfen und mit Ahlen und Nadeln zu stechen. Und das taten sie bis zum ersten Hahnenschrei. Als die Hähne aber zu krähen anfingen, da ließen sie von ihm ab, und alle Teufel verschwanden. Die Jungfrau kam und war bis unter die Arme weiß, aber der Kopf war noch der eines Rabenweibchens. Nun, sie dankte für seine Leiden und bat ihn um Standhaftigkeit für die letzte, dritte Nacht, dass er sein Schweigen nicht brechen möge.
Als die dritte Nacht schon begonnen und sie ihn allein gelassen hatte, da kamen zur neunten Stunde wieder die Teufel angepoltert. Voll waren alle Gemächer! Und als sie Jokimas entdeckten, marterten sie ihn, hackten auf ihn ein und verwundeten ihn immer wieder auf neue Weise. Sie kochten ihn im Kessel und sagten immerzu: "Warum schweigst du denn jetzt, und warum sprichst du nicht mit uns?"Doch als der erste Hahn krähte, da erdröhnte der ganze Palast wie von einem furchtbaren Donnerschlag und stieg aus der Tiefe der Erde nach oben. Und die ganze Stadt, die in den Schoß der Erde gesunken war, stieg auf, heil und gesund und voller Freude. Und sie, die ein Rabenweibchen gewesen war, wurde nun vor Jokimas' Augen die aller schönste Jungfrau, die jetzt seine Gemahlin werden wollte. Und aus allen Gemächern - von denen es zwanzig gab, und alle diese Gemächer waren voll von allerlei Dienern und Lakaien - sie kamen alle, um sich grüßend vor ihr zu verneigen und für die Erlösung zu danken. Und alle wollen ihn sehen und ihm die Hand küssen.
In großer Liebe zu ihrem Jokimas zog die Jungfrau ihm Kleider an, die glänzten wie die Sonne, so wie sie selbst der weiseste, stolzeste und ruhmreichste König nicht haben konnte. Und nun gedachte Jokimas zu seinem Vater zu Besuch zu fahren; er wusste aber nicht, in welchem Lande der Welt dieser Grumpis lebte. Und so versprach er seiner Jungfrau: "Wenn ich vom Besuch bei meinen Eltern zurückkomme, dann heirate ich dich, dann veranstalten wir ein Hochzeitsfest!" Weil er nun zu seinen Eltern reisen wollte und damit er bald zu ihnen käme, gab die Jungfrau ihm jetzt ein besonderes kleines Kissen, wenn man sich nur darauf setzte, ritt man gleich in einer Minute fünfzig Meilen. Und sie gab ihm eine Nadel, wenn man die in der ausgestreckten Hand hielt, dann zeigte sie den Weg. Und sie gab ihm noch ein Hütchen, wenn du es dir auf den Kopf setzt, dann kann dich niemand sehen, bis du es wieder ab nimmst.
So reiste er nun los zu seinem Vater. Und er zeigte sich seinen Eltern, sagte ihnen, was er nun war, wies seine prächtigen Kleider vor, und welches Glück er hatte, alles erzählte er. Als der Vater und die Mutter ihren Sohn in so prächtigen Kleidern sahen, da wussten sie gar nicht, wie sie bei ihm schön tun sollten! Früh am Morgen, als der Sohn aufgestanden war, brachte ihm sein Vater sofort Wasser und die Mutter ein Handtuch zum Abtrocknen des Gesichts nach dem Waschen. Und so erfüllte sich jetzt das, was er gleich nach der Geburt unter Lachen gesagt hatte, dass ihm der Vater Wasser bringen würde und die Mutter ein Handtuch.
Schließlich beendete Jokimas seinen Besuch und verabschiedete sich von den Eltern, denn er wusste, dass die Jungfrau auf seine Rückkehr wartete. Doch als er zurückkehrte, konnte er den Palast nirgends finden! Da flog er zur Sonne und fragte sie, ob sie nicht wisse, wo der Palast wäre. Da sagte die Sonne: "Ich kann durch meinen Lichtglanz nicht so weit sehen - geh zum Mond!" Doch als er den Mond fragte, sagte der wiederum: "Auch ich habe durch meinen Glanz nichts sehen können. Geh zu den Wolken, die wandern herum und können es vielleicht wissen!" Und als er zu den Wolken flog, sagten sie ihm die Wahrheit: "Geh, Jokimas, geh schnell nach Hause, denn deine Jungfrau ist schon mit einem anderen einig geworden, und morgen schon soll die Trauung sein! Und wenn du den Palast finden willst, dann geh da und dort hin."
Als er von den Wolken erfahren hatte, wo sich der Palast befindet, flog er geradewegs dorthin, und schon traf er den jungen Mann am Tisch, wie er mit der Jungfrau trank. Da setzte sich Jokimas sorgfältig das Hütchen auf den Kopf, damit man ihn nicht sah, und schob sich vorsichtig auch an den Tisch, wo der Jüngling mit der Jungfrau saß. Und Jokimas setzte sich neben den jungen Mann. Und immer, wenn dem Jüngling etwas zu trinken gereicht wird, verschwindet das Getränk aus dem Gefäß; jedes Mal trinkt er, der neben ihm sitzt, alles aus, und der andere bekommt nichts. Und als sie zu essen auftrugen, da füllte sich der Jüngling den Teller voll, doch als er essen wollte, leerte sich der Teller vor seinen Augen. So blieb er an diesem Abend ohne Speise und Trank.
Am nächsten Morgen fuhren sie zur Trauung. Und Jokimas ging hinter ihnen her, das Hütchen auf dem Kopfe. Und als der Priester am Altar sie trauen wollte, da gab er, der neben dem Jüngling stand, dem Pfarrer eine kräftige Ohrfeige und dem jungen Mann auch. Da fuhr der Pfarrer sofort auf den Jüngling los: "Warum schlägst du mich?" Und der Jüngling ging auf den Pfarrer los - so lagen sich denn beide am Altar in den Haaren, und die Menschen stürzten herbei, sie zu trennen. Sie prügelten den Jüngling aus der Kirche hinaus, aber Jokimas nahm seinen Hut vom Kopf und zeigte sich seiner Braut.
Als sie ihn erblickte, fiel sie ihm sofort zu Füßen und umschlang seine Knie. Da bezeugten alle, dass dieser der Richtige sei, der sie aus der Verzauberung erlöst hatte. Und der Priester traute beide mit großer Freude. Als sie aber nach der Trauung zum Palast gefahren kamen, freute sich der ganze Hof und die ganze Stadt, dass sie einen neuen Fürsten bekommen hatten, der die Leute regieren würde bis ans Ende seines Lebens.
Quelle: Märchen aus Litauen
DER DIEBSLEHRLING ...
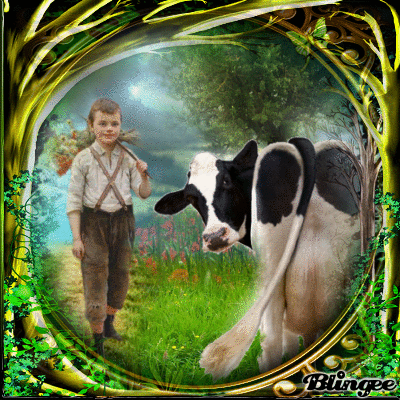
Es waren einmal zwei Brüder. Der eine war ein Landmann, der andere aber ein Dieb. Der Landmann war verheiratet und Vater dreier Söhne, der Dieb dagegen hatte weder Frau noch Kind und wünschte deshalb, einen Neffen als Pflegesohn aufzunehmen, wobei er versprach, ihn sein Handwerk zu lehren.
Zu aller erst nahm er seinen ältesten Neffen mit, um zu erproben, ob er zu seinem Pflegesohn tauge. Er brachte den Jungen zu sich und führte ihn in den Wald. Dort zeigte er seinem Neffen die Bäume und den Wald selbst. Als sie im Walde vorwärts schritten, kamen sie zu einer freien Fläche. Der Neffe sah diese Fläche und sprach zum Onkel: »Schau, Onkel, was für eine schöne Fläche das ist! Ein guter Acker kann draus werden!« Da sagte der Onkel zum Neffen: »Du kannst mein Handwerk sicher nicht erlernen, du bist zum Landmann geboren!«
Darauf brachte er seinen ältesten Neffen wieder nach Hause und nahm nun den mittleren Neffen mit, um ihn zu prüfen, führte ihn ebenso in den Wald und zeigte ihm die Bäume. Als der Knabe im Walde die Eschen und Birken sah, sprach er zum Onkel: »Wachsen da aber schöne Bäume! Daraus könnte man gute Wagenspeichen und Schlittensohlen machen.« Diesen Neffen brachte der Onkel ebenso wie den ersten nach Hause zurück und sagte: »Der kann mein Handwerk nicht erlernen, der ist schon ein fertiger Zimmermann!«
Nun kam die Reihe an den jüngsten Neffen. Den führte er ebenso in den Wald und zeigte ihm die Bäume wie auch seinen zwei älteren Brüdern. Als sie im Walde vorwärts schritten, kamen sie zu einer krummen Birke. Als der Knabe die krumme Birke sah, sprach er zum Onkel: »Sieh doch, Onkel, was für eine schöne krumme Birke hier wächst, daraus könnte man einen guten Knüttel machen, um damit anderen Leuten auf den Kopf zu hauen!« »Nun sieh mal an, dieser Junge paßt mir, den kann ich mein Handwerk lehren!« sagte der Onkel und führte dann den Neffen in seine Diebeshöhle und lehrte ihn seine Kunst. Als er manch schönes Jahr beim Onkel verlebt und seine Kunst erlernt hatte, stellte ihn der Onkel auf die Probe, ob er in seinem Handwerk auch geschickt sei.
Eines Tages, als er mit seinem Onkel vor dem Eingang der Höhle saß, sahen sie, wie eine Frau mit einer Kuh durch den Wald ging. Als der Onkel die Frau erblickte, sprach er zu seinem Neffen: »Junge, jetzt gehst du augenblicklich hin und stiehlst dieser Frau ihre Kuh, ohne daß die Frau es merkt.« Der Junge ging hin und dachte bei sich: 'Wie kann ich armer Mensch das zuwege bringen! Jetzt sitze ich in der Klemme!' Schließlich kam ihm aber doch ein guter Gedanke. Er lief auf dem Wege voraus, wo die Frau vorbei kommen mußte, und warf dort einen Handschuh zur Erde. Die Frau kam, sah am Wegrand auf der Erde einen Handschuh liegen und sprach: »Sieh mal, da liegt auf dem Boden ein neuer Handschuh. Wären es ihrer zwei, so würde es sich lohnen, sie aufzuheben, was fängt man aber mit dem einen an!«
Sie ließ den Handschuh liegen und ging ihres Weges. Inzwischen lief aber der Junge, eine Wegkrümmung abschneidend, voraus und warf dort den anderen Handschuh hin. Die Frau kam auch an der zweiten Stelle vorbei, sah auf der Erde den anderen Handschuh liegen und sprach: »Sieh doch, da liegt der zweite gleiche Handschuh hier am Boden wie der erste dort. Das gibt ein schönes Paar Handschuhe; ich geh, auch den ersten von dort zu holen!« Mit diesen Worten band sie die Kuh am Rande des Wegs an einen Baum und ging nach dem anderen Handschuh.
Der Junge band nun die Kuh vom Baum los und führte sie zu seiner Höhle. Daheim wurde die Kuh sogleich geschlachtet. Dann ging der Junge zur Höhle hinaus, um an dem Ufer eines kleinen Baches den Magen und die Gedärme der Kuh zu reinigen. Als er sich draußen befand und den Kuhmagen und die Gedärme reinigte, begann er mit sich selbst zu sprechen, indem er den Magen gegen die Steine schlug: »Ai, oi, ich bin es nicht allein gewesen, mein Onkel war auch dabei! Aii, oii, ich bin es nicht allein gewesen, mein Onkel war auch dabei!« Als der Onkel in der Höhle die Worte des Jungen hörte, dachte er, der Junge werde draußen geprügelt und ihn selber werde man auch festnehmen und dem Gericht übergeben. Da floh er schnell aus jenem Lande, ohne genauer nachzusehen, wie die Sache stand, und seine Schätze blieben alle in den Händen des Neffen.
Da gab der Neffe von jenem Tage an das vom Onkel erlernte Handwerk, das heißt das Stehlen, auf, und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er noch heute in großen Ehren und Reichtum.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
WARUM DER SCHWARZSPECHT AUF DIE BÄUME HACKT ...
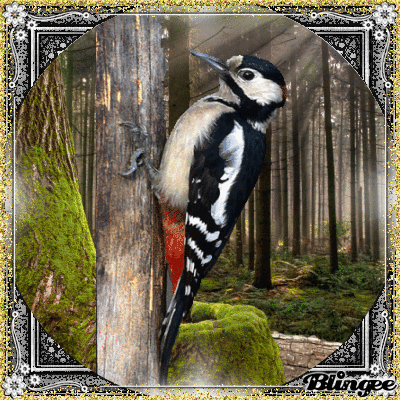
In alten Zeiten säten der liebe Gott und der Teufel einmal gemeinschaftlich Schnittkohl. Nach der Aussaat stellte Gott dem Teufel frei, zu wählen, was er ernten wolle, den unteren oder den oberen Teil. Der Teufel wünschte den oberen. Gut! Gott gab dem Teufel die Blätter, aber er selbst fing an, den Schnittkohl zu essen. Als der Teufel sah, mit welchem Appetit Gott den Schnittkohl verspeiste, bat er, er möge ihn von seinem Teil versuchen lassen. Der Teufel fand den Schnittkohl sehr schmackhaft, und in der Absicht, ihn mit List zu gewinnen, sagte er: 'Laß uns auf den Schnittkohl wetten, daß ich imstande bin, dich zu erschrecken.' 'Gut - warum nicht!' antwortete der Herr. Der Teufel entfernte sich von dem Feuer, das sie im Walde angezündet hatten, um den Schnittkohl zu braten, und verursachte einen so starken Wind, daß der ganze Wald anfing zu krachen. Nach einiger Zeit kehrte er zum Feuer zurück und sah Gott in aller Ruhe dasitzen. 'Hast du dich denn gar nicht erschrocken?' fragte er. - 'Weswegen sollte ich mich erschrocken haben? Glaubst du, ich hätte noch keinen Wind gesehen?' Da sagte der Teufel: 'Wenn ich mich jetzt auch vor dir nicht erschrecke, so mußt du mir deinen Schnittkohl abgeben, und ich überlasse dir die Blätter.' - Der Herr war einverstanden. Und während der Teufel nach dem Schnittkohl auf das Feld ging, befestigte Gott an einem großen Baum zwei trockene Bretter aus Tannenholz so, daß sie im Winde aneinander schlugen, und ging selbst zum Feuer.
Ein wenig später kam der Teufel zum Feuer und hörte, wie in den Wipfeln der Bäume etwas plarksch, plarksch, tack, tack! mit solcher Gewalt machte, daß der ganze Wald erdröhnte. Der Teufel erschrak furchtbar und flüchtete von dannen. Als Gott zum Feuer kam, war kein Teufel mehr da. Ein Schwarzspecht aber erblickte den Teufel, und da er wußte, was ihn so erschreckt hatte, begann er mit seinem Schnabel auf einen trockenen Baum zu hacken und setzte dadurch den Teufel noch einmal in so große Furcht, daß er aus dem Wald herauslief und nicht mehr zurückkam. - Und noch heute behütet der Schwarzspecht auf dieselbe Weise den Wald vor dem Teufel.
Lettland: Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Märchen
KASTUTE ...
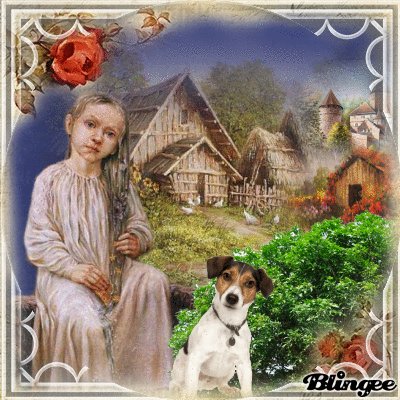
Es lebte einmal eine böse, niederträchtige Stiefmutter, die eine Hexe war. Sie hatte eine Stieftochter mit Namen Kastute. Die Stiefmutter konnte das Mädchen durchaus nicht leiden. Sie sorgte kein bisschen für Kastute und hatte kein Fünkchen Liebe für sie. Sie kümmerte sich immer nur um ihr eigenes Kind; das verwöhnte sie, nur dem tat sie Gutes und Liebes. Doch Kastute stieß sie überall herum, Kastute mochte sie am liebsten irgendwie umbringen, damit sie ihr aus den Augen kam.
Einmal gebot ihr die Stiefmutter: "Geh, Kastute, jäte mir auf dem Felde alle Disteln aus! Jäte den ganzen Tag, dass mir keine Distel stehen bleibt!" Sie packte ihr nur eine Brotrinde ein. Da ging Kastute, jätete und jätete, den ganzen Tag jätete sie. Und sie wurde müde und hungrig. Viel hatte sie schon ausgejätet. Es kam der Abend. Doch die Stiefmutter machte sich daran und grub eine ganz tiefe Grube unter der Schwelle, füllte sie mit glühenden Kohlen und wartete: Wenn Kastute kommt, dann wird sie in die Grube fallen und verbrennen.
Der Abend kam, da rief die Stiefmutter: "Komm her, Kastute, komm her, o Tochter, Abendbrot ist schon gekocht dir, Bettlein auch dir schon bereitet!" Doch da kam das Hündlein herausgelaufen: "Kiau-kiau, Kastutelein, Kiau-kiau, Waisenmägdlein, Kiau-kiau, nicht ins Haus geh! Kiau-kiau, Hexenweib grub dir ein Loch schon, Kiau-kiau, füllt's mit Kohlengluten!"
Oh, wie packte sie da die Furcht, wie weinte sie da und klagte: "Meine liebe Not, schwere Mühe du, und die Füße sind müd' von den Steinen, ach, so hart, und die Händlein geschwoll'n von den Disteln, spitz und bös'!" Sie klagte und klagte. Na, warum wohl? Sie fürchtete sich. Sie kauerte sich unter einem Strauch nieder und schlief ein.
Die Stiefmutter wartete und wartete. Sie kam herausgestürzt und schlug das Hündlein tot: "Was kläffst du hier, du Scheusal!" Am anderen Tag erwartete die Stiefmutter sie - doch sie kam nicht heim. Als Kastute erwacht war, nagte sie wieder an der harten Brotrinde und jätete den ganzen Tag. Sie jätete und jätete. Sie hatte schon alle Äcker leer gejätet.
Und am Abend rief die Stiefmutter wieder (sie hatte in der Grube die glühenden Kohlen erneuert und die Glut noch heißer gemacht): "Komm her, Kastute, komm her, o Tochter, Abendbrot ist schon gekocht dir, Bettlein dir auch schon bereitet!" Doch das Hähnchen hockte auf dem Bäumlein: "Ki-ke-ri-ki, Kastutelein, Ki-ke-ri-ki, Waisenmägdlein, Ki-ke-ri-ki, nicht ins Haus geh! Ki-ke-ri-ki, Hexenweib grub dir ein Loch schon, Ki-ke-ri-ki, füllt's mit Kohlenglut an!"
Und Kastute hörte das. Was sollte sie nun tun? Geht sie ins Haus - fällt sie in die Grube, stößt die Stiefmutter sie hinein, und sie verbrennt.
Und wieder setzte sie sich nieder und klagte: "Meine liebe Not, schwere Mühe du, und die Füße sind müd' von den Steinen, ach, so hart, und die Händlein geschwoll'n von den Disteln, spitz und bös'!" Sie klagte und klagte und klagte. Endlich schlief sie ein. Aber die Stiefmutter kam heraus, packte den Hahn und schlug ihm den Kopf ab: "So, ihr Scheusale! Ihr seid immer nur gegen mich!" Na, und wieder lag Kastute die Nacht über draußen. Auch zu essen hatte sie nichts mehr. Und wieder jätete sie den ganzen Tag und ging umher, schaute sich um und weinte.
Am Abend die Stiefmutter: "Jetzt ist niemand mehr da, der etwas sagen kann. Na gut, ich werde sie schon herbekommen." Sie hatte die Kohlenglut noch heißer gemacht und rief wieder: "Komm her, Kastute, komm her, o Tochter, Abendbrot ist schon gekocht dir, Bettlein auch dir schon bereitet!" Doch niemand mehr sagt Kastute etwas. Und Kastute dachte nach: Na, was hat's für einen Zweck - es ist doch alles gleich! Wie lange kann ich noch hier draußen bleiben? Ich habe schon heute nichts zu essen - ich muss eben doch ins Haus gehen!
Sie ging nach Hause. Und die Stiefmutter kam ihr entgegen: "Na, Kastute, hast du alles ausgejätet?" - "Ja, ich habe alles ausgejätet, liebe Mutter." - "Na, dann verbinde dir die Augen!" Sie reichte ihr ein Tuch, sie verband ihr die Augen. Doch das Kind der Stiefmutter lag in der Hängewiege. Da erhob sich ein Wind, ein wilder Sturm. Als er anfing zu blasen, ergriff er die Kohlenglut und trug sie überallhin. Die Hängewiege fing Feuer. Wie sprang da die Stiefmutter zu und packte ihr Kind - da stürzte sie als erste - plumps! - in die Grube.
Und die Stiefmutter verbrannte mit ihrem Kinde, doch Kastute blieb heil und gesund. Und vielleicht lebt sie auch jetzt noch irgendwo.
Quelle: Märchen aus Litauen
DER FUCHS UND DER KREBS ...
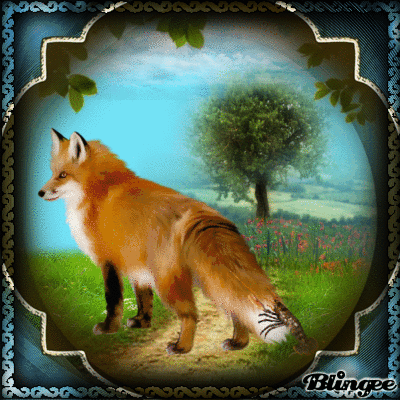
Einst stritt der Fuchs mit dem Krebs, daß dieser mit ihm nicht um die Wette laufen könne. Der Krebs aber blieb hartnäckig dabei, daß er den Fuchs noch überholen werde. Endlich beschlossen sie, eine Probe zu veranstalten, und bestimmten einen Berg zum Ziel.
Der Fuchs rannte davon, was er konnte, der Krebs aber hatte sich in seinem Schwanz festgekniffen, und der Fuchs trug ihn mit. Als der Fuchs das Ziel erreicht hatte, wandte er sich, um zu sehen, ob der Krebs weit zurückgeblieben sei.
Der Krebs ließ den Fuchsschwanz fahren und sprach zum Fuchs: »Ich bin schon müde geworden, auf dich zu warten!«
Der Fuchs war sehr ärgerlich darüber, daß der Krebs ihn besiegt hatte, und seit jener Zeit will der Fuchs vom Krebse nichts mehr wissen.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER GEHÖRNTE PASTOR ...
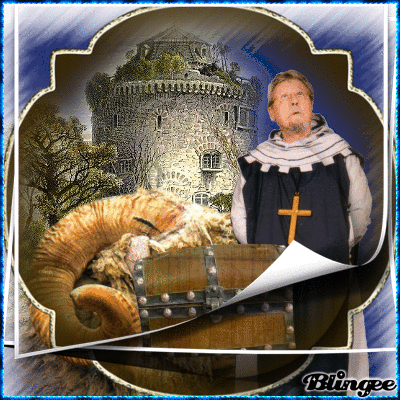
Zur katholischen Zeit lebte einmal ein Vater mit seinen Söhnen in einer verfallenen Hütte am Rande des Pastoratsfeldes. Anderes Getier hatten sie nicht als einen roten Hahn und einen schwarzen Kater. Eines Abends kamen die Söhne von der Arbeit nach Hause zurück. An der Schwelle kam ihnen der Kater mit kläglichem Miauen entgegen und lief vor den Söhnen her zum Lager des Vaters. Die Söhne schauten hin: der Vater lag auf seinem Lager lang hingestreckt. Die Söhne fragten: »Vater, was tust du da?« Aber der Vater gab keine Antwort. Die Söhne fragten wieder: »Vater, bist du krank?« Aber der Vater schwieg noch immer. Da schauten sie genau nach und merkten: der Vater war ganz kalt. Da half nichts mehr: der Vater war tot, ganz tot.
Als der erste Schmerz vorbei war, hielten die Söhne Rat, wie sie ihr Väterchen bestatten wollten. Sie fanden ein paar Bretter und machten daraus einen Sarg. Zum Begräbnisschmaus schlachteten sie ihren Hahn. Der eine Bruder blieb zu Hause, um noch das eine und andere vorzubereiten, der andre aber ging zum Pastor, ihm den Tod des Vaters anzuzeigen und ihn zum Begräbnis zu bitten. Der Junge hatte kaum seine Rede beendet, da rief der Pastor: »Bring deinen Rubel her!«
Nun war der Junge in einer bösen Klemme. Es war auch nicht eine rote Kopeke im Hause vorhanden, wo sollte man da noch den Rubel für den Pastor hernehmen! Der Junge bat: »Lieber Herr! Ich hab' auch nicht eine Kopeke zu Hause! Beerdigt doch das Väterchen umsonst!« Der Pastor erwiderte: »Bring deinen Rubel her, dann beerdige ich ihn, anders nicht!« Es half nichts, der Junge mußte zurückkehren, ohne etwas erreicht zu haben.
Zu Hause hielt er mit seinem Bruder Rat, was man tun solle. Der Ausweg war gleich gefunden: »Beerdigen wir den Vater selbst!« sprach der eine. »Beerdigen wir ihn!« antwortete der andere. »Graben wir sogleich ein Grab. Wenn es dunkel wird, wollen wir den Vater beerdigen!« Sie nahmen Schaufeln und machten sich an die Arbeit und hatten noch gar nicht lange am Grabe geschaufelt, da fanden sie einen Geldkasten. Sie sprengten den Kasten auf. Der Kasten war voll von Silberrubeln. Nun hatten die Jungen eine große Freude und trugen den Kasten nach Hause. Der eine nahm aus dem Kasten einen Rubel und ging damit zum Pastor.
Der Pastor fragte gleich: »Wo hast du diesen Rubel hergenommen?« Der Junge erzählte offenherzig, wie sie den Vater selber begraben gewollt und beim Schaufeln des Grabes den Geldkasten gefunden hatten. Der Pastor erklärte: »Den Geldkasten müßt ihr augenblicklich an die alte Stelle zurück bringen. Den hat der Teufel dorthin versteckt!« Mit traurigem Herzen ging der Junge nach Hause. Was sollte man da anderes tun als des Pastors Geheiß befolgen? Sie nahmen jedoch das Geld aus dem Kasten heraus und brachten dann selbander den Kasten an die alte Stelle zurück. Sie schütteten das Grab bis zum Rande mit Erde zu und gingen langsam nach Hause.
An der Kirchhofsmauer lauerte unterdessen der Pastor, ein weißes Laken um die Schultern, einen dreieckigen Hut auf dem Kopf. Kaum waren die Jungen ihres Weges gegangen, so sprang der Pastor aus seinem Versteck hervor, grub das Grab auf und holte den Kasten heraus. Aber o Wunder: auch nicht eine rote Kopeke war drin! Der Pastor fluchte und schimpfte, was er konnte.
Der Kirchenglöckner hatte einen Ziegenbock. Der kam jeden Tag auf den Pastoratshof weiden. Diesen Bock ließ der Pastor schlachten und das heile Fell zusammen mit den Hörnern abziehen. Er zog sich das frische Bocksfell über den Leib, ging in der Abenddunkelheit zur Hütte der Jungen und rief: »Bringt mir mein Geld her!« Die Jungen waren tief erschrocken. Sie sprangen auf den Ofen zum Gelde. Das Geld lag auf dem Ofen in einem großen Sack. Das gehörnte Gespenst hörte nicht auf, das Geld zu verlangen, und wollte es gar mit Gewalt fortnehmen. Schließlich wußten die Jungen keinen anderen Rat, sie mußten das Geld dem Gehörnten herausgeben. Der nahm das Geld und ging seines Wegs.
Zu Hause wollte der Pastor seinen Gespensterrock wieder ausziehen. Umsonst! Der war wie angewachsen. Schließlich rief der Pastor einen Knecht herbei, damit er ihm die Hörner mit einer Eisenstange vom Kopfe herunterschlage. Er zählte selbst: eins, zwei, drei! Der Knecht schlug zu. Der gehörnte Pastor aber schrie jämmerlich auf. Mehrmals noch versuchte der Knecht die Hörner vom Kopfe zu schlagen, doch alles war umsonst. Der Hörnerträger brüllte geradezu vor Schmerz. Vor Schrecken und Schmerz legte sich der gehörnte Pastor endlich ins Bett.
Der Küster hörte von der Sache. Er ging den Pastor besuchen. Man antwortete ihm: »Der Herr ist krank, er kann niemand empfangen.« Der Küster aber ließ nicht locker. Nach langem Drängen machte der Knecht endlich die Stubentür auf. Der Küster blickte hinein: die Hörner ragten unter der Decke hervor. Der Küster erschrak so sehr, daß er sofort der Länge nach hinstürzte. Er war tot.
Darauf wollte der Glöckner den Pastor besuchen. Er hatte einen schauerlichen Schreck, rief: »Hörner, Hörner!«, fiel hin und war gleichfalls tot. Vor Scham und Entsetzen wagte es der Hörnerträger nicht mehr, noch länger dort zu bleiben. Er ließ am Abend anspannen, stieg in den Wagen und fuhr in die Stadt. Dort hat er unter Freunden noch mehrere Jahre gelebt. Die Hörner aber ist der Arme niemals mehr losgeworden.
Estland: August von Löwis of Menar: Finnische und estnische Märchen
DER BAUER UND DIE DREI TEUFEL ...
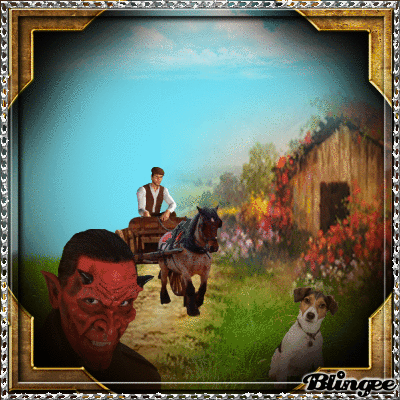
Ein Bäuerlein hatte in der Stadt seine Geschäfte gemacht und war mit seinem Karren auf dem Weg nach Hause, doch je länger er fuhr, umso langsamer wurde der Schritt seines Pferdes. Da half kein Schnalzen, kein Knallen mit der Peitsche und kein Schimpfen. Schließlich blieb der Gaul sogar stehen und war nicht mehr von der Stelle zu bewegen.
Der Bauer stieg vom Wagen, schlug das Pferd und verfluchte es: „Wie oft sind wir diesen und weitere Wege schon gefahren?! Immer hast du uns hin und zurück gebracht! Was ist heute bloß in dich gefahren, dass du mich so im Stich lässt! Ach, hol dich doch der Teufel!“ Dabei schirrte er das Pferd los und stieß es in den Straßengraben.
Nur einen Augenblick darauf kam ein Hündchen herbei gesprungen, machte vor dem Bauern Männchen, wedelte mit dem Schwanze, leckte ihm die Hände und streichelte ihn dreimal mit der Pfote und im nächsten Moment war es auch schon wieder verschwunden. Der Bauern wunderte sich und schüttelte den Kopf, dachte sich aber nichts weiter dabei und trat ärgerlich den Heimweg zu Fuß an. Erschöpft kam das Bäuerlein mit seinem Karren auf seinem Hof an, stellte ihn ab und ging erschöpft schlafen.
Als er am nächsten Morgen ein anderes Pferd von der Koppel holen wollte, graste dort sein Zugpferd und sah prächtiger aus denn je. „Hast du alter Gauner es doch bis hierher geschafft und lässt’s dir gut gehen. Gleich spanne ich dich vor den Pflug und will sehen, ob du wieder so von Kräften kommst wie gestern!“, sagte der Bauer und wollte dem Pferd das Halfter anlegen. Da stand wie aus dem Boden gewachsen ein feiner Herr vor ihm und verwehrte ihm das Tier mit den Worten: „Der Gaul gehört mir.“ „Das Pferd soll dir gehören?“, schalt das Bäuerlein. „Ich selbst habe es aufgezogen und ausgebildet und magst du es nicht glauben, dann frage die Nachbarn.“ „Hast du es mir nicht gestern überlassen? Ich bin der Teufel von der Allerweltsheide. Erinnerst du dich nicht mehr an meinen Neffen, den ich sofort zu dir schickte, der dir die Hand leckte und dich mit der Pfote streichelte?“
Da bekreuzigte sich der Bauer dreimal. Einschüchtern ließ er sich aber von dem Leibhaftigen nicht. Er stieß ihn zur Seite, fluchte: „Was habe ich mit dir zu schaffen“ und legte dem Pferd das Halfter an. Gegen das Kreuzzeichen vermochte der Teufel nicht anzukommen und verschwand. Als der Bauer aber mit dem Pferd auf den Hof kam, um es vor den Pflug zu spannen, stand dort ein zweiter Herr, der es ihm verwehren wollte. „Lass’ den Gaul wo er ist. Ich bin der Teufel vom Krallensumpf und der ältere Bruder des Teufels von vorhin. Wenn du den Gaul anspannst, werde dich mit glühenden Eisenruten peitschen.“
Der Bauer merkte sofort, dass mit dem Kreuzzeichen gegen diesen hier nichts auszurichten war, nahm seine Mütze ab und sprach ein Vaterunser, worauf der Teufel augenblicklich verschwand. Fröhlich klopfte der Bauer den Hals seines Pferdes und lachte sich eins: „Denen habe ich gezeigt, wo der Haken hängt, jetzt wirst du wohl bei mir bleiben.“ Darauf spannte er das Tier vor den Pflug und führte es aufs Feld. Kaum war er dort angekommen und wollte mit der Arbeit beginnen, fuhr eine schwarze Gestalt wie ein Heuschober auf ihn zu: „Wirst du wohl die Finger von unserem Pferd lassen! Was du dem Teufel versprochen hast, muss dem Teufel bleiben! Denn was wir in den Klauen haben, geben wir nicht mehr her.“
‚Jetzt habe ich mit den Leibhaftigen wirklich meine liebe Not’, dachte das Bäuerlein. Er sah, dass mit diesem hier nicht zu spaßen war und begann sich aufs Bitten und Betteln zu verlegen, er bräuchte das Pferd für seinen Unterhalt und er wolle dem Teufel gern einen Gefallen tun, wenn er ihm nur das Pferd ließe. „Nun gut, du magst deinen Gaul behalten, wenn du uns zum Weihnachtsfest einlädst“, willigte der Teufel schließlich ein.
Das Bäuerlein überlegte, was das wohl kosten mochte und fragte: „Wie viele seid ihr und was wollt ihr essen?“ „Wir sind drei. Mein jüngster Bruder von der Allerweltsheide verlangt eine Tonne Hafer, mein mittlerer Bruder vom Krallensumpf einen Kübel Blut und ich ein Fass Fleisch“, forderte der Teufel. Der Bauer willigte ein und der Teufel ließ ihm das Pferd, das das Feld in einem Zug pflügte wie noch nie und auch an keinem der folgenden Tage und Wochen ermüdete.
Indessen nahte das Weihnachtsfest und der Bauer hatte seine Bedenken wegen der ungebetenen Gäste. Schließlich ging er zu einem Schwarzkünstler, vertraute sich ihm an und fragte, was er tun könne. „Die drei Teufel werden wie es ihrer Sitte entspricht nacheinander in dein Haus treten. Sage folgende Zaubersprüche, so können sie dir nichts anhaben.“ Dann lehrte der Schwarzkünstler das Bäuerlein die Zaubersprüche und es ging frohgemut nach Haus.
Als der Weihnachtsabend anbrach und alle Familien bei Tische saßen, da klopfte es auch beim Bäuerlein an der Tür und als es sie aufmachte, stand dort der älteste Teufel und forderte seinen Kübel Blut. „Krieche in den Spalt an der Wand und sauge Blut, wenn du kannst!“, antwortete ihm da das Bäuerlein wie es ihn der Schwarzkünstler gelehrt hatte. Bei diesen Worten verwandelte sich der Teufel in eine Wanze. Doch nur einen Augenblick später stand da schon der Teufel vom Krallensumpf und forderte sein Fleisch. „Fort in den Wald und fange selbst dein Fleisch.“, sagte der Bauer und im nächsten Augenblick wurde aus dem Teufel ein Wolf der jaulend im Wald verschwand.
Da kam der dritte Teufel und rief: „Den Hafer her! Den Hafer her!“ Der Bauer aber antwortete: „Aufs Feld mit dir und such dir selbst deine Körner!“ Da wurde aus dem jüngsten Teufel der Rattenkönig, der auf dem Felde verschwand. So kam der Bauer endlich auch zu seinem christlichen Weihnachtsfest und hatte obendrein seinen Gaul behalten. Das Fluchen aber ließ er von diesem Tag an bleiben.
Quelle: Märchen aus Estland
DER RÄUBER NACHTIGALL ...

Salavei Rasboinik lebte im Wald zu Pränski. Er ließ niemanden näher als auf 25 Werst heran. Wenn er nur pfiff, so pfiff er zum Tod. Paaba Karaleevits Ilja Muromets ritt auf dem Pferd sehr nahe heran. Bei der zehnten Werst pfiff er kräftig und sah, daß jener nicht herunter fiel, sondern immer näher kam. Es blieben noch fünf Werst, er pfiff sehr stark. Jener kam schon ganz nahe, er pfiff, wie er nur konnte. Jener nahm schon die Bogenbüchse mit den Pfeilen, zielte ihm in das rechte Auge. Patsch fiel er von der Eiche herunter wie ein Haferbündel, erschlug sich jedoch nicht. Muromets nahm ihn und band ihn an den Schwanz des Pferdes, schleuderte ihn noch die Erde und die Welt entlang. Jagte nach Moskau und sagte: "Na, Salavei Rasboinik, wie stark bist du? Pfeif noch mal!" Er pfiff noch so stark, daß viele Menschen in der Stadt starben. Jener begann noch einmal, mit dem Pferd durch die Welt zu ziehen, band ihn noch stärker an den Schwanz, bis er starb.
Estnisches Märchen
