MÄRCHEN AUS DER TSCHECHOSLOWAKEI
VERZEICHNIS
"Von den zwölf Monaten"
"Das feurige Haus"
"Der Kuckuck"
"Wie der Wagner König wurde"
"Bestrafter Stolz"
"Wer hat die Tauben gegessen?"
"Der Heiland unterwegs (Vier Geschichten)"
"Prinz Bajaja"
"Rarasch und Schotek" (DreiGeschichten)
"Der lustige Schwanda"
"Käthe und der Teufel"
"Von der Mutter und ihrem Sohne"
"Der verräterische Diener"
"Die Reise zur Sonne"
"Der Hund und die Ammer"
"Die Teufelsfelsen"
"Die Waldfrau"
"Der schwarze Vogel"
"Die drei Wunderfische"
"Der Tiere Herbstgespräch"
"Der Hund und der Wolf"
"Der Lange, der Breite und der Scharfäugige"
" Vom Schafhirten und dem Drachen"
"Vom verstellten Narren"
"Zitek, der Hexenmeister"
" König Iltis"
"Der Hirt und die Zwerge"
"Der gläserne Berg"
"Vom Metallherrscher"
"Das goldene Spinnrad"
"Der Feuervogel"
"Die englische Prinzessin Afanasie"
"Der gerechte Bohumil"
"Das Sonnenroß"

DAS SONNENROSS ...
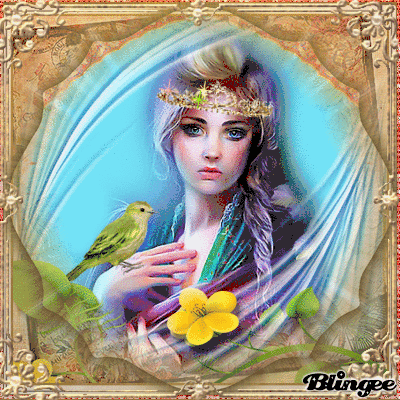
Es war einmal ein Land, traurig wie das Grab, schwarz wie die Nacht, denn in ihm schien Gottes Sonne niemals. Die Menschen hätten es geflohen, und den Eulen und Fledermäusen überlassen, wenn nicht zum Glück der König ein Roß mit einer Sonne auf der Stirn besessen hätte, die, gleich der wahrhaftigen Sonne, helle Strahlen nach allen Seiten versandte. Damit also die Leute in dem finstern Lande wohnen könnten, ließ der König sein Sonnenroß durch das selbe führen, von einem Ende zum anderen; und es ging Licht von ihm aus, als ob der schönste Tag wäre, allenthalben, wo man es führte; von wo es sich aber entfernte, dort wälzte sich dichte Finsterniß hin.
Plötzlich war das Sonnenroß verschwunden. Dunkelheit, noch ärger als die Nacht, lagerte sich über das ganze Land, und nichts vermochte sie von dieser Zeit an zu verscheuchen. Unzufriedenheit und Schrecken verbreitete sich unter den Menschen, Not begann sie zu drängen, denn sie konnten nichts arbeiten, nichts erwerben, und es entstand zuletzt furchtbare Verwirrung. Selbst der König geriet in Angst, und um die Gefahr zu beseitigen, zog er mit seinem ganzen Heer aus, das Sonnenroß zu suchen.
Durch dichte Finsterniß zog der König bis an die Grenze seines Reiches. Hinter tausendjährigen Wäldern in einem anderen Land begann hier Gottes Sonne wie durch Morgennebel hervor zu dringen.
So weit das Auge reichte, war nichts zu sehen als Wald, ringsum nichts als Wald und wieder Wald. In diesen Wäldern kam der König mit seinem Heer zu einer armseligen Hütte. Er trat hinein um zu erfragen, wo er sei und wohin der Weg führe. Hinter einem Tisch saß ein Mann von mittleren Jahren, der aufmerksam in einem aufgeschlagenen großen Buche las.
Als der König sich ihm verneigte, erhob er die Augen, dankte freundlich und stand auf. Sein Wuchs war hoch, sein Antlitz gedankenvoll, sein Blick durchdringend; das ganze Äußere kündigte an, er sei kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Mensch, der sich mit außerordentlichen Dingen beschäftige. »Eben las ich von Dir,« sprach der Mann zum König. »Du gehst das Sonnenroß suchen? Bemühe Dich nicht weiter denn Du bekommst es nicht; verlaß Dich auf mich, ich will es finden. Kehre zurück nach Hause, dort bist Du nötig; nimm auch Dein Heer mit Dir, ich bedarf keines Heeres, laß mir nur einen Krieger zu meinen Diensten.« -
»Wahrlich, Du unbekannter Mann, ich will Dich reichlich belohnen,« antwortete der König, »wenn Du mir das Sonnenroß wieder bringst.« - »Ich begehre keine Belohnung. Kehre nach Hause zurück, dort bist Du nötig, und gönne mir Ruhe, daß ich mich zur Reise rüste,« sprach der Mann. Der König entfernte sich, trat mit seinem ganzen Heer den Rückweg an, und hinterließ nur einen Krieger, dem bereitwilligen Manne zu seinen Diensten. Der Seher - denn das war der Mann - setzte sich wieder zu seinem Buch, und las darin bis zum späten Abend.
Des anderen Tages begab sich der Seher samt seinem Diener auf den Weg. Der Weg war weit, denn schon sechs Länder hatten sie durchzogen, und noch mußten sie weiter. Im siebenten Land blieben sie bei dem königlichen Palast stehen. Drei gewalttätige Brüder herrschten über dieses Land, und hatten drei Schwestern zu Gemahlinnen, deren Mutter, eine böse Zauberin, Striga hieß.
Als die Beiden vor dem Palast standen, sprach der Seher zu seinem Diener: »Du warte hier, ich will in den Palast gehen, mich überzeugen, ob die Könige zu Hause sind; denn sie haben das Sonnenroß geraubt, der jüngste reitet darauf.« In dem Augenblicke verwandelte er sich in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der ältesten Königin, und flatterte dort umher, und klopfte so lange mit seinem Schnabel, bis sie öffnete und ihn ins Zimmer ließ. Sie ließ ihn gern herein und freute sich über ihn, wie ein Kind, weil er so schön war, und ihr so süß zu schmeicheln wußte. »Ach schade, schade, daß mein Gemahl nicht zu Hause ist, der Vogel würde gewiß auch ihm gefallen! Doch er kommt erst Abends, denn er ist fort geritten, ein Drittteil des Landes zu mustern.« So sprach die Königin und spielte mit dem kleinen Vogel.
Plötzlich trat die alte Striga ins Zimmer, gewahrte den Vogel, und schrie: »Erwürg den verfluchten Vogel, sonst wird er Dich blutig machen!« - »Ei mich blutig machen! Sieh doch, wie unschuldig, wie lieb er ist! entgegnete die junge Königin.« Aber Striga schrie: »Trügerische Unschuld! Her mit ihm, daß ich ihn erwürge!« und schon stürzte sie auf ihn los. Allein der Vogel verwandelte sich klug in einen Menschen, und flugs war er zur Tür hinaus. Sie wußten nicht, wohin er geraten war.
Hierauf verwandelte sich der Seher abermals in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der jüngeren Schwester, und klopfte so lange, bis sie ihm öffnete. Als sie ihn herein gelassen, setzte er sich ihr auf die weiße Hand, flog ihr von der Hand bald auf die eine, bald auf die andere Schulter, und dann blieb er ruhig sitzen, und blickte ihr zutraulich ins Auge. »Ach schade, schade, daß mein Gemahl nicht zu Hause ist,« rief die Königin vergnüglich lächelnd, »Der Vogel würde gewiß auch ihm gefallen! Doch er kommt erst morgen Abends, denn er ist ausgeritten, zwei Drittteile des Landes zu mustern.«
Plötzlich trat die alte Striga ins Zimmer. »Erwürg' den verfluchten Vogel, sonst wird er Dich blutig machen!« schrie sie, kaum daß sie den Vogel gewahrte. - »Ei mich blutig machen! Sieh doch, wie unschuldig, wie lieb er ist!« entgegnete die junge Königin. Aber Striga schrie: »Trügerische Unschuld! Her mit ihm, daß ich ihn erwürge!« und schon stürzte sie auf ihn los. Allein der Vogel verwandelte sich als bald in einen Menschen, flugs war er zur Tür hinaus und blitzschnell verschwunden, so daß sie gar nicht wußten, wohin er geraten war.
Nach einer Weile verwandelte sich der Seher nochmals in einen grünen Vogel, flog zu dem Erker der jüngsten Königin, und flatterte dort umher, und klopfte so lange mit seinem Schnabel, bis sie ihm öffnete. Er flog gerade auf ihre weiße Hand, und schmeichelte ihr so, daß sie eine kindische Freude hatte, in dem sie mit ihm spielte. »Ach Jammerschade,« rief die Königin in ihrer Freude, »daß mein Gemahl nicht zu Hause ist, der Vogel würde gewiß auch ihm gefallen! Doch er kommt erst übermorgen Abends, denn er ist ausgeritten, alle drei Teile des Landes zu mustern.«
Da stürzte die alte Striga ins Zimmer. »Erwürg den verfluchten Vogel,« schrie sie noch in der Tür. »erwürge ihn, sonst wird er Dich blutig machen!« - »Ei mich blutig machen, Mutter! Sieh doch, sieh, wie unschuldig, wie schön er ist!« entgegnete die Königin; aber die Mutter steckte die dürren Hände nach ihm aus: »Trügerische Unschuld! Her mit ihm, daß ich ihn erwürge!« Allein in dem Augenblick verwandelte sich der Vogel in einen Menschen, und flugs war er zur Tür hinaus, daß ihn niemand weiter gewahrte.
Der Seher wußte jetzt, wo die Könige seien, und auf welchem Wege sie kommen würden. Er begab sich schnell zu seinem Diener, befahl ihm, auf drei Tage Nahrung zu kaufen, und eilte dann aus der Stadt. Vor der Stadt im Wald erwartete er ihn, und dann gingen sie hurtigen Schrittes weiter, bis sie zu einer Brücke gelangten, über welche die Könige kommen mußten. Unter der Brücke harrten sie bis zum Abend.
Als sich Abends die Sonne hinter die Wälder neigte, ließ sich auf der Brücke Roßgestampf hören. Der älteste König kehrte nach Hause zurück. Auf der Brücke stolperte sein Roß zufällig über einen Balken. »An den Galgen mit dem Taugenichts, der die Brücke gezimmert hat!« rief erzürnt der König. Da sprang der Seher unter der Brücke hervor, und stürzte auf den König los: »Wie kannst Du es wagen, einen Unschuldigen zu verdammen?« Und er zog sein Schwert, und auch der König zog sein Schwert, konnte aber den mächtigen Streichen des Sehers nicht widerstehen. Nach kurzem Kampf sank er tot vom Rosse. Der Seher band den toten König an das Roß, und trieb es an, daß es seinen toten Herrn nach Hause trage. Dann verbarg er sich unter der Brücke, und harrte bis zum zweiten Abend.
Als sich des anderen Tags der Abend näherte, kam der jüngere König zur Brücke, und als er das Blut gewahrte, rief er: »Gewiß, daß jemand hier erschlagen ward! Welcher Gauner hat sich erfrecht, mein Königsamt zu üben?« Auf diese Worte sprang der Seher unter der Brücke hervor, und stürzte mit gezücktem Schwert auf den König los: »Wie kannst Du es wagen, mich so zu schelten! Du bist ein Kind des Todes! Wehre Dich, wie Du es vermagst!« Der König wehrte sich, doch vergebens, nach kurzem Widerstand erlag er dem mächtigen Schwert des Sehers. Der band den Leichnam wieder an das Roß, und trieb es an, daß es seinen toten Herrn nach Hause trage. Dann verbarg er sich unter der Brücke und harrte dort mit dem Diener bis zum dritten Abend.
Am dritten Abend, schon nach Sonnenuntergang, kam der jüngste König auf dem Sonnenroß geritten; er ritt schnell, denn er hatte sich irgendwo verspätet. Als er das rote Blut auf dem Boden gewahrte, hielt er an und rief: »Ein Schurke, der sich unterfangen, meinem Königsarm ein Opfer zu entreißen!« Kaum hatte er die Worte gerufen so stand der Seher mit gezücktem Schwert vor ihm, und drang auf ihn ein. »Wohlan!« rief der König und zog gleichfalls sein Schwert, und wehrte sich mannhaft.
Die ersten zwei Brüder zu überwältigen, war für den Seher ein Spiel; nicht so leicht ging es bei dem Dritten, denn dieser war von allen der Stärkste. Lange kämpften sie, daß der Schweiß von ihnen rann, und noch neigte sich der Sieg auf keine Seite. Die Schwerter zerbrachen. Da sagte der Seher: »Mit den Schwertern richten wir nichts mehr aus. Weißt Du was, verwandeln wir uns in Räder, und rollen wir bergab! Welches Rad zerschmettert, der ist besiegt.« - »Gut,« versetzte der König, »ich will ein Wagenrad sein. Du sei was immer für eins!« - »Nicht doch, Du sei was immer für eins; ich will ein Wagenrad sein,« sagte der Seher klug, und der König ging darauf ein.
Sie bestiegen einen Berg; dort verwandelten sie sich in Räder, und rollten hinab. Das Wagenrad flog, und mit Gekrache stieß es in das andere, daß dieses in Stücke zerbrach. Aus dem Wagenrad ward sogleich der Seher, und rief freudig: »Du bist dahin! Mein ist der Sieg!« - »Nicht doch, Freund!« rief der König, in dem er wieder vor dem Seher stand. »Du hast mir blos die Finger zerschmettert. Weißt Du was, verwandeln wir uns in Flammen, und welche Flamme die andere verbrennt, der ist Sieger! Ich will eine rote Flamme sein, Du sei eine weiße!« -
»Nicht doch,« versetzte der Seher, »Du sei eine weiße Flamme, ich will eine rote sein.« Der König ging darauf ein. Sie stellten sich auf den Weg zur Brücke, verwandelten sich in Flammen, und einer begann den anderen unbarmherzig zu brennen. Lange brannten sie sich ohne Erfolg. Da kam ein alter Bettler daher, mit langem, weißem Bart, mit kahlem Haupt, eine große Tasche an der Seite, gestützt auf einen dicken Stock. »Alter«, rief die weiße Flamme, »bringe Wasser und gieße es auf die rote Flamme! Ich will Dir einen Pfennig schenken.«
Aber die rote Flamme schrie: »Alter, ich will Dir einen Dukaten schenken, wenn Du auf die weiße Flamme Wasser gießt.« Dem Bettler war der Dukaten lieber als der Pfennig; er brachte Wasser und goß es auf die weiße Flamme. So war der König dahin. Aus der roten Flamme ward der Seher, fing das Sonnenroß am Zügel, schwang sich darauf, rief den Diener, dankte dem Bettler und ritt davon.
Im königlichen Palast herrschte tiefe Trauer ob den getöteten König. Der ganze Palast war mit schwarzem Tuch belegt, und erscholl von lauten Klagen. Striga ging unruhig aus einem Zimmer in das andere. Plötzlich blieb sie stehen, stampfte mit dem Fuße auf den Boden, ballte die Faust und rollte die blitzenden Augen; dann setzte sie sich auf eine Ofenkrücke, faßte die drei Töchter unter dem Arm, und husch war sie mit ihnen in der Luft.
Der Seher und sein Diener hatten schon ein gutes Stück Weges zurück gelegt, denn sie beeilten sich, da sie Strigas Rache fürchteten. Sie zogen durch öde Wälder, über nackte Heiden. Die Nahrung, die sie in der Stadt gekauft, begann ihnen auszugehen. Hunger plagte sie, besonders den Diener, und sie fanden nichts, womit sie ihn hätten stillen können.
Da kamen sie zu einem Apfelbaum. Es hingen Äpfel daran, deren Last die Äste zur Erde beugte, und die lieblich rochen und schön gefärbt waren, so daß sie die Eßlust reizten. »Gott sei Dank!« rief erfreut der Diener, und schon lief er zu dem Apfelbaum. - »Pflücke nicht von dem Baume!« rief der Seher, zog sein Schwert, hieb tief in den Apfelbaum und rotes Blut quoll aus ihm hervor. »Siehst Du, es wäre Dein Verderben gewesen, hättest Du von den Äpfeln gegessen; denn dieser Apfelbaum war die älteste Königin, welche ihre Mutter hier her pflanzte, um uns aus der Welt zu schaffen.« Der Diener war betrübt über die Täuschung, doch der Rettung seines Lebens froh, schritt er weiter hinter dem Seher, in der Hoffnung, bald ein anderes Labsal zu finden.
Er brauchte nicht lange zu warten, denn bald kamen sie zu einer Quelle. Es sprudelte das reinste, frische Wasser aus ihr, und lockte die Reisenden zum Trinken. »Ach,« sagte der Diener, »ist nichts Festeres zu haben, so können wir wenigstens von diesem Wasser trinken und unseren Hunger täuschen.« - »Trinke nicht von dem Wasser!« rief der Seher, hieb mit seinem Schwerte mitten in das Wasser hinein, und es färbte sich mit Blut, das in starken Wellen dahin floß. »Das war die jüngere Königin, von ihrer Mutter hier her versetzt, um uns aus der Welt zu schaffen!« sprach der Seher, und der Diener dankte ihm für die Warnung, und folgte trotz Hunger und Durst dem Seher, wohin er wollte.
Nach einer Weile kamen sie zu einem Rosenstrauch. Der war rot von lauter schönen Rosen, und erfüllte mit seinem Duft die ganze Umgegend. »O was für schöne Rosen,« sagte der Diener, »noch nie in meinem Leben habe ich deren so schöne gesehen! Ich will einige abreißen, und mich mindestens an ihnen erquicken.« - »Reiße keine Rose ab!« rief der Seher, hieb mit seinem Schwerte in den Rosenstrauch, und es spritzte Blut aus ihm hervor, als ob sich eine Menschenader öffnete. »Das war die jüngste Königin,« sprach der Seher zum Diener, »die ihre Mutter hier her pflanzte, um uns durch die Rosen aus dem Leben zu tilgen.«
So zogen sie weiter. Indem sie weiter zogen, sprach der Seher zum Diener: »Die ärgste Gefahr haben wir überstanden, wir sind aus Strigas Bereich. Doch dürfen wir ihr nicht trauen, denn Striga wird andere Mächte anstiften.« Kaum hatte er die Worte gesprochen, so kam ein kleiner Knabe des Weges daher, der einen Zaum in der Hand trug. Er sprang unter das Roß, berührte es mit dem Zaum, und in dem selben Augenblick war der Seher von dem Sonnenroß unten und der Knabe saß oben, und sprengte pfeilschnell von dannen. »Sagte ich es nicht?« sprach der Seher. - »Was für ein Knabe ist das?« rief der Diener. »Wer hätte sich eines solchen Streiches versehen! Machen wir, daß wir ihn einholen!« - »Laß nur,« entgegnete der Seher, »ich will ihn selbst einholen! Gehe in dessen des Weges weiter, gehe getrost durch sechs Länder, bis Du an die Grenze Deines Landes gelangst, ich werde Dir schon nachkommen.«
Der Seher verließ den Diener und eilte dem kleinen Zauberer nach. In einer Weile holte er ihn ein, und ging langsam, indem er die Gestalt eines gewöhnlichen Wandersmannes annahm. Der Zauberer sah sich eben um. »Woher Freund?« fragte er den Wandersmann. »Aus weiter Ferne.« - »Und wohin?« - »Einen Dienst suchen.« - »Einen Dienst suchen? Verstehst Du Pferde zu warten?« - »Ei ja wohl.« - »So komm zu mir und warte mit dies Pferd. Ich will Dich gut bezahlen.« - »Warum nicht!« meinte der Wandersmann, und so war der Seher des Zauberers Diener.
Sie kamen zu Hause an. Der Seher wartete das Sonnenroß trefflich, so daß sein Herr mit ihm zufrieden war. Nur verdroß es den Seher, daß er keine Gelegenheit zu entfliehen fand; denn der Zauberer verhinderte es durch seine Zauberkünste. Gleichwohl entdeckte dieser nicht wer sein Diener sei, weil er zu sehr damit beschäftigt war, wie er eine schöne Prinzessin zur Gemahlin bekommen könnte, die in einem Schlosse wohnte, das auf einer Pappel im Meere stand. Er hatte schon Verschiedenes versucht, Gutes und Schlimmes, doch fruchtete alles nichts.
»Auf!« sprach er einst zu seinem Diener, »gehe zum Meere. Im Meere wirst Du eine ungeheuer hohe Pappel sehen, auf der Pappel ein schönes Schloß. In dem Schlosse wohnt eine Prinzessin; bringst Du sie mir, will ich Dich reichlich belohnen, wenn nicht, wird es Dir schlimm ergehen.« Der Herr befahl es; und der Diener mußte es vollziehen, wenigstens versuchen. Er schaffte sich einen Kahn, belud ihn mit bunten Bändern und Stoffen, und fuhr als Kaufmann zu dem Schloss auf der Pappel.
Als er sich der Pappel näherte, hing er die schönsten Stoffe und Bänder aus, damit man sie vom Schloss aus sehen konnte. Die schönen Stoffe und Bänder lenkten bald die Aufmerksamkeit der Prinzessin auf sich, die aus dem Erker schaute. »Gehe doch hinab zu dem Kahn,« befahl sie ihrer Zofe, »und forsche, ob sie Dir von den schönen Stoffen und Bändern nicht verkaufen möchten.« Die Zofe ging und forschte. »Ich verkaufe nichts,« entgegnete der Kaufmann, »außer wenn die Prinzessin selbst herab kommt, und es sich selbst auswählt.«
Die Zofe richtete die Worte aus, und die Prinzessin kam, wählte unter den schönen Stoffen und Bändern, wählte und feilschte, und bemerkte nicht, daß der kluge Kaufmann den Kahn abstieß und zum Ufer fuhr. Als sie aus dem Kahn hinaus wollte, da erst bemerkte sie, was geschehen war. »Ich weiß, wohin Du mich schiffst,« sagte sie. »Du schiffst mich zu dem Zauberer, der sich schon so oft vergebens um mich bemüht hat. Nun, Gott befohlen!« Da der Seher sah, daß die Prinzessin dem Zauberer nicht gewogen sei, begann er ihr sanft zuzureden, sie möchte sich dessen Zutrauen erwerben, damit sie erführe, worin seine Kraft liege; er wolle ihr dann zur Freiheit verhelfen.
Als der Diener dem Herrn die Prinzessin brachte, war dessen Freude unaussprechlich, und als sie ihm Liebe zeigte, war er ganz von Sinnen. Er hätte ihr alles gegeben, ihr alles zu Willen getan; kein Wunder also, daß er ihr auf vieles Bitten auch sein Geheimniß verriet. »In dem Wald dort,« sprach er, »ist ein großer Baum; unter dem Baum weidet ein Hirsch, in dem Hirsch ist eine Ente, in der Ente ist ein goldenes Ei und in dem Ei ist meine Kraft; denn in ihm ist mein Herz.« Als der Zauberer dies seiner Gemahlin unter dem Siegel des strengsten Geheimnisses vertraut hatte, erzählte sie es dem Seher.
Der Seher bedurfte nicht mehr. Er bewaffnete sich und begab sich in den Wald. Er fand den großen Baum, fand den Hirsch, der unter dem Baum weidete. Er zielte, schoß, und der Hirsch stürzte nieder. Dann sprang er hinzu, nahm aus ihm die Ente heraus, aus der Ente das Ei, trank das Ei aus, und des Zauberers Kraft war dahin. Der Zauberer ward schwach, wie ein Kind, denn all seine Kraft war in den Seher übergegangen. Dieser kam, schenkte der Prinzessin die Freiheit zur Rückkehr in ihren Palast, nahm das Sonnenroß, schwang sich darauf und eilte mit ihm zu dem König, dem es gehörte.
Er mußte einen guten Teil der Welt durch eilen, bevor er zu der Grenze des dunkeln Königreichs gelangte, wo er auch den vorausgeschickten Diener traf. Als sie die Grenze überschritten, ergossen sich ringsum die Strahlen des Sonnenroßes, erleuchteten weit und breit das Land, das schon so lange in undurchdringliche Finsterniß gehüllt war, und erfreute die Herzen der geplagten Menschen.
Alles lebte neu auf, die Fluren lachten im Frühlingsschmuck, und die Menschen strömten herbei, um ihrem Wohltäter für die Rettung zu danken. Der König wußte nicht, wie er den Seher belohnen solle; er wollte ihm die Hälfte seines Königreichs schenken. Allein dieser sprach: »Ich begehre keinen Lohn, um so weniger die Hälfte Deines Königreiches. Sei Du König und herrsche, wie es sich gebührt, ich will in meine einsame, friedliche Hütte zurückkehren.«
Und er schied, und kehrte in seine Hütte zurück.
Slowakei: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
DER GERECHTE BOHUMIL ...
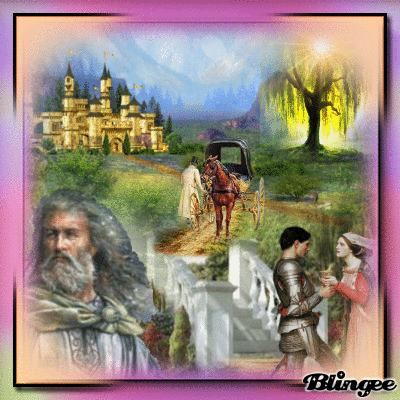
Ein Tagelöhner, der sich jedes Stücklein Brot mühsam verdienen muss, hat mitunter mehr Kinder als ein Reicher, der in Samt und Seide geht und das Gold nach Scheffeln misst. So war es auch in einer großen Stadt, wo ein Viehhirt sechs Kinder, der König aber kein einziges hatte. Tausende gab er allein für Ratschläge gelehrter Ärzte und alter Weiber aus, doch alles nützte nichts. Auch die Königin war traurig und schickte jeden Tag Geld in die Kirchen für Gebete, doch niemand vermochte ihr einen Erben zu erflehen.
Erbittert sagte einmal der König: "Wenn ich kein Kind aus dem Willen Gottes haben kann, möchte ich es aus dem Willen des Teufels haben." Wenig später, als er längst nicht mehr an seine lästerlichen Worte dachte, offenbarte ihm die Königin, dass ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen werde.
Nach einigen Monaten schenkte die Königin einem Töchterchen das Leben. Von weit und breit kamen die Gäste, die der glückliche König zur Taufe geladen hatte, und füllten das ganze Schloss. Volle acht Tage lang war in der Stadt nichts zu hören als Musik und Gesang, nichts zu sehen als Tanz und frohe Spiele. Bei der Taufe erhielt die Prinzessin den Namen Lidumila. Von den Eltern als teuerstes Kleinod bewahrt, wuchs sie in eitel Wonne und Freude auf.
Als sie siebzehn Jahre alt war, hieß es, sie sei das schönste Mädchen im ganzen Königreich. Mancher hätte sich gern in die Tiefe des Meeres gewagt, wenn er dort diese kostbare Perle gefunden hätte. Aber die schöne Lidumila dachte bisher an keinen Bräutigam; nur die Eltern sprachen manchmal leise davon, welcher von den edlen Prinzen wohl am besten zu ihr passen würde.
Eines Tages saß Lidumila ganz traurig mit ihren Eltern bei Tisch. Besorgt fragte die Mutter, was ihr fehle. "Ach, liebste Mutter", erwiderte die Prinzessin, "ich weiß nicht, warum mir den ganzen Tag so traurig ums Herz ist, als müsste ich von Euch Abschied nehmen." Die Mutter wollte eben ihrer Tochter Vorwürfe machen, dass sie so traurigen Gedanken nachhänge, da wurde das Mädchen plötzlich kohlrabenschwarz und sank vom Stuhl zu Boden.
Die Königin fiel in Ohnmacht, der König raufte sich die Haare, die Höflinge riefen sofort alle Ärzte zusammen, aber keine Macht war imstande, die Prinzessin wieder zum Leben zu erwecken. Man kleidete sie in kostbare Gewänder, legte sie in einen goldenen Sarg und setzte diesen in der königlichen Familiengruft bei. Der König befahl, dass Tag und Nacht ein Wachposten bei ihr stehe. Das ganze Land trauerte um die gute Prinzessin, am meisten aber jammerten die armen Eltern, denen alle Freude so rasch entrissen worden war.
Als in der ersten Nacht der Wachposten, der von elf bis zwölf Uhr am Sarg zu stehen hatte, abgelöst werden sollte, fand man ihn in mehrere Stücke zerrissen vor. Entsetzt blickte einer den anderen an, doch keiner konnte sich erklären, wie das geschehen war. Die Soldaten trugen den verunstalteten Körper aus der Gruft und meldeten es am Morgen dem König.
Der erschrak und gab den Offizieren den Befehl, den beherztesten Mann auf Wache zu schicken, um heraus zu bekommen, wer den Soldaten zerrissen habe. Aber in der nächsten Nacht geschah das gleiche, ebenso an allen folgenden Tagen: Den Posten, der von elf bis zwölf Uhr Wache hatte, fand man jedes Mal in Stücke zerrissen.
Die Soldaten murrten, dass sie der König um einer bloßen Laune willen in den Tod schicke, und unter dem Volke verbreitete sich das Gerücht, dass die verstorbene Prinzessin spuke. So ging es eine geraume Zeit, und im Heer des Königs gab es keine beherzten Soldaten mehr. Da nahm man sie denn der Reihe nach, mochten sie sein, wie sie wollten. Jeder zitterte wie Espenlaub, wenn die Reihe an ihm war, aber der Gehorsam ist eine strenge Geißel; ob man will oder nicht, man muss gehen und sein Leben einsetzen.
Nach einiger Zeit kam die Reihe an Bohumil, einen der sechs Söhne des Viehhirten. Er war ein hübscher, fröhlicher junger Mann, den jeder, der ihn kannte, von Herzen lieb hatte. Wäre er vom König gegen den Feind geschickt worden, hätte er keinen Augenblick gezaudert, aber der Wachdienst führte zu einem schimpflichen Tod. Deshalb bat er, zu seinen Eltern gehen zu dürfen, um von ihnen Abschied zu nehmen.
Unterwegs ließ er sich die Sache gründlich, durch den Kopf gehen und dachte bei sich: Warum soll ich mich mir nichts, dir nichts von irgendeinem Ungeheuer zerreißen lassen? Besser ist es, ich fliehe. Und schon bog er vom Weg ab und begab sich ins freie Feld. Er war bereits ein hübsches Stück gegangen, da sah er unter einem Baum einen buckligen alten Mann kauern; der hatte graues Haar und einen langen, schneeweißen Bart.
"Ich bitte dich, Soldat, hilf mir auf die Beine!" sagte der alte Mann zu dem Vorübergehenden Bohumil. "Mit Freuden", erwiderte dieser, "und wenn Ihr wollt, begleite ich Euch auch nach Hause, das heißt, wenn Ihr nicht in der Stadt wohnt." "In die Stadt würdest du also nicht mit mir gehen?" "Gott bewahre, dorthin möchte ich so bald nicht zurückkehren!" "Würdest du mir nicht den Grund dafür sagen?" "Warum sollte ich es nicht sagen? Ihr werdet mich wohl nicht verraten." Und Bohumil erzählte dem Alten die ganze Geschichte von dem unglücklichen Soldaten und bekannte schließlich, er sei geflohen, um einem so schimpflichen Tod zu entgehen.
"Höre, ich will dir einen Rat geben", sagte der Alte, als Bohumil geendet hatte. "Das Gespenst, das die Soldaten zerreißt, ist die verstorbene Prinzessin Lidumila, die für die Schuld ihres Vaters büßt. Der König hat sich gegen die göttliche Ordnung vergangen und sich ein Kind aus dem Willen des Teufels gewünscht. Nun ist die Arme von einem bösen Geist besessen und harrt ihrer Befreiung. Wenn du meinen Rat befolgst, so befreist du die Prinzessin und wirst glücklich sein."
"Ich will ihn befolgen, Großväterchen! Es verdrießt mich ohnehin, dass ich wie ein schlechter Kerl von meiner Truppe weg gelaufen bin." "So kehre zurück, und wenn die Zeit heran ist, zieh getrost auf Wache! Sobald du die Gruft betrittst, besprenge dich mit Weihwasser, ziehe mit dem Gewehr einen Kreis und bleib darin stehen! Mag geschehen, was will, gib nichts darauf und verlaß den Kreis nicht! Fürchten darfst du dich jedoch nicht, sonst ergeht es dir schlecht. Morgen komm zu mir und berichte, wie es dir ergangen ist!"
Bohumil dankte dem Alten und kehrte in die Stadt zurück. Wenn die Kameraden gedacht hatten dass er traurig sein werde, hatten sie sich geirrt; er lachte und sang, und als die elfte Stunde heran nahte, nahm er sein Gewehr und schritt frohen Mutes in die Kirche. "Gott gebe dir, dass du die Nacht gut überstehst!" sagten seine Kameraden, die ihn begleiteten. "Sollten wir uns aber nicht wieder sehen. .." "Auch ich hoffe", fiel ihnen Bohumil ins Wort, "dass wir uns wieder sehen. Ich will besser Obacht geben als die anderen, und ihr werdet sehen, dass ich das Geheimnis lüfte."
Darauf nahm er von ihnen Abschied und schritt durch die dunkle Kirche in die erleuchtete Königsgruft. Dort nahm er einen der rings um den Sarg stehenden vierundzwanzig Leuchter, auf denen Kerzen brannten, und leuchtete in alle Winkel, ob er dort etwas erblicke, aber er fand nichts. So stellte er sich denn in die Mitte der Gruft, beschrieb mit dem Gewehr einen Kreis, trat hinein, presste die Waffe an sich und harrte der Dinge, die da kommen würden. Wenn ihm bange ums Herz zu werden begann, sagte er sich die Worte des Alten vor, und die Angst war vorbei.
Da schlug es elf. Im gleichen Augenblick hob sich der goldene Deckel am Sarg der Prinzessin, und sie sprang heraus, ganz schwarz im Gesicht, und begann, wie ein böser Drache durch die Gruft zu fliegen. Gern hätte sie sich auf den Soldaten gestürzt, doch den magischen Kreis durfte sie nicht überschreiten. In ihrer Wut begann sie, die Deckel von den Särgen zu reißen und die vermoderten Gerippe aus ihnen heraus zu zerren. So wütete sie bis zwölf Uhr, dann sprang sie wieder in ihren Sarg. Der Deckel Schloss sich, und es war still. Obwohl Bohumil alles tapfer überstanden hatte, war er doch froh, als er die Schritte des ablösenden Postens vernahm.
Die Soldaten wunderten sich nicht wenig und freuten sich, als sie ihren Kameraden lebend und gesund wieder sahen. Sie fragten ihn gleich, wie es ihm ergangen sei und was er gesehen habe. "Was ich gesehen habe, habe ich gesehen, euch aber sage ich es nicht", erwiderte Bohumil, denn der Alte hatte ihm verboten, mit jemandem darüber zu sprechen. Am Morgen wurde der glückliche Ausgang gemeldet, und der König ließ Bohumil rufen und fragte ihn, was ihm in der Nacht erschienen sei.
"Gnädiger Herr König", erwiderte Bohumil, "das kann ich Euch nicht sagen. Wünscht es Euch auch nicht!" Als der König sah, dass es vergeblich war, in ihn zu dringen, bat er Bohumil, noch eine Nacht in der Gruft Wache zu stehen; er werde ihn dafür reich belohnen. Das versprach Bohumil. Am Nachmittag aber ging er vor die Stadt zu dem Alten. "Nun, wie ist es dir ergangen? Ist alles gut verlaufen?" fragte ihn der Alte, der unter demselben Baume saß. "Ja, und ich danke Euch vielmals für Euren Rat", antwortete Bohumil und erzählte, was sich begeben hatte. "Nun gut", sagte der Alte, "ziehe heute wieder auf Posten und tue in allem wie gestern! Du wirst vielleicht noch schlimmere Dinge sehen, doch sei ohne Furcht! Und morgen komm mich wieder besuchen !"
Bohumil dankte dem Alten und ging nach Hause. Als die elfte Stunde nahte, nahm er das Gewehr und eilte wohlgemut in die Gruft. Wie in der Nacht zuvor beschrieb er einen Kreis, stellte sich hinein und wartete ab. Kaum war der elfte Glockenschlag verhallt, öffnete sich der Sargdeckel, die schwarze Prinzessin sprang heraus, und wie auf ein Zeichen kamen aus allen Ecken grausame Ungeheuer mit feurigen Augen gekrochen und sperrten ihren entsetzlichen Rachen auf. Widerliche Fledermäuse und Eulen flogen Bohumil um den Kopf, und die Prinzessin tobte in der Gruft, sprang hier hin und dort hin, zerrte an den Leichen und schnitt Bohumil hässliche Fratzen. Der aber stand unerschrocken, auf sein Gewehr gestützt, und blickte auf diesen Auswurf der Hölle. Da schlug es zwölf, und alles war verschwunden.
Am Morgen fragte der König wieder, was Bohumil in der Gruft gesehen habe, aber dieser schwieg und verriet kein Wort. Am Nachmittag ging er wieder zu dem Alten und erzählte ihm alles. "Noch eine Nacht, und die Prinzessin ist von dem bösen Geist befreit", sagte der Alte zu ihm. "Aber wenn du willst, dass ich dir auch zum dritten Mal rate, musst du mir die Hälfte von allem geben, was du als Belohnung erhältst." "Das tue ich gern, Großväterchen, nur rate mir noch einmal, was ich machen soll."
"Geh also wieder in die Gruft, und wenn die Prinzessin aus dem Sarg springt, beeil dich und lege dich selbst hinein, doch vergiß nicht, über deinem Kopf einen Kreis zu beschreiben. Wenn die Mitternacht naht, wird die Prinzessin versuchen, dich aus dem Sarg zu verjagen, sie wird dich anflehen und dir gut zureden, dass du sie in den Sarg lässt, aber tue das nicht, sonst ergeht es dir schlecht. Was weiter geschieht, wirst du sehen." Bohumil versprach, alles so zu machen, wie es ihm der Alte geraten hatte, verabschiedete sich von ihm und lief in die Stadt.
Als es elf schlug, stand Bohumil bereits auf seinem Posten, und als die Prinzessin aus ihrem Sarg sprang, eilte er rasch hinzu, legte sich in den leeren Sarg und beschrieb mit dem Gewehr über seinem Kopf einen Kreis. Wieder begannen die entsetzlichen Ungeheuer einen wilden Reigen um den Sarg, aber den Kreis durften sie nicht überschreiten. Die Prinzessin trieb es noch ärger als in den Nächten zuvor, doch dann wollte sie Bohumil aus dem Sarg vertreiben. Als sie sah, dass er sich nicht von der Stelle rührte, geriet sie in fürchterliche Wut und zerfetzte ihr Kleid. Dann kniete sie nieder und flehte ihn inständig um alles in der Welt an, sie in den Sarg zu lassen, bevor die Stunde verstrichen sei, aber er tat, als höre er nicht. Als sie sah, dass auch das nichts half, versprach sie, ihm so viel Gold und Silber zu geben, dass er sich davon ein ganzes Königreich kaufen könne, doch auch darauf gab Bohumil keine Antwort.
Da begann plötzlich die Gruft in ihren Grundfesten zu beben, die vierundzwanzig Kerzen erloschen, und aus allen Winkeln züngelten blaue Flammen. Die Särge öffneten sich, die Knochenmänner erhoben sich daraus und bildeten einen Ring um den Sarg. Hand in Hand begannen sie einen wilden Tanz und fletschten ihre nackten Kiefer gegen Bohumil. Als er diese entsetzliche Gesellschaft erblickte, trat ihm kalter Schweiß auf die Stirn, aber er dachte an seine Aufgabe, Schloss die Augen und lag da, als wäre er selbst tot. Da erbebte die Gruft neuerlich, es schlug Mitternacht, und als Bohumil die Augen öffnete, sah er alles in der alten Ordnung, nur neben dem Sarg kniete, in ein inniges Gebet versunken, Prinzessin Lidumila, so schön, ja noch schöner, als sie je gewesen war.
Lange betrachtete Bohumil sie mit Wohlgefallen, und er wäre noch länger im Sarg liegen geblieben und hätte seine Augen nicht von der betenden Prinzessin losgerissen, wenn er nicht die Schritte der Ablösung gehört hätte. So stand er denn leise auf. Lidumila hob die Augen vom Boden, trat zu ihm und sagte mit lieblicher Stimme: " Wie kann ich es dir lohnen, mein tapferer Held, dass du mich aus den Banden der Hölle befreit hast?" Bohumil ergriff schweigend ihre Hand und drückte einen innigen Kuss auf ihre rosigen Finger. Da vernahmen sie von draußen Lärm, und die erschrockene Prinzessin schmiegte sich voll Angst an ihren Befreier.
Die Soldaten, die gekommen waren, um Bohumil abzulösen, blickten zuerst durch eine Ritze in der Tür, ob es ratsam sei, die Gruft zu betreten. Da sahen sie Lidumila, von hellem Licht umflossen. Sie dachten nicht anders, als dass es ein Engel sei. Deshalb machten sie kehrt und stürzten Hals über Kopf aus der Kirche. Das war der Lärm, der die Prinzessin erschreckt hatte. Die Soldaten meldeten unverzüglich den Offizieren, dass Bohumil in der Gruft mit einem Engel spreche. Das wurde auch gleich dem König gemeldet, der sofort mit ihnen in die Kirche eilte, um sich von der Wahrheit dieser Kunde zu überzeugen.
Als sie die Tür zur Kirche öffneten, sah der König den Soldaten Bohumil mit Lidumila vor dem Altar knien. Noch glaubte er seinen Augen nicht trauen zu dürfen, wusste er doch nicht, ob es wirklich seine Tochter war oder nur ihr Geist. Erst als sich Lidumila umdrehte und ihm mit einem freudigen Aufschrei in die Arme stürzte, drückte er sie fest ans Herz und vergoss heiße Tränen. Die Königin war gerade aufgestanden, als der König mit Lidumila und Bohumil ins Schloss zurückkehrte. Wie unaussprechlich war die Freude der Mutter, als sie die beweinte Tochter lebend und in voller Schönheit wieder sah!
Nun erst erzählte Lidumila, was sie erduldet und wie Bohumil sie befreit hatte. Da dankten ihm die Eltern, der König verließ für kurze Zeit den Raum und kehrte mit einem Beutel voll Dukaten zurück. "Nein, gnädigster Herr König", erwiderte Bohumil und schob das Geld zur Seite, "was ich getan habe, geschah nicht wegen einer Belohnung, und deshalb kann ich das Geld nicht annehmen." Da ergriff Lidumila die Hand des Königs und sagte: "Lieber Vater, er hat mich befreit, ich liebe ihn, und er liebt mich, und deshalb belohnst du ihn am besten, wenn du ihn als Sohn annimmst."
Der König dachte eine Weile nach, aber als ihn auch die Königin bittend ansah, ließ er sich erweichen und willigte in die Hochzeit ein. Bohumil fühlte sich wie im Traum und konnte es selbst noch nicht glauben, dass er der Gemahl der schönen Lidumila werden sollte. Der König wollte, dass die Hochzeit gleich gefeiert werde und Bohumil dann das Königreich übernehme. Der aber fürchtete, eine so schwere Kunst nicht zu verstehen, und bat deshalb den König, ihn zuerst in allem unterweisen zu lassen, was ein Herrscher wissen muss. Damit war der König einverstanden, und von diesem Augenblick an hatte Bohumil alle Hände voll zu tun.
Binnen kurzer Zeit lernte er alle Bedürfnisse seines Volkes kennen und erprobte alle Mittel, wie man sie am besten befriedigen kann, so dass er bald mehr wusste als der König selbst. Da wurde die Hochzeit gefeiert und danach Bohumil zum König gekrönt. Bei der Hochzeit vergaß der junge König nicht seine Eltern und seine Brüder, sondern setzte den Viehhirten neben den alten König. Das Vieh brauchte sein Vater freilich nicht mehr zu hüten, aber außer einem bequemen Ausgedinge im Königsschloß erhielt er von seinem Sohn keinen Reichtum und keinen Titel, sondern blieb wie zuvor der alte Vojta.
Jedem seiner Brüder gab Bohumil einen Bauernhof, und sie wurden brave Bauern, die ihrem Bruder nicht die zwar goldene, aber schwere Krone neideten. Schon war Bohumil einige Zeit mit seiner teuren Lidumila verheiratet, und beide liebten einander immer mehr und mehr, aber deshalb darf man nicht glauben, dass er vor lauter Glückseligkeit den Alten vergessen hätte, dem er sein Glück verdankte. Oft dachte er an ihn, und er hatte auch schon an den verschiedensten Stellen nach ihm Nachforschungen anstellen lassen, aber von dem Alten war keine Spur zu finden gewesen.
Eines Tages unternahm Bohumil mit seiner Frau eine Ausfahrt vor die Tore der Stadt. Da blieben die Pferde auf einmal an einer Brücke wie versteinert stehen und wollten nicht weiter. Der König rief dem Kutscher zu, er solle nachschauen, was ihre Fahrt behindere. Der erwiderte, am Tor sitze ein alter Mann, sonst aber sei nichts zu sehen. Da stieg der König selbst aus der Kutsche, und als er den Alten erblickte, erkannte er in ihm gleich seinen Ratgeber. Voll Freude ging er auf ihn zu und begrüßte ihn mit den Worten "Sagt mir doch, wo Ihr solange gewesen seid! Ich habe überall nach Euch gefragt, aber niemand konnte mir eine Nachricht geben." "Wenn du nach mir gefragt hast, so hast du wohl auch nicht dein Versprechen vergessen?" "Wie hätte ich das vergessen können - von allem, was ich erhalten habe, gehört die Hälfte Euch, Kommt nur rasch mit, damit ich Euch meiner Frau vorstellen kann!"
"Gerade, um sie geht es. Weißt du auch, Brüderchen, dass sie dir eigentlich nur zur Hälfte gehört?" Bestürzt blieb Bohumil stehen, Sein Blut schien zu Eis zu erstarren. Daran hatte er nicht gedacht. "Damit ich sehe, dass du immer und in allem dein Wort hältst und gerecht handelst, liefere mir den ersten Beweis! Nimm dein Schwert, schlage die Frau in zwei Hälften und teile sie mit mir!" Bohumil zuckte zusammen und sagte mit zitternder Stimme: "Fordere von mir nicht eine so grausame Tat! Lieber gebe ich dir das ganze Königreich !"
"Ich will aber nicht das ganze Königreich!" entgegnete der Alte hartnäckig. "Ich will nur die Hälfte des Königreichs und die Hälfte der Frau, und das darf ich gerechterweise fordern. Wenn du gerecht handeln willst, zögere nicht länger und opfere, was dir das liebste ist, damit du erkennst, welcher Sünde sich ein König schuldig macht, der ein gegebenes Wort bricht!" Da nahm sich Bohumil ein Herz und, um zu beweisen, dass er selbst einem abgerissenen Bettler ein gegebenes Wort hält, eilte er zu der Kutsche und eröffnete seiner teuren Gemahlin die schwere Pflicht.
Lidumila war eines solchen Mannes würdig. Um ihm das Herz nicht schwer zu machen, sprang sie ohne weitere Worte aus der Kutsche und trat zu dem Alten. Der König glaubte, dem Alten werde das schöne arme Geschöpf leid tun, aber der stand unbeweglich da, wie ein Fels. Zum letzten Male umarmten sich die Ehegatten, der König zog sein Schwert, holte aus und...
"Schlag nicht zu!" rief da der Alte. "Es war nur eine Probe, ob du gerecht regieren und immer dein Wort halten wirst. Jetzt sehe ich, dass ich mich in dir nicht getäuscht habe. Bleibe so bis zu deinem Tode, und der Himmel segne dich!". Ehe sich der König und die Königin dessen versahen, war der Alte ihren Blicken entschwunden. Nie aber verschwand er aus ihrem Gedächtnis. Bohumil herrschte bis zu seinem Tode gerecht und liebenswert, und sein Volk erlebte goldene Zeiten.
Theodor Vernaleken
DIE ENGLISCHE PRINZESSIN AFANASIE ...
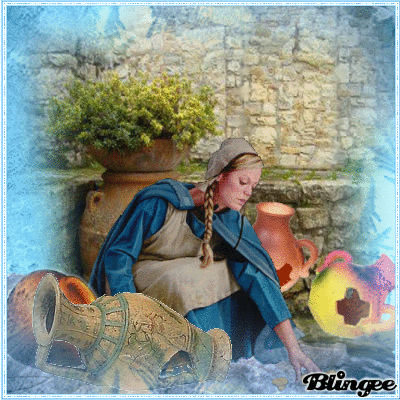
In alten Zeiten, war der französische Kaiser und der englische König befreundet, aber irgendwann führten sie Krieg miteinander und der französische Kaiser siegte. Nun zürnte ihm der englische König sehr.
Der französische Kaiser hatte ein Gemälde von der Prinzessin, der Tochter des englischen Königs, welche Afanasie hieß. Er hielt dieses Gemälde in einem Zimmer unter Verschluß, damit es keiner von seinen Söhnen zu sehen bekam, weil Afanasie wunderschön war.
Der eine Sohn hieß Ladislav, der andere hieß Rudolf. Rudolf war der jüngere. Einmal vergaß der Vater das Zimmer abzuschließen. Ladislav kam zufällig in das Zimmer, sah dort das Bild von Afanasie, die so schön war, dass ihm, sobald er sie gesehen hatte, das Herz vor Freude jubelte. Er beschloss bei sich und schwur zu Gott, dass er sie bekommen müsse. Er wusste zwar zu gut, dass sein Vater mit dem englischen König auf feindlichem Fusse stand, er achtete aber nicht darauf.
Er bat den Vater, dass er ihm erlaube in andere Städte zu reisen, um sich zu überzeugen, wie es mit der Ordnung im Heer stehe und wie das Heer lebe. Der Kaiser erlaubte es ihm. Also machte sich Ladislav auf und fuhr direkt zur See. Als er an der See ankam, bezahlte er ein Schiff für sich und fuhr auf die andere Seite des Meeres. Als er glücklich auf die andere Seite, nach England und dann in die Hauptstadt, wo der König war, gelangte, begab er sich glücklich zum Palast hin.
Als ihn der König erblickte, erkannte er in Ladislav sogleich den Sohn des französischen Kaisers. Der König befahl seinen Dienern, sie sollten Ladislav fest nehmen, binden und backen. Nachdem er gebacken war, ließ der König eine Kiste aus Brettern machen; in diese Kiste ließ er den gebackenen Körper steckten, vernageln und dann schickte er diese nach Frankreich. Er schrieb dem Kaiser, er solle sich das Gebackene gut schmecken lassen.
Der Kaiser, als er die Kiste bekam, verfiel mit seiner Frau in großen Kummer. Nun hatte er nur noch einen einzigen Sohn, Rudolf. Eines Tages ging der Kaiser auf die Jagd. Der Sohn war alleine im Schloss und weil er von dem Gemälde hörte, ließ er einen Schlosser holen, dem er befahl jenes Zimmer zu öffnen. Er wollte das Bild der Prinzessin sehen. Der Schlosser öffnete ihm das Zimmer. Er schaute sich das Bild an; und wie er das Bild so anschaute, beschloss er bei sich, dass er Afanasie bekommen müsse, dass er für sie lebe und leben werde.
Nach einiger Zeit bat Rudolf den Vater, er möge ihm erlauben die Städte zu bereisen, um zu sehen, wie das Volk in anderen Städten lebt. Der Kaiser wollte es ihm aber nicht erlauben. Nicht einmal hören wollte er davon, weil er nur den einen Sohn noch hatte. Er dachte bei sich: »Ach was, wenn er etwas von der Prinzessin weiß und auch nach England reisen wird, da könnte ich ihn auch verlieren.«
Rudolf bat ihn aber täglich, er solle ihn reisen lassen, und wenn er um ihn so eine Furcht hege, solle er ihm zehn Soldaten als Wache mitgeben. Nun willigte der Kaiser ein. Alle Soldaten mussten einen Eid ablegen, sie wollten den Kopf verlieren, wenn sie ohne Rudolf zurück kämen, oder wenn ihm etwas geschehe. Rudolf trat also mit den Soldaten die Reise an.
Er reiste geraden Weges zum Schwarzen Meere. Dort mietete er ein großes Haus; und die Soldaten mussten überall mit, wohin er auch ging; so fürchteten sie nicht, dass sie ihn irgendwo verlieren könnten. Eines Tages bezahlte Rudolf heimlich einen Kapitän, dass er ihn auf seinem Schiff mit nehme. Abends zog er sich in sein Zimmer zurück und befahl seinen Soldaten, ihn am nächsten Morgen nicht um sieben, sondern um acht Uhr zu wecken. In der Nacht, als die Soldaten im Hause schliefen, schlich er sich aus dem Hause fort und ging auf das Schiff. Wie er es betrat, stach das Schiff gleich in die See. -
Die Soldaten gingen früh um acht Uhr Rudolf wecken, aber Rudolf antwortete ihnen nicht. Sie warteten also eine halbe Stunde. Sie gingen wieder hin, um ihn zu wecken, aber niemand antwortete ihnen. Sie gingen zu einem Schlosser, der Schlosser öffnete ihnen das Zimmer, Rudolf war nicht darin. Also klagten sie um den Prinzen, weil sie wussten, dass sie ihren Kopf verlieren würden, weil sie vor dem Kaiser schworen und nun ohne Rudolf nach Hause kommen würden. In der Stadt warteten sie drei Tage und suchten Rudolf überall aber sie konnten ihn nicht finden.
Nach drei Tagen rückten die Soldaten aus und kehrten nach Hause zurück. Sie kamen zum Kaiser und erzählten, was mit dem Rudolf geschehen ist, dass sie ihn verloren haben und dass sie ohne ihn nach Hause kommen. Der Kaiser war so zornig, dass er alle ins Gefängnis werfen ließ. Er sagte: »Tag und Jahr werdet ihr im Gefängnis bleiben. Wenn Rudolf nach einem Jahr und einem Tag zurück kehrt, werdet ihr Gnade bekommen; kehrt er aber nicht zurück, wird ein jeder um seinen Hals kürzer werden.«
Rudolf setzte glücklich über das Meer hinüber. Als er an Land kam, begegnete er einem Bettler. Er sagte zu diesem: »Bettler, ziehe dein zerrissenes Kleid aus und ich gebe dir mein schönes dafür, lass uns mitsammen tauschen.« Der Bettler antwortete: »Habt mich nur nicht zum Narren deswegen, dass ich zerrissen herum laufe.« Rudolf sagte: »Ich halte Dich nicht zum Narren, ziehe dich nur aus, ich ziehe mich auch aus und wir tauschen.«
Als der Bettler sah, dass Rudolf sich auszieht, zog er sich auch aus. Rudolf legte die zerrissenen Kleider an. Der Bettler zog die Kleider des Rudolf an. Der Bettler musste dem Rudolf noch seinen zerrissenen Korb geben mit einigen Brotstücken darin. Nun sah Rudolf in dem Kleide aus, wie wenn er fünfzig Jahre alt wäre. Stets bettelnd, begab sich Rudolf in die Stadt, wo der König wohnte.
Als er in die Burg kam, schlug es gerade 12 Uhr Mittags. Die Wache wechselte und Rudolf kroch unter dessen unter, bis er in die Burg gelangen konnte. Der König speiste eben mit der Prinzessin zu Mittag. Rudolf öffnete die Tür und bettelte. Der König sprangt erbost in die Höhe und schrie: »Was ist das für eine Ordnung, dass die Wache einen Bettler in die Burg hinein lässt? Der Bettler wird heute gehenkt und die ganze Wache wird mit ihm aufgehängt.«
Die Prinzessin bat den Vater, er solle den Wachen das Leben schenken, und er sprach: »Wenigstens an dem Bettler, werde ich mich rächen.« Die Prinzessin bat den Vater, er solle auch dem Bettler das Leben schenken, denn sie sehe ihm an, dass er ein Narr oder recht dumm sei; und außerdem sollte man auf jeder Burg einen Narren haben. Afanasie bat den Vater, dass er den Bettler als Gärtnergehilfen einstelle, da der Gärtner schon zu alt sei.
Der König ließ also den Gärtner rufen. Der Gärtner kam, der König sagte: »Gärtner, da haben Sie einen Mann, ich will, dass Sie ihn die Gärtnerei lehren.« Die Prinzessin gab Rudolf saubere Kleider und einen schönen Hut. Als Rudolf die sauberen Sachen anlegte und sich abwusch, war aus ihm so ein schöner Mensch geworden, und die Prinzessin hatte ihr Lebtag keinen so schönen Menschen gesehen. Sie hatte sich ganz und gar in ihn verliebt.
Nun also arbeitete Rudolf im Garten. Der Gärtner zeigte ihm alles und sagte: » Siehe her Rudolf, diese Blumen liebt die Prinzessin am meisten. Die wirst du schön behacken und das Gras auspflücken; dann musst du sie schön gießen, damit sie wachsen.« Rudolf antwortete: »Onkel, das tue ich.« Der Gärtner ging fort, und Rudolf pflückte alle Blumen raus, und das Gras behackte er schön und begoss es. Als der Gärtner zurück kam, war er entsetzt und sprach: »Um Gottes willen, du hast die schönen Blumen ausgepflückt, und das Gras hast du stehen lassen, behackt und begossen; nun siehst du, du Esel, was du angestellt hast!« Und gab ihm eine Kopfnuss.
Rudolf fing an zu weinen und lief zum König und sagte: »Der Onkel, der Gärtner hat mich geschlagen.« Der König ließ den Gärtner rufen: »Warum hast Du ihn geschlagen?« »Euer königliche Majestät, er rupfte mir die schönsten Blumen aus und warf sie weg aber das Gras behackte er. Ich habe ihm gesagt, er solle das Gras auspflücken und die Blumen behacken, und er tat es umgekehrt. Euer königliche Majestät, ich verzichte lieber auf seinen Dienst, als ihn noch in der Lehre zu behalten und mich zu ärgern.«
Der König sagte: »Nun, ich werde Dir was sagen, Gärtner: weis ihm ein Stück Garten an, laß ihn dort ein Häuschen bauen, dort soll er alleine seine Blumen pflegen. Der Gärtner ging also und wies ihm ein Stück Garten zu, ließ ihn ein Häuschen bauen und Rudolf konnte seine eigenen Blumen ziehen und pflegen.
Es wuchs dort aber nichts anderes als Klettenkraut und daran irgendwelche Knöpfe; und das Klettenkraut behackte er so schön - bis der Gärtner einmal zu ihm kam. Er sagte: »Siehst du, du Esel, da hast du dein Gras schön behackt; was hast du davon? Nichts. Morgen ist der Afanasie ihr Namenstag, jeder Bursche wird ein schönes Bouquet aus Blumen machen, und jeder wird eine schöne Gabe von der Prinzessin bekommen; ich bin gespannt, was du für ein Bouquet machen wirst.« Rudolf antwortete: »Ich werde schon ein Bouquet machen, Onkel.«
In der Nacht ging Rudolf in den Garten, pflückte die schönsten Blumen und machte ein schönes Bouquet; er band es mit einer goldenen Kette zusammen, befestigte einige Ringe darauf, und trug es zur Prinzessin an ihrem Namenstag. Der Gärtner sah wie Rudolf in die Burg hineinging; er passte auf, bis er zurück kommen würde. Als Rudolf in die Burg kam, wünschte er der Prinzessin so schön, dass sie ihn verwundert ansah - und da reichte er ihr das schöne Bouquet. Es hatte ihr so gut gefallen, dass Sie ihm den Hut voll von goldenen Dukaten gab. Er nahm diese und lief damit in seine Hütte.
Der Gärtner aber lief ihm hinter her und fragte: »Rudolf, was hast du von der Prinzessin bekommen?« Rudolf sagte: »Schaut nur, was sie mir gab: den Hut voll von Knöpfen, und die haben nichtmal Löcher; ich kann sie nicht auf meinen Rock annähen. Was soll ich also damit machen? Nimmt es euch Onkel.« Der Gärtner schnappte danach und lief voll Freude nach Hause; »Schau nur, Weib, wie der Mensch dumm ist. Die Prinzessin gab ihm den Hut voll von Dukaten, und er denkt, es seien Knöpfe; so sagte er zu mir, ich solle mir sie nehmen.«
Alsbald schickte die Prinzessin zu Rudolf ihre Gouvernante. Die Gouvernante sprach: »Herr Gärtner, die Prinzessin lässt Euch fragen, was Sie haben wollen, wenn Sie ihr noch ein Bouquet machen?« Er antwortete: »Einen Schub gegossener, mit Pflaumenmus geschmierter Talken.« Die Prinzessin willigte. Er machte also noch ein schönes Bouquet und trug es ihr in die Burg. Dieses Bouquet war aber noch Mal so schön als das erste. Er reichte es der Prinzessin. Sie nahm es und lachte ihn an. Der Schub gegossener Talken war bereit, die Gouvernante beschmierte sie mit Pflaumenmus, und er aß sie; anstatt aber, dass er sie, so wie sie da lagen, der Länge nach essen sollte, aß er sie der Breite nach und beschmierte sich das ganze Gesicht, so dass die Prinzessin als sie ihn ansah, wie beschmiert er war, sich des Lachens nicht enthalten konnte.
Die Prinzessin sagte zu Rudolf: »Herr Gärtner, was muss ich Ihnen geben, wenn Sie mir noch ein Bouquet machen?« Rudolf antwortete: »Nehmt mich mit in Euer Schlafgemach. « Sie sprach: »Es gilt«, aber nur weil Rudolf ein sehr schöner Mensch war. Er ging also und noch am selben Tage machte er ein noch schöneres Bouquet, das band es mit einer goldenen Kette, an der eine kleine goldene Uhr angehängt war. Als Rudolf das Bouquet der Prinzessin reichte; nahm sie es und schaute Rudolf an und lachte freundlich. Am Abend ging er also mit der Prinzessin in ihr Schlafgemach; und das die ganze Nacht - aber statt dass er sie berührt hätte - kümmerte er sich nicht einmal um sie.
Morgens sagte die Prinzessin zur Gouvernante: »Denken Sie sich nur, er kümmerte sich gar nicht um mich.« Dann ließ sie ihn wieder rufen: »Herr Gärtner, was muss ich geben, wenn Sie mir noch so ein Bouquet machen? Das wird aber das letzte sein.« »Nehmt mich noch einmal mit zum Schlafen.« Die Prinzessin war mit einverstanden. Er ging also und machte noch ein Bouquet, darauf band er Gold und allerlei wertvolle Kleinodien, dass das Bouquet viele Tausend Dukaten wert war. Er brachte es der Prinzessin; die Prinzessin nimmt es in die Hand und gibt Rudolf einen schönen Kuss dafür, weil er ein so bildschöner Mensch war. Sie dachte aber im Herzen bei sich an Rudolf und er an sie.
Abends gingen sie schlafen, sie fragte ihn verschiedenes aus, woher er sei. Er sagte zu ihr, er sei aus einem anderen Lande, eines Kaufmanns Sohn. Sie liebkosten also miteinander in der Nacht. Sie gaben sich das Gelübde, einer dem anderen, dass sie heiraten würden. Nach einiger Zeit bemerkte Rudolf, dass die Prinzessin schwanger sei, so überlegte er, wie er mit der lieben Prinzessin über das Meer fliehen könnte. Und davon wusste niemand außer Rudolf, die Prinzessin und die Gouvernante.
Eines Tages wurden der König und die Königin in ein Städtchen auf ein Gastmahl geladen. Nun bereitete sich Rudolf mit der Prinzessin auf die Reise vor, sie nahm alle ihre Kleider und viel Geld mit. Rudolf ging, bezahlte das Schiff und sie segelten auf die andere Seite des Meeres. Der Gouvernante hatte sie verboten, jemandem etwas zu sagen, bis der König nach Hause kommt und fragt, wo die Prinzessin sei, dann solle sie sagen, sie wisse es nicht.
Der König kam nach Hause. Früher, wenn er von irgendwo zurück kehrte, lief ihm die Prinzessin immer entgegen; aber nun kam sie ihm nicht entgegen. Er fragte die Gouvernante: »Wo ist die Prinzessin?« Sie sagte, sie habe sie am Abend in ihr Gemach begleitet, aber in der Frühe, als sie öffnen kam, war niemand drinnen. Er fragte: »Wo ist Rudolf?« Sie sagte, dass sie es nicht wisse. Er schickte sogleich Diener in den Garten, den Rudolf zu suchen. Rudolf war nirgends zu finden. Der König ließ sofort ein Schreiben aufsetzen, welches an jede Ecke geklebt wurde: dass derjenige, der den Rudolf lebendig bringen wird, fünfzig Tausend Dukaten Kopfgeld für ihn bekommt.
Rudolf gelangte mit der Prinzessin Afanasie glücklich auf die andere Seite des Meeres. An Land kaufte Rudolf einen schönen Wagen und Pferde, und sie fuhren nach seiner Heimat. Als sie so einige Tage fuhren, sagte Rudolf zur Afanasie: »Sieh her, ich habe kein Geld mehr, ich muss die Pferde und den Wagen verkaufen, und kaufe bloß ein Pferd und eine Droschke.« Sie antwortete ihm: »Teurer Rudolf, ich bin zufrieden.«
Nun fuhren sie wieder einige Tage. Da sagte er: »Siehe, teure Afanasie, ich habe kein Geld mehr; wir verkaufen das Pferd samt der Droschke und kaufen uns einen Schubkarren. Eine Weile ziehe ich dich, dann ziehst du mich.« Sie antwortete: »Ich bin zufrieden.« Er kaufte also den Karren, setzte sie hinein und setzte mit ihr den Weg fort. Afanasie war solche Strapazen nicht gewöhnt; weil sie jedoch Rudolf sehr lieb hatte, wollte sie sich an alles gewöhnen. Er sagte zu ihr: »Sieh, teure Afanasie, ich habe kein Geld mehr, und so ein seidenes Kleid, wie du es anhast, pflegt man bei uns nicht zu tragen. Du musst dir einen kurzen, roten Oberrock, nur bis an die Knie, und eine rote Jacke und für den Kopf ein Kopftuch kaufen.« Sie tat, was er von ihr verlangte.
So gelangten sie zur königlichen Stadt. Da sagte Rudolf zu ihr: »Bleibe hier bei dem Karren; ich muss zu meiner Mutter gehen und dich bei ihr anmelden, und fragen ob ich dich in ihr Häuschen mitbringen darf. Dann muss ich dir noch sagen, ich bin kein Kaufmannssohn, ich bin der Sohn einer Hökerin, und die ist sehr böse. Ich werde dich anmelden gehen.« Sie antwortete: »Gehe nur, teurer Rudolf.« Und dann weinte die Arme. Sie sprach zu ihm: »Siehe, was für einer Herkunft ich bin; und du hast mich in so ein Unglück gebracht.«
Rudolf fand also eine Hökerin und sagte zu ihr: »Du, Alte, ich sage dir: Ich führe mit mir eine Prinzessin von England, ich bin Prinz Rudolf. Wenn ich dir meine Prinzessin herführe, schimpfe sie tüchtig aus und sage: 'Was für einen Schandbalg hast du dir mitgebracht?' Dass du mir sie ja nicht hinein lässt!« Und Rudolf machte sich auf und ging, um die Prinzessin zu holen.
Die Arme wartete schon auf ihn. Er sprach: »Komm Afanasie, ich habe dich bei meiner Mutter angemeldet.« Sie zog den Karren und er schob. Wie sie also in das Häuschen, wo die Hökerin wohnte, ankamen, lief diese heraus und schimpfte: »Du mordsverfluchte Seele, so einen Schandbalg hast du dir mitgebracht?« Die Alte schimpfte und schrie in einem fort. Als dessen genug war, winkte ihr Rudolf zu, und sie hörte damit auf. Sie gingen ins Zimmer und sie sagte: »Was soll ich euch zu Essen geben, wenn ich selbst nichts habe?«
Rudolf sagte zur Hökerin: »Gebt uns irgendwas zum Essen, wir haben Hunger.« Die Hökerin hatte noch gekochte Erdäpfeln zum Schälen. Sie ging also, nahm die Erdäpfel samt dem Topf und schüttete sie auf den Tisch aus und sagte: »Etwas anderes kann ich euch nicht geben.« Afanasie schaute das Essen an und dachte bei sich: »Gott, was habe ich nur getan? Ich bin doch in einer königlicher Burg geboren und jetzt bin ich in so ein Elend geraten.« Sie wusste nicht einmal, was für eine Speise es war; also aß sie die Erdäpfel samt den Schalen, weil sie nicht einmal wusste, wie man sie schälen soll. Nach zwei, drei Erdäpfeln hatte sie genug und sagte, dass sie gesättigt sei.
Rudolf sagte zu Hökerin: »Mütterchen, wir haben kein Geld mehr; wißt Ihr von keiner Arbeit hier, damit wir uns ernähren können?« Die Hökerin sagte: »Ja, ich weiß von einer Arbeit. Morgen geht man die Hopfengärten behacken, da könnt Ihr mitgehen, um euch das Brot zu verdienen. Rudolf sagte: Teure Afanasie, du musst also den Hopfengarten behacken gehen, und ich werde mir in der Stadt eine Arbeit suchen, damit wir davon leben können.«
Die Hökerin brachte eine Hacke, zeigte sie der Afanasie, diese fragte: »Wie nimmt man es denn in die Hand?« Die Hökerin gab ihr die Hacke in die Hand, und zeigte, wie man damit hackt. Dann führte sie Afanasie ins Feld damit sie dort arbeite. Die arme Afanasie hatte noch nie mit ihren Händen gearbeitet, sie weinte also, und bedauerte sich, weil sie sich betrügen ließ und von den Eltern fort ging. Rudolf sagte zu ihr: »Hacke hier, teuere Afanasie, und ich gehe in die Stadt mich auch nach einer Arbeit umsehen, und in einer Weile komme ich nach dir zu schauen.« Damit wollte er sie nur prüfen, ob sie ihm treu ergeben sei, egal was er auch machte. Alsbald machte er sich auf und ging geraden Weges zu seinem Vater ins Schloss.
Wie ihn der Kaiser sah, war die Freude sehr groß und sie fielen sich in die Arme. Rudolf fragte: »Wo sind die Soldaten, die Du mit mir ausgeschickt hast?« Der Kaiser sprach: »Morgen sollen sie alle gehängt werden aber nachdem du nun zurück gekehrt bist, werden sie alle Pardon bekommen.« Der Kaiser befahl, dass die im Gefängnis sich befindenden Soldaten auf freien Fuß gesetzt werden sollen. Rudolf erzählte dem Vater sein Geheimnis, welches er bewahrte, dass er Afanasie dem englischen König stahl und mit ihr in die Stadt kam. Der Kaiser fragte ihn, wo er Afanasie gelassen habe. Rudolf erzählte ihm, sie sei bei einer Hökerin und behacke den Hopfengarten; und dass er sie prüfe, ob sie ihm treu ergeben sei.
Kurz darauf ging Rudolf in die Stadt und pachtete dort ein Wirtshaus. In diesem Wirtshaus verkaufte man Branntwein, Semmeln und Würste. Als die Soldaten vom Exerzieren wieder zurück ritten, kehrten sie dort ein und brachten viel Geld ein. Rudolf machte sich auf und ging aufs Feld zur Afanasie. Sie fing gleich an zu weinen, als sie ihn sah und sagte: »Schau, Rudolf, wie mir das Blut aus den Händen fließt! Du weißt nur zu gut, dass ich mein Lebtag noch nie so hart arbeiten musste und jetzt muss ich es. « Er antwortete ihr: »Komm mit mir, Afanasie,« und nahm ihr die Hacke ab und trug sie selbst. »Teuere Afanasie, ich habe für dich eine bessere Arbeit gefunden. Ich habe ein Wirtshaus gemietet. Dort wirst du Branntwein, Semmeln und Würste an Soldaten verkaufen.« Sie sprach zu ihm: »Weißt du, Rudolf, das ist was für mich. Es wird eine bessere Arbeit sein.«
Er führte sie also hin zum Wirtshaus. Dann ging er und überredete die Soldaten, sie sollten - wenn sie vom Exerzieren zurück kehrten - im Wirtshaus alles austrinken, alles aufessen und dann alles zerschlagen, Afanasie aber sollten sie nichts Böses antun. Die Soldaten kehrten im Wirtshaus ein und taten, wie ihnen befohlen wurde. Sie tranken den Branntwein leer, aßen die Semmeln und die Würste auf, und alles andere zerschlugen sie in Stücke. Die arme Afanasie schaute dem Treiben zu und ging weinend nach Hause zur Hökerin. Dort war auch schon Rudolf.
Sie sagte zu ihm: »Schau, Rudolf, wie es mir ergangen ist, was die Soldaten angerichtet haben; alles aßen sie auf, alles tranken sie mir aus, und was sie nicht ausgetrunken haben, das haben sie auslaufen lassen und dann haben sie alles klein geschlagen.« Rudolf sagte: »Kennst du sie?« Sie antwortete: »Ich kenne keinen, sie haben alle den gleichen Anzug angehabt.« weiter sagte sie: »So etwas durfte bei uns nicht geschehen.« Rudolf sagte: »Warte, teuere Afanasie, ich werde dir etwas Besseres finden.«
Alsbald ging Rudolf auf den Markt und kaufte dort allen Töpfern ihre Töpfe und Schüsseln ab und ließ die Ware auf dem Marktplatz aufbauen. Dann ging er und überredete die Dragoner, wenn Afanasie dort verkauft, dann sollen sie mit ihren Pferden in die Töpfe hineinreiten, alles zertreten und zerschlagen, aber Afanasie darf niemand Böses antun. Nun ging Rudolf Heim zur Hökerin und sagte: »Teuere Afanasie, ich habe dir nun ein besseres Geschäft eingerichtet. Du wirst auf dem Marktplatz Töpfe und Schüsseln verkaufen.« Sie antwortete ihm: »Das, teuerer Rudolf, das wird doch etwas Besseres sein.«
Sie ging also auf den Marktplatz, setzte sich auf einen Stuhl zu ihren Töpfen und verkaufte dort. Als die Soldaten vom Exerzieren zurück kamen, lenkten sie ihre Pferde in die Töpfe hinein, zertraten alles, ihr aber hatten sie nichts Böses angetan. Nachdem sie fort geritten waren, ging Afanasie weinend und suchte unter den Scherben, ob irgend etwas noch ganz wäre; sie fand einen Topf, stellte ihn auf die Hand, klopfte auf ihn ab, ob er noch ganz ist. Sie fand nur wenig, was nicht zerstört war und dann machte sich auf und ging zu der Hökerin.
Rudolf, der heimlich zugesehen hatte, als ihr die Reiter die Töpfe zertraten, wartete schon auf sie. Sie kam weinend zuhause an. »Was ist dir geschehen, teuere Afanasie, dass du weinst?« »Schau nur, teuerer Rudolf, die Soldaten sind mir mit ihren Pferden in die Töpfe hinein geritten und zerschlugen und zertraten alles, und ich habe keinen Kreuzer eingenommen. »Kennst du sie?« fragte er sie. »Ich kenne keinen von ihnen.« »Warte, teuere Afanasie, ich habe für dich eine bessere Arbeit gefunden. Du wirst im kaiserlichen Schloss, in der Küche arbeiten, denn es soll ein großes Fest ausgerichtet werden. Ich habe im Schloss auch eine Anstellung bekommen, ich reinige dort die Gänge, aber ich bin dort ohne Kost angestellt, also musst du immer danach trachten, dass du für mich von dem Essen etwas einsteckst.«
Gesagt, getan. Rudolf führte sie also ins Schloss, in ihrem kurzen Überkleid. Nun kamen alle sie anzusehen und sie erntete viel Spott. Afanasie arbeitete in der Schlossküche und steckte jedesmal vom Frühstück etwas für ihn ein und vom Mittagsessen auch. Sie band sich unter die Röcke, um ihre Hüfte, zwei Töpfe; in dem einen war die Suppe, in dem anderen das Fleisch und die Brühe. Sie wollte es Rudolf geben, wenn es niemand sah. Sie machte sich auf die Suche nach Rudolf, denn sie meinte er würde vielleicht irgendwo im Schloss den Gang kehren.
Im Schloss arbeitete ein alter, hinkender Lakai, der wurde von Rudolf angewiesen, er solle auf Afanasie Acht geben und ihm Bescheid sagen, wenn sie etwas von dem Essen verstecken würde. Sobald Rudolf vom Lakai wusste, dass Afanasie das Essen versteckt hatte, ging er in den Saal, wo dreißig Musikanten sassen, denen befahl er zu spielen, und wenn sie aufspielten dann musste jedermann, der im Schloss war, tanzen.
Als Afanasie den Saal betrat, kam Rudolf in der Aufmachung eines Lakaien auf sie zu, und nahm sie zum Tanz. Der Kaiser, die Kaiserin und der ganze Hof schaute dabei zu, als Rudolf mit Afanasie tanzte und ihr dabei der Topf mit der Brühe heraus fiel. Die Arme wurde ganz rot und schämte sich. Rudolf tanzte jedoch unbeirrt weiter mit ihr; und dann fiel ihr noch der zweite Topf mit dem Essen heraus. Sie schämte sich noch mehr und wollte weg laufen.
Der Kaiser mit der Kaiserin konnten es nicht mehr mit ansehen; der Kaiser ging also, nahm Afanasie bei der Hand, führte sie in ein Zimmer, und sagte: »Komm, teuere Afanasie, du bist unsere geliebte Tochter« und klärte sie auf. Er gab ihr sogleich ein Kleid, wie es sich für eine Prinzessin ziemt. Sie sah so wunderschön darin aus, dass der Kaiser seine helle Freude daran hatte und sehr stolz darauf war, dass Prinz Rudolf, sein Sohn, Afanasie als seine Braut Heim führte.
Der Kaiser schickte dem König von England ein Friedensangebot, er solle sich mit ihnen versöhnen kommen, weil sein Sohn, Prinz Rudolf, seine Tochter, die Prinzessin Afanasie heiraten werde.
Wie der König den Brief bekam und ihn las, so hatte er große Freude daran, dass seine Tochter am Leben sei. Er machte sich also auf die Reise und kam nach Frankreich zum Kaiser. Der Kaiser begrüßte den König freundlich, und Prinzessin Afanasie war überglücklich ihren Vater wieder zu sehen. Dann feierten Rudolf und Afanasie eine sehr schöne, große Hochzeit, und alle, Kaiser, Kaiserin und König wurden zur Hochzeit geladen. Nach der Hochzeit verabschiedete sich der englische König von ihnen und reiste in seine Heimat und wünschte dem Paar alles Gute. -
Tschechien: Václav Tille, böhmisches Märchen
DER FEUERVOGEL ...
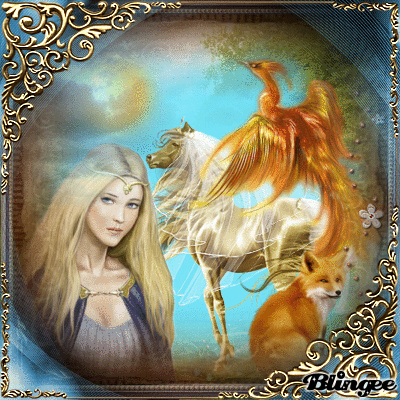
Es war einmal ein König, der hatte einen wunderbaren Garten mit vielen seltenen Bäumen. Der kostbarste von ihnen war ein Apfelbaum, der in der Mitte des Gartens stand. Jeden Tag trug er einen goldenen Apfel. Am Morgen warf er seine Blüten ab; während des Tages wuchs der Apfel und wurde reif, bevor der Abend kam. Aber in der Nacht darauf, verschwand der Apfel jedes Mal, und niemand wusste, wie es zuging. Das verdross den König sehr.
Eines Tages ließ er seinen ältesten Sohn zu sich kommen und sprach zu ihm: "Mein lieber Sohn, heute Nacht sollst du in meinem Garten wachen. Wenn du heraus bekommst, wer meine Äpfel stiehlt, wirst du reich belohnt werden. Gelingt es dir, den Dieb zu fangen, gebe ich die Hälfte meines Königreiches." Der Prinz gürtete sein Schwert, schulterte seinen Bogen, steckte sich einige Pfeile in den Gürtel und begab sich, als es Abend wurde, in den Garten.
Er ließ sich unter einem Apfelbaum nieder und wartete. Nach einiger Zeit übermannte ihn die Müdigkeit, ob er wollte oder nicht, er konnte sich ihrer nicht erwehren. Seine Hände fielen ins Gras, er schloss die Augen und schlief wie ein Klotz bis zum Tagesanbruch. Als er erwachte, war der Apfel verschwunden. "Nun", sagt der König, "ich möchte wissen, ob du den Dieb gesehen hast." - "Es war niemand da", entgegnete der Prinz. "Der Apfel löst sich in Luft auf." Der König schüttelte den Kopf, ihm kam es unglaubwürdig vor.
Er wandte sich an den zweiten Sohn: "Heute Nacht", sagte er, "sollst du wachen. Wenn du den Dieb entlarven kannst, sollst du reich belohnt werden." Als es Abend war, bewaffnete sich der zweite Prinz wie sein Bruder und ging in den Garten, um Wache zu halten. Aber auch er schlief unter dem Apfelbaum ein, und als er am nächsten Morgen erwachte, war der Apfel verschwunden. Als sein Vater ihn fragte, wer den Apfel genommen hätte, erwiderte er: "Niemand, der Apfel verschwand einfach." Jetzt meldete sich der jüngste Prinz zu Wort. "Vater", sagte er, "heute nacht will ich wachen, denn ich möchte herausfinden, wer die goldenen Äpfel stiehlt." - "Mein lieber Junge", sagte der König zu ihm, "du wirst auch kein Glück haben. Wie kannst du hoffen - jung und unerfahren wie du bist -, mehr Erfolg zu haben als deine Brüder? Wenn es aber dein Wunsch ist, magst du es versuchen."
Am Abend begab sich der jüngste Sohn in den Garten, um zu wachen. Er nahm ein Schwert, einen Bogen und einige Pfeile mit und außerdem noch seine Igelhaut. Er setzte sich unter den Apfelbaum und legte die Haut auf seinen Schoß. Um Mitternacht kam ein goldener Vogel und ließ sich in dem Apfelbaum nieder. Er begann am Apfel zu picken, aber der Prinz hob den Bogen, und sein Pfeil traf eine Schwinge des Vogels. Der Vogel flog fort, eine seiner goldenen Federn fiel aber zur Erde. Der Apfel hing noch am Baum. "Nun", erkundigte sich der Vater am nächsten Morgen, "hast du den Dieb gefangen?"
"Nein", antwortete der Prinz, aber es wird schon werden. Zunächst habe ich dir ein Stück von seinem Gewand mit gebracht." Der Prinz zeigte seinem Vater die goldene Feder und erzählte ihm sein nächtliches Erlebnis. Dem König gefiel die Feder über alle Maßen, denn sie war so schön und erstrahlte in so hellem Glanz, dass man abends in den königlichen Gemächern keine Kerzen anzünden brauchte. Diejenigen unter den Hofleuten, die davon erfuhren, behaupteten, die Feder stamme von einem Vogel, den man Feuervogel nenne und der von viel, viel größerem Wert sei als alle Schätze, die der König besaß.
Von da an erschien der Feuervogel nicht mehr im Garten, und auch die Äpfel verschwanden nicht mehr. Doch der König konnte keine Freude mehr darüber empfinden, denn er dachte beständig an den Vogel, und sein sehnlichster Wunsch war, ihn zu besitzen. Dieses Verlangen quälte ihn und nagte so an seinem Herzen, dass er darüber krank wurde.
Eines Tages ließ er seine drei Söhne zu sich rufen: "Meine lieben Kinder", sagte er zu ihnen, "ihr seht selbst, dass ich wieder meine Gesundheit zurück erhalten würde, wenn ich den Feuervogel singen höre. Wer mir den Vogel bringt, dem werde ich die Hälfte meines Königreiches geben, und nach meinem Tode soll er mein Nachfolger sein."
Ohne zu zögern nahmen die Söhne Abschied von ihrem Vater, bestiegen ihre Pferde und machten sich auf die Suche nach dem Vogel. Sie gelangten bald an eine Wegkreuzung mitten im Wald. "Welchen Weg wollen wir wählen?" fragte der älteste Bruder. "Wir sind drei", erwiderte der zweite, "und vor uns sind drei Wege. Wenn wir in drei Richtungen reiten, wird einer von uns den Feuervogel finden." "Und welchen Weg soll jeder von uns nehmen?" wollte der Älteste wissen. "Jeder sucht sich einen aus", schlug der Jüngste vor. "Ich werde den nehmen, der übrig bleibt."
Die älteren Brüder waren damit einverstanden, und jeder wählte eine Straße. Einer von ihnen schlug vor: "Lasst uns hier ein Zeichen setzen, so dass derjenige, der zuerst zurück kommt, weiß, wie es den anderen ergangen ist. Wir wollen jeder einen Zweig in die Erde pflanzen, und dies soll ein Zeichen sein: Wessen Zweig Wurzeln schlägt, der hat den Feuervogel gefunden." Dieser Gedanke gefiel allen, und bevor sie voneinander Abschied nahmen, pflanzte jeder einen Zweig ein an die Stelle, wo er sich befand. Dann trennten sie sich.
Der älteste Prinz ritt so lange, bis er den Gipfel eines Berges erreicht hatte. Dort sprang er vom Pferde und ließ es grasen. Er selbst ließ sich im Gras nieder, holte seine Wegzehrung hervor und begann zu essen. Da ließ sich neben ihm die kleine Füchsin Ryska nieder. "Ach, du meine Güte", sagte sie. "Was bin ich hungrig! Gib mir etwas zu essen!" Aber der Prinz griff nach seiner Armbrust und schoss einige Pfeile auf sie ab. Er war sich nicht sicher, ob er sie getroffen hatte, denn die Füchsin lief fort.
Dem zweiten Bruder erging es ebenso. Als er sich auf einem freien Feld nieder gelassen hatte und zu essen begann, kam die hungrige Füchsin zu ihm und bat um etwas Essen. Aber als er einen Pfeil abschoss, verschwand sie aus seinem Blickfeld. Der jüngere Bruder ritt, bis er an einen Fluss kam. Er sprang müde und hungrig von seinem Pferd und ließ sich im Gras nieder, um zu rasten. Als er zu essen anfing, bemerkte es auch die Füchsin Ryska.
Sie kam näher und näher und blieb dicht vor ihm stehen. "Ich bin so hungrig", sagte sie. "Gibst du mir etwas zu essen?" "Komm her, kleine Füchsin Ryska", rief der Prinz, und legte ein Stück Schinken vor sie hin. "Ich sehe, du bist noch hungriger als ich, und es reicht auch für uns beide." Er teilte seinen Mundvorrat in zwei gleiche Teile, einen für sich, den anderen für die Füchsin.
Ryska aß sich satt, und dann sagte sie: "Du hast dein Essen mit mir geteilt. Ich will mich dafür erkenntlich zeigen. Besteige dein Pferd und folge mir! Wenn du alles tust, was ich dir sage, wirst du bald den Feuervogel besitzen." Sie lief vor dem Prinzen her, und mit ihrem buschigen Schwanz ebnete sie Hügel ein, füllte sie Täler aus und bildete sie Brücken über die Flüsse. Mit großer Geschwindigkeit galoppierte der Prinz hinter ihr her, bis sich vor ihren Blicken ein Schloss aus schimmerndem Kupfer erhob.
"In diesem Schloss wirst du den Feuervogel finden", sprach Ryska zu dem Prinzen. "Betritt das Schloss genau zur Mittagsstunde, denn das ist die Zeit, da die Wache schläft, und niemand steht auf Posten. In dem ersten Saal wirst du zwölf goldene Vögel in hölzernen Käfigen sehen. Im dritten Saal wird der Feuervogel auf einer Stange sitzen. Neben dem Vogel hängen zwei Käfige, einer aus Gold und einer aus Holz. Aber du darfst den Vogel nicht in den goldenen Käfig setzen! Nimm den hölzernen, sonst wirst du es bereuen!"
Der Prinz betrat das kupferne Schloss und fand alles genau so, wie Ryska ihm gesagt hatte. Im dritten Saal saß der Feuervogel auf einer kleinen Stange und schien zu schlummern. Er war so schön, dass des Prinzen Herz vor Freude bei seinem Anblick hüpfte. Er ergriff den Vogel und setze ihn in den hölzernen Käfig. Aber dann kamen ihm Bedenken. "Dieser Käfig ist wirklich nicht gut genug, für einen so schönen Vogel", sprach er zu sich selbst. "Der Feuervogel gehört in einen goldenen Käfig."
Mit diesen Worten nahm der Prinz den Vogel aus dem hölzernen Käfig und setzte ihn in den goldenen. Kaum hatte der Prinz den Feuervogel eingesperrt, wurde er wach. Im gleichen Augenblick begannen die Vögel in den anderen zwei Sälen so laut zu pfeifen und zu krächzen, dass alles aus dem Schlaf fuhr. Die Wachposten kamen herbei und ergriffen den Prinzen. Sie schleppten ihn vor den König, der sehr zornig auf ihn war.
"Wer bist du, du Dieb", wollte er wissen, "wie kannst du es wagen, an meiner Wache vorbei zu schleichen und den Feuervogel zu stehlen?" – "Ich bin kein Dieb", widersprach der Prinz. "Ich bin gekommen, den Dieb zu holen, den Ihr hier habt. Daheim in meines Vaters Garten haben wir einen Apfelbaum, der goldene Äpfel trägt. Jeden Tag wächst ein Apfel und wird reif, aber Euer Vogel kam jede Nacht und holte ihn weg. Und nun ist mein Vater, krank am Herzen und kann nur wieder gesund werden, wenn er Euren Vogel singen hört. Darum bitte ich Euch, gebt mir den Feuervogel." – "Du sollst ihn haben", antwortete der König, "wenn du mir das Pferd mit der goldenen Mähne bringst."
Als der Prinz die Füchsin Ryska wieder traf, war sie sehr böse auf ihn. "Warum hast du nicht getan, was ich dir gesagt habe?" schalt sie ihn. "Warum hast du den goldenen Käfig genommen?" "Ja, ich habe es falsch gemacht", gab der Prinz zu, "aber es führt sie nichts, wenn man über vergossene Milch jammert. Sag mir lieber, ob du etwas über das Pferd Goldmähne weißt?" – "Ich weiß etwas", erwiderte die Füchsin, "und ich werde dir helfen, es zu finden. Besteige dein Pferd und folge mir."
Wieder lief sie vor dem Prinzen auf seinem Pferd her und bahnte ihm mit dem Schwanz den Weg. In vollem Galopp folgte der Prinz bis sie vor einem Schloss aus Silber, das sich in einiger Entfernung vor ihnen erhob, Halt machten. "In diesem Schloss wirst du das Pferd Goldmähne finden", sagte die Füchsin. "Betritt es zur Mittagsstunde, wenn alle Wächter schlafen. Im ersten Stall wirst du zwölf schwarze Pferde mit goldenen Zügeln finden, im zweiten Stall zwölf weiße Pferde mit schwarzen Zügeln, und im dritten Stall steht das Pferd Goldmähne an seinem Trog. An der Wand über ihm wirst du zwei Zügel sehen, einen goldenen und einen ledernen. Aber ich warne dich, greif nicht nach dem goldenen! Leg dem Pferd den ledernen an, oder du wirst es bereuen." –
Als der Prinz das Schloss betrat, fand er alles so, wie es die Füchsin Ryska gesagt hatte. Im dritten Stall stand das Pferd Goldmähne an einem silbernen Trog und fraß loderndes Feuer. Der Prinz hob den ledernen Zügel von der Wand und zäumte das Pferd. Goldmähne stand ganz still wie ein Lamm. An der Wand hing aber auch der goldene Zügel, mit kostbaren Edelsteinen geschmückt, und er gefiel dem Prinzen sehr. "Es ist nicht recht", sprach er zu sich, "dass ein so schönes Pferd einen so hässlichen Zügel hat. Goldmähne soll den goldenen Zügel haben!" Mit diesen Worten wechselte der Prinz das lederne Zaumzeug gegen das goldene aus. Sobald das Pferd den goldenen Zügel spürte, bäumte es sich auf und wieherte laut. In den anderen Ställen begannen die Pferde ebenfalls zu wiehern, und die Soldaten fuhren aus dem Schlaf.
Sie kamen gelaufen, ergriffen den Prinzen und schleppten ihn vor den König. "Wer bist du, du Dieb", fragte der König streng, "wie kannst du es wagen, an meiner Wache vorbei zu schleichen und mein Pferd Goldmähne zu stehlen?" – "Ich bin kein Dieb", erwiderte der Prinz. "Ich tat es nicht ohne Grund, aber es blieb mir nichts anderes übrig." Und er erzählte dem König die ganze Geschichte und dass der König vom kupfernen Schloss ihm erst dann den Feuervogel geben wollte, wenn er ihm das Pferd Goldmähne brachte, und er beschwor den König, ihm das Pferd zu geben. "Du sollst es haben", sagte der König, "wenn du mir das Mädchen mit den goldenen Haaren bringst, das in einem goldenen Schloss im schwarzen See lebt."
Die Füchsin Ryska wartete im Wald auf den Prinzen, aber sie war sehr böse, als sie ihn ohne Goldmähne kommen sah. "Habe ich dir nicht gesagt, du sollst den goldenen Zügel nicht anrühren?" schimpfte sie. "Habe ich nicht ausdrücklich gesagt, du sollst den ledernen nehmen?" Ach, du machst mir viel Kummer. In der Tat, wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen." "Sei nicht mehr böse mit mir, Ryska", bat der Prinz. "Ich weiß, ich habe es wieder falsch gemacht, aber hilf mir nur noch dieses eine Mal." "Ich werde dir noch mal helfen" ,sagte die Füchsin, "aber es ist wirklich das letzte Mal. Wenn du tust, was ich dir sage, kannst du alles wieder gut machen, was du durch deine Dummheit verdorben hast."
Wieder lief sie vor ihm und bahnte mit ihrem Schwanz den Weg, bis sie vor dem goldenen Schloss im schwarzen See Halt machten. "Hier in diesem Schloss", sagte die Füchsin, "lebt die Königin der Meere. Sie hat drei Töchter, und die jüngste ist das Mädchen mit den goldenen Haaren. Geh und erbitte dir eine von ihnen zur Frau. Wenn sie dich fragt, welche du willst, dann nimm die mit dem schlichten Gewand."
Die Königin der Meere hieß den Prinzen herzlich willkommen. Als sie den Grund seines Besuches erfuhr, führte sie ihn in einen Raum, in dem ihre drei Töchter saßen und spannen. Sie sahen einander so ähnlich, dass sie niemand auseinander halten konnte. Sie waren so liebreizend, dass dem Prinzen schon beim bloßen Anblick der Atem stockte. Das Haar einer jeder war mit einem Schleier bedeckt, so dass man nicht seine Farbe erkennen konnte. Sie waren unterschiedlich gekleidet; die eine trug einen Schleier und ein Kleid mit eingewebten Goldfäden, und hatte eine goldene Spindel. Die zweite saß vor einem silbernen Spiegel und trug zu ihrem Schleier ein Kleid mit silberner Stickerei. Die dritte hatte ein weißes Kleid an, ihr Haar war mit einem weißen Tuch bedeckt, und sie saß vor einer gewöhnlichen Spindel.
"Wähle, welche du magst", sagte die Königin zu dem Prinzen, und dieser zeigte auf das weiß gekleidete Mädchen. "Gebt mir diese", bat er. "Oh", dachte die Königin, "jemand muss ihn beraten haben, denn darauf kann er nicht von allein gekommen sein. Nun, wir werden abwarten und sehen, was der morgige Tag bringt." Und zum Prinzen gewandt, sagte sie: "Bevor du meine Tochter bekommst, musst du eine Aufgabe lösen. Ich werde sie dir morgen stellen." In dieser Nacht konnte der Prinz kein Auge zu tun. Er war unruhig und voller Erwartung, was ihm der kommende Tag bringen würde. Sobald sich die Sonne erhob, ging er im Garten spazieren. Plötzlich stand das weiß gekleidete Mädchen vor ihm: "Wenn du mich heute erkennen willst", sprach sie zu ihm, "dann achte auf die kleine Fliege, die um eine von uns umschwirren wird."
Nach diesen Worten verschwand sie wieder. Am Vormittag führte die Königin den Prinzen noch einmal in das Zimmer ihrer Töchter. "Wenn du das Mädchen wieder erkennst, das du gestern gewählt hast, so soll sie dein sein. Irrst du dich aber, so sollst du deinen Kopf verlieren." Die Töchter standen in einer Reihe und trugen alle die gleichen kostbaren Kleider, so dass es unmöglich war, sie zu unterscheiden. Alle drei hatten goldenes Haar, das leuchtete in so hellem Glanz, dass es dem Prinzen die Augen blendete.
Aber nach einer Weile, als sich seine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, bemerkte er eine kleine Fliege, die eines der Mädchen umschwirrte. "Das ist mein Mädchen", rief er , "das ist die, die ich mir erwählt habe!" Die Königin war überrascht, dass es dem Prinzen gelungen war, das junge Mädchen unter seinen Schwestern heraus zu finden. "Es ist nicht so leicht, wie du denkst, sie zu gewinnen", bemerkte sie. Morgen werde ich dir eine neue Aufgabe geben, die du noch lösen musst."
Am nächsten Morgen zeigte die Königin dem Prinzen einen großen See, gab ihm ein kleines Sieb und sprach zu ihm: "Du sollst Goldhaar haben, wenn du mit diesem Sieb bis morgen Abend den ganzen See ausgeschöpft hast. Wenn es dir nicht gelingt, sollst du deinen Kopf verlieren." Der Prinz nahm das Sieb und machte sich schweren Herzens auf den Weg zum Wasser an den See zurück. Er sah ein, dass dies eine unauflösbare Antwort war. So setzte er sich am Ufer nieder und überlegte, wie er aus dieser schwierigen Lage herauskommen könnte.
Plötzlich stand das weiß gekleidete Mädchen vor ihm: "Warum bist du so traurig?" "Wie sollte ich nicht traurig sein", entgegnete der Prinz, "Wenn ich sehe, dass ich dich niemals gewinnen werde. Deine Mutter verlangt Unmögliches von mir." "Sei ohne Sorge", sagte das Mädchen, "es wird alles gut werden." Während sie sprach, ergriff sie das Sieb und warf es mitten in den See. Sogleich begann das Wasser zu brodeln und zu kochen, dichter Nebel zog über die Wasserfläche und legte sich auf das Ufer, so dass man nicht drei Schritte weit sehen konnte. Der Prinz vernahm ein Geräusch von stampfenden Hufen, und als er sich umwandte, stand die Füchsin Ryksa mit seinem Pferd vor ihm. "Verliere keine Zeit", drängte die Füchsin. "Setz das Mädchen vor dich auf dein Pferd und reite mit ihr fort, so schnell du kannst."
Das Pferd peitschte los. Wie zuvor bahnte sich Ryksa mit ihrem buschigen Schwanz den Weg, füllte Täler und baute Brücken. Der Prinz war glücklich, dass er Goldhaar errungen hatte, aber der Gedanke, dass er sich wieder von ihr trennen musste, machte ihn traurig. Denn er musste sie ja dem König mit dem silbernen Schloss geben, um von ihm das Pferd Goldmähne zu bekommen. Je näher sie dem Palast kamen, desto niedergeschlagener wurde er.
"Ich weiß, was dich bedrückt", sagte Ryska zu dem Prinzen. "Du möchtest nicht Goldhaar hergeben für das Pferd Goldmähne. Nun, habe ich dir bisher geholfen, so will ich dir auch weiter bei stehen." Als sie diese Worte gesprochen hatte, sprang die Füchsin über einen umgefallenen Baum und schlug einen Purzelbaum. Im nächsten Augenblick stand dort, wo die kleine Füchsin gewesen war, noch ein goldhaariges Mädchen, das dem aufs Haar glich, das auf dem Pferd des Prinzen saß. "Lass Goldhaar hier im Walde warten", riet die Füchsin dem Prinzen. Nimm an ihrer Stelle mich zum König in das silberne Schloss und tausche mich gegen das Pferd Goldmähne ein. Wenn du es hast, dann mach dich mit dem Mädchen aus dem Staube, so schnell du kannst."
Der König des silbernen Schlosses war sehr erfreut, Goldhaar zu bekommen, und gab das Pferd Goldmähne für sie. Zu Ehren von Goldhaar ließ er sofort Vorbereitungen treffen für ein großes Fest, zu dem alle Hofleute geladen wurden. Als diese Edelleute schon ein ordentlichen Tropfen getrunken hatten und fröhlich wurden, fragte sie der König, wie ihnen die Braut gefiele. "Sie ist voller Liebreiz", entgegnete einer der Edelleute. "Keine andere könnte sie übertreffen. Aber mir will scheinen, als habe sie Augen wie ein Fuchs." Kaum hatte er diese Äußerung getan, als sich das goldhaarige Mädchen wieder in die Füchsin Ryska verwandelte. Mit einem großen Sprung war sie an der Tür und verschwand.
Sie beeilte sich, den Prinzen und Goldhaar einzuholen. Mit ihrem buschigen Schwanz fegte sie die Hügel fort, füllte sie Täler aus und baute sie Brücken, wie sie es zuvor getan hatte. Als sie endlich das Paar erreicht hatte, näherten sie sich bereits dem kupfernen Schlosse, das den Feuervogel beherbergte. Da wandte sich die Füchsin an den Prinzen: "Wie herrlich Goldhaar und Goldmähne aussehen", sagte sie. "Bedauerst du nicht, dich von dem Pferd trennen zu müssen, um den Feuervogel zu bekommen?" "Ich würde es wirklich sehr bedauern", sagte er, aber es tut mir nicht mehr leid, wenn ich an meinen kranken Vater denke, denn der Vogel wird ihm seine Gesundheit wiederbringen."
Aber das Füchslein fuhr fort zu sprechen: "Der Feuervogel sollte dort sein, wo Goldhaar und Goldmähne sind. Nun habe ich dir bisher geholfen, so will ich dir auch weiter beistehen." Dann sprang sie über einen umgefallenen Baum und schoss einen Purzelbaum. Schon stand an derselben Stelle, wo Ryska gestanden hatte, ein Pferd mit einer Goldmähne, das dem anderen aufs Haar glich. "Bring mich zum König auf das kupferne Schloss", sagte Ryska zu dem Prinzen, "und tausch mich gegen den Feuervogel ein. Sobald du den Vogel hast, reite davon, so schnell du kannst."
Der König des kupfernen Schlosses war voller Freude über das Pferd mit der Goldmähne und gab sogleich den Feuervogel mit samt dem goldenen Käfig gegen das Pferd Goldmähne her. Er lud seine Edelleute ein, denen er Goldmähne zeigte, und fragte sie, wie es ihnen gefiele. "Es ist ein edles Pferd", bemerkte einer der Höflinge, "man wird so leicht kein besseres finden. Aber mir will scheinen, als habe es Augen wie ein Fuchs." Mit einem großen Sprung war Raska aus dem Tor und verschwand.
Sie beeilte sich, den Prinzen und seine Braut einzuholen, und bewegte sich dabei auf ihre gewöhnliche Art fort. Mit dem buschigen Schwanz fegte sie Hügel fort, füllte sie Täler aus und baute sie Brücken. Sie erreichte das Paar schließlich an einem Fluss, wo sie zum ersten Mal mit dem Prinzen zusammen getroffen war. "Nun hast du den Feuervogel bekommen", sagte sie zu dem Prinzen, "du hast sogar mehr, als du wolltest. Jetzt brauchst du mich nicht mehr. Geh in Frieden heim, aber verweile unterwegs nicht, oder du wirst es bereuen." Damit verschwand sie.
Der Prinz setzte seinen Weg fort, in der Hand hielt er den goldenen Käfig mit dem Feuervogel, an seiner Seite ritt das liebliche Mädchen Goldhaar auf dem Pferd Goldmähne. Als sie zu dem Kreuzweg kamen, wo sich der Prinz von seinen Brüdern getrennt hatte, erinnerte er sich der Zweige, die sie gepflanzt hatten, Die seiner Brüder waren verdorrt, aber sein eigener war zu einem schönen Schatten spendenden Baum herangewachsen. Der Prinz freute sich darüber, und da sie beide von der Reise ermüdet waren, beschloss er, mit seiner Braut unter dem Baim zu rasten. Er sprang von seinem Pferd und half seiner goldhaarigen Liebsten von dem Pferd Goldmähne herabzusteigen. Er band die beiden Pferde an den Baum, den er gepflanzt hatte, und hing den Käfig mit dem Feuervogel an einen Zweig. Es dauerte nicht lange, so schlummerten sie ein.
Während sie lagen und schliefen, kehrten die Brüder des Prinzen zurück. Sie kamen gleichzeitig, jeder aus einer anderen Richtung und beide mit leeren Händen. Sie sahen, dass ihre Zweige verdorrt waren und der des Bruders zu einem schönen Schatten spendenden Baum herangewachsen war. Schließlich entdeckten sie auch ihren Bruder schlafend unter dem Baum, neben sich ein goldhaariges Mädchen. Auch der Feuervogel, der in seinem goldenen Käfig in dem Baum über dem schlafenden Paar hing, entging ihnen nicht. Böse Gedanken erfüllten sie.
"Unser Bruder wird die Hälfte des Königreichs bekommen", so sprachen sie zu einander. Es wäre besser für uns, wenn wir ihn umbrächten. Du kannst das Mädchen mit den goldenen Haaren haben, ich werde mir das Pferd mit der goldenen Mähne nehmen, und den Feuervogel geben wir unserem Vater, damit er ihn mit seinem Gesang wieder gesund macht. Später werden wir uns das Königreich teilen." Kaum gesagt, schon getan. Sie töteten ihren Bruder und drohten Goldhaar, sie auch umzubringen, wenn sie ein Wort von dem verriete, was geschehen war.
Als sie in das Schloss des Vaters zurückgekehrt waren, brachten sie Goldmähne in einen Stall aus Marmor und setzten den Feuervogel mit seinem Käfig in das Zimmer, in dem der König lag. Goldhaar bekam ein prächtiges Gemach und viele Zofen, die ihr aufwarten sollten. Bekümmert schaute der alte kranke König auf den Feuervogel und fragte seine Söhne, ob sie nicht wüssten, was aus ihrem jüngsten Bruder geworden sei. "Wir haben nichts von ihm gehört", erwiderten die Brüder. "Wahrscheinlich ist er umgekommen." Der Vater blieb so schwach, wie er war, der Feuervogel sang nicht, das Pferd Goldmähne ließ den Kopf hängen, und das Mädchen Goldhaar sprach kein einziges Wort. Sie kämmte nicht ihr goldenes Haar, sie weinte nur unaufhörlich.
Als der tote Prinz zerstückelt im Wald lag, kam die Füchsin Ryska herbei geeilt. Sie sammelte alle Stücke und fügte sie zusammen. Natürlich hätte die kleine Füchsin Ryska den Prinzen auch gerne wieder zum Leben erweckt, aber das vermochte sie nicht. Da sah sie plötzlich einen Raben mit zwei seiner Jungen über den Körper des Prinzen kreisen. Ryska versteckte sich im Gebüsch, und als einer der jungen Raben sich auf dem Körper nieder ließ, schoss sie hervor, griff den Vogel bei den Flügeln und tat so, als wollte sie ihn in Stücke zerreißen. Sogleich kam der alte Rabe geflogen.
Er setzte sich auf einen Zweig und sagte zur Füchsin: "Krackra, habe Mitleid mit einem armen Kind, es hat dir doch nichts getan. Wenn du es frei gibst, will ich dir immer helfen, wenn du mich brauchst." - "Ich brauche deine Hilfe sofort", sagte die Füchsin. "Ich gebe dein Kind frei, wenn du mir das Wasser des Lebens von dem schwarzen See bringst." Nachdem der Vogel versprochen hatte, das Wasser zu holen, flog er fort. Drei Tage und drei Nächte lang flog er ohne Unterbrechung.
Als er zurück kehrte, hatte er in einer Fischblase das Wasser des Lebens mitgebracht. Die Füchsin nahm die Blase und besprengte den Prinzen mit dem Wasser. Da erwachte er wie aus einem tiefen Traum. "Oh", rief er aus, "wie lange habe ich geschlafen!" "Du hast tatsächlich sehr lange geschlafen", sagte die Füchsin, "aber wenn ich nicht gekommen wäre, würdest du nie wieder aufgewacht sein. Warum hörst du auch nie auf mich? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst ohne Säumen nach Hause reiten?" Während sie ihm erzählte was sich zugetragen hatte, begleitete sie ihn bis an den Rand des Waldes, nahe beim königlichen Schloss. Bevor sie sich trennten, gab sie ihm noch einfache Kleider, dann sagte sie ihm Lebewohl und verschwand.
Der Prinz begab sich ins Schloss, aber niemand erkannte ihn, weil er die einfachen Kleider trug, die ihm die Füchsin gegeben hatte. Er fragte nach Arbeit und wurde als Stallbursche angestellt. In den Ställen belauschte er ein Gespräch, das zwei Stallburschen miteinander führten. "Es ist ein Jammer mit dem schönen Pferd", sagte der eine Bursche. "Es wird wohl sterben, denn es will nicht fressen." - "Gebt ihm ein Bund Erbsenstroh", riet der Prinz, "ich wette mit euch, das Pferd wird es fressen." "Haha", lachten die Burschen, "hat man so etwas schon mal gehört? Erbsenstroh, ich sage dir, nicht einmal unsere Ackergäule würden es anrühren." Einerlei, der Prinz nahm ein Bund Erbsenstroh und legte es dem Pferd in die Futterkrippe aus Marmor.
Er strich dem Pferd über die goldene Mähne und sagte: "Warum bist du so traurig, mein Pferd Goldmähne?" Das Pferd erkannte die Stimme seines Herrn. Es schnaubte laut, wieherte vor Freude, beugte dann den Kopf zur Krippe und fraß das Erbsenstroh. Die Neuigkeit verbreitete sich schnell im Schloss, und als der König davon hörte, ließ er den Stallburschen zu sich kommen. "Ich höre", sagte er zu ihm, "dass du mein Pferd Goldmähne wieder gesund gemacht hast. Ich wollte, du könntest auch dem Feuervogel helfen, damit er singen kann für mich. Er ist so schwach, lässt seine Flügel hängen und will nichts fressen. "Wenn er stirbt, werde ich auch sterben."
"Habt keine Furcht, Herr", entgegnete der Prinz. "Befehlt nur, einige Graupenkörner zu bringen. Er wird sie fressen und wieder fröhlich werden und singen." - "Haha",lachten die Diener, als sie gingen um die Graupenkörner zu holen. "Er will damit den Feuervogel füttern! Nicht einmal unsere Gänse würden so etwas anrühren." Aber wie auch darüber denken mochten, sie mussten die Graupenkörner holen. Der Prinz tat einige in den Käfig des Vogels; streichelte ihm das goldene Gefieder und sagte: "Warum bist du so traurig, mein Feuervogel?"
Der Vogel erkannte sofort die Stimme seines Gebieters. Er schüttelte sich, plusterte sich seine Federn auf und begann umher zu hüpfen, zu fressen und zu singen. Er sang so lieblich, dass des Königs Herz überfloss, als er ihn hörte. Kaum, dass der Vogel von neuem seinen Gesang ertönen ließ, fühlte sich der König schon so kräftig, dass er das Bett verlassen konnte. Er umarmte den Stallburschen und fragte ihn: "Wie kann man aber dem lieben Mädchen helfen, das meine Söhne mitgebracht haben? Sie spricht nicht, sie kämmt sich nicht ihr goldenes Haar, sie isst nicht. Sie weint nur unaufhörlich."
"Erlaubt mir, Herr König, ein Wort mit ihr zu wechseln", bat der Bursche. "Vielleicht kann ich ihr Mut zu sprechen!" Sofort ließ der König das Mädchen holen. Der Prinz packte ihre schneeweiße Hand und sagte: "Warum bist du so traurig, mein liebes Herz?" Goldhaar erkannte sofort seine Stimme. Weinend vor Freude fiel sie ihm um den Hals. Der König wunderte sich, dass der junge Mann sie "mein liebes Herz", nannte. "Mein königlicher Vater", wandte sich jetzt der Prinz an den König, "erkennt Ihr mich nicht? Ich bin Euer jüngster Sohn! Ich war es und nicht meine Brüder, der den Feuervogel, das Pferd Goldmähne und dieses liebliche junge Mädchen Goldhaar errang."
Der Prinz berichtete nun dem König alle seine Abenteuer, und seine Braut fügte hinzu, wie seine Brüder gedroht hätten, sie zu töten, wenn sie ihr Geheimnis verraten würde. Da standen sie nun beide und wussten, dass ihr Spiel verloren war. Sie brachten kein einziges Wort heraus und zitterten wie Espenlaub. Der König war so entsetzt über ihre Untat, dass er sie beide hinrichten ließ. Der junge Prinz nahm das liebreizende goldhaarige Mädchen zur Frau, und sein Vater übergab ihm, wie er versprochen hatte, das halbe Königreich. Nach dem Tode des alten Königs bestieg er den Thron, und er und sein Weib lebten glücklich für immer.
Quelle: Karol Jaromir Erben
DAS GOLDENE SPINNRAD ...
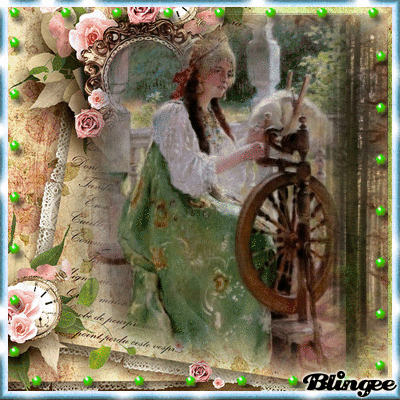
Eine arme Witwe hatte zwei Töchter, die Zwillinge waren. Sie glichen sich in ihrem Äußeren so sehr, daß man sie nicht unterscheiden konnte. Um desto verschiedener waren sie in ihrem Wesen. Dobrunka war gehorsam, arbeitsam, freundlich und verständig, kurz, ein überaus treffliches Mädchen; Zloboha dagegen war schlimm, rachsüchtig, unfolgsam, faul und hoffärtig, und hatte überhaupt alle Untugenden, die zusammen bestehen können. Dennoch hatte die Mutter Zloboha weit lieber, und erleichterte ihr es, soviel sie nur vermochte.
Sie wohnten im Wald in einer kleinen Hütte, wohin sich selten wer verirrte, obwohl es nicht weit von der Stadt war. Damit Zloboha etwas lerne, brachte sie die Mutter nach der Stadt in einen Dienst, wo es ihr ziemlich gut erging. Dobrunka mußte indeß die kleine Wirtschaft führen. Wenn sie früh die Ziege gefüttert, das schlichte Mahl bereitet, Stube und Küche rein gekehrt und in Ordnung gebracht hatte, mußte sie sich noch, wofern es nicht notwendigere Arbeit gab, zum Spinnrad setzen und spinnen.
Ihr feines Gespinnst verkaufte dann die Mutter in der Stadt, und kaufte von dem Gelde nicht selten ein Kleid für Zloboha; die arme Dobrunka erhielt niemals das Geringste davon. Dessen ungeachtet liebte sie ihre Mutter, und obwohl sie den ganzen Tag kein freundliches Gesicht von ihr bekam, noch ein gütiges Wort hörte, so gehorchte sie ihr doch stets ohne Unwillen und Widerrede, und murrte nicht einmal in Gedanken gegen sie.
Einst ging die Mutter in die Stadt. »Das rate ich Dir, daß Du nicht müßig bist, während ich fort bin!« sagte sie zu Dobrunka, die ihr ein Stück Weges das Bündel mit dem Gespinnst tragen half. »Ihr wißt ja, Mütterchen, daß ich mich nicht zur Arbeit nötigen lasse, folglich werde ich auch heute, wenn ich zuvor aufgeräumt habe, fleißig spinnen, daß Ihr mit mir zufrieden sein sollt.« Als sie der Mutter das Bündel gereicht, kehrte sie in die Hütte zurück, und nachdem sie in der Stube und Küche alles in Ordnung gebracht, setzte sie sich zum Spinnrad und spann.
Es war ihre Gewohnheit, daß sie, wenn sie allein zu Hause war, beim Spinnen sang; drum begann sie auch diesmal, nach dem sie sich gesetzt, mit heller Stimme alle Lieder nach einander zu singen, die sie kannte. Da hört sie außen plötzlich Pferdegestampf. Sie denkt bei sich: »Wer mag sich zu uns her verirrt haben? Muß doch sehen!« Sie steht vom Spinnrad auf, und guckt durch das kleine Fenster hinaus, wo sie einen jungen Mann vom feurigen Rosse absteigen sieht. »Das ist ein schöner Herr!« flüsterte sie für sich, indem sie fortwährend beim Fenster bleibt. »Wie gut ihm der Pelz und wie gut ihm die Mütze mit der weißen Feder zu den schwarzen Locken steht! Jetzt bindet er sein Pferd an und geht zu uns. Muß doch sehen, was er will.«
In dem Augenblicke trat der junge Herr zur Tür herein; denn damals gab es noch keine Riegel und Schlösser, und ging doch niemand was verloren. »Gott grüße Dich, Maid!« sprach er zu Dobrunka. »Euch gleichfalls, Herr!« entgegnete Dobrunka. »Was wünscht Ihr?« »Etwas Wasser zum Trinken, ich habe großen Durst.« - »Will Euch sogleich dienen. Setzt Euch indeß!«
Sie lief, nahm den Krug, spülte ihn rein aus, schöpfte Wasser am Brunnen, und brachte es dem Herrn. »Möchte Euch gern mit etwas Besserem aufwarten, doch ich habe nichts Anderes.« - »Sieh, wie mir es geschmeckt!« versetzte der Herr, ihr den leeren Krug reichend. Dobrunka stellte ihn wieder an seinen Platz, ohne zu bemerken, daß ihr der Herr indeß einen Beutel mit Geld heimlich unter das Kissen gesteckt. »Dank für die Erfrischung, und erlaubst Du, komme ich morgen wieder.« - »Wenn es Euch Vergnügen macht, so kommt!«
Hierauf reichte er Dobrunka die Hand, ging hinaus, schwang sich aufs Roß und ritt davon. Dobrunka setzte sich wieder zu ihrem Spinnrad, doch das Bild des jungen Mannes schwebte beständig vor ihr. Noch niemals war ihr der Faden so oft gerissen, als diesmal. Abends kam die Mutter nach Hause, und erzählte eine Menge, was Zloboha schon kenne, und wie sie von Tag zu Tag schöner werde. Zuletzt fragte sie: »Hast Du nichts gehört? Es soll hier eine große Jagd gewesen sein.«
»Ach ja, ich vergaß Euch zu sagen, daß ein Herr bei uns einkehrte. Er bat mich um etwas Wasser, das ich ihm sogleich brachte. Er hatte ein schönes Pelzkleid an. Wißt Ihr, als wir in der Stadt waren, sahn wir auch Herren in solchem Pelzanzug, eine Mütze mit weißer Feder auf dem Kopf. Um die Schulter trug er eine Armbrust. Wahrscheinlich war es einer von den Jägern. Nachdem er getrunken, setzte er sich auf seinen Rappen und ritt fort.« Das jedoch verschwieg Dobrunka, daß er ihr beim Scheiden die Hand gedrückt und versprochen, morgen wieder zu kommen.
Abends, als Dobrunka die Betten zurecht machte, fiel ein schwerer Beutel mit Geld heraus. Verwundert hob ihn Dobrunka auf und reichte ihn der Mutter. »Wer hat Dir das Geld gegeben?« - »Mir - niemand! Vielleicht hat es der Herr hier her gesteckt; sonst wüßte ich nicht, wie es her gekommen.« Die Mutter leerte den Beutel auf den Tisch aus. Es war lauter Gold. »Um des Himmels willen, so viel Geld!« wunderte sich die Alte. »Das muß ein reicher Herr sein. Vielleicht hat er die Armut bei uns wahrgenommen und ein mildes Werk geübt. Gott möge ihn segnen dafür!« Dann scharrte sie das Geld zusammen und verwahrte es in der Truhe.
Wenn Dobrunka sonst zur Ruhe ging, schlief sie, von der Tagesarbeit ermüdet, bald ein: diesmal vermochte sie es durchaus nicht, immer schwebte ihr das Bild des Reiters vor, und erst spät Nachts kam ihr der Schlummer. Da träumte ihr, sie befinde sich in einem großen Schlosse und sei die Gemahlin eines mächtigen Herrn und dieser mächtige Herr sei der Reiter, den sie gestern gesehen. Es ward ein großes Festmahl gegeben, bei dem viele Gäste anwesend waren; da stürzt plötzlich eine schwarze Katze auf sie los, und haut die Krallen tief in ihr Herz, daß ein Blutstrom ihr weißes Gewand bespritzt.
In dem Augenblicke schreit Dobrunka auf und erwacht. »Das war ein sonderbarer Traum!« sagte sie zu sich. »Wie wird das enden? Er fing so schön an, allein die grausame Katze verdarb alles. Das bedeutet nichts Gutes.« Mit dieser Traumdeutung stand Dobrunka auf und begann sich anzukleiden. Sonst brauchte sie nicht viel Zeit dazu, diesmal konnte sie nicht genug Sorgfalt darauf verwenden. Sie flocht sich das Haar und durchwand es mit roten Bändern, was sie nur an Feiertagen zu tun pflegte; ihr Röckchen war blos von Zeug, doch rein und mit einem Bande gesäumt; dazu hatte sie ein Schnürleibchen von Damast und ein Hemd, weiß wie Schnee. Als sie sich so angezogen, war sie gar lieblich zu schauen. Dann ging sie an ihre Arbeit.
Als der Mittag nahte, hatte sie am Spinnrad keine Ruhe; immerfort machte sie sich außen etwas zu schaffen, und dies nur, um den Reiter zu erspähen. Der ließ nicht lange auf sich warten. Dobrunka aber, als sie ihn von fern gewahrte, lief geschwind zu ihrem Spinnrad, damit er sie nicht sehe, und sich nicht denke, sie habe nach ihm gespäht. Als er angekommen, sprang er vom Pferde, trat in die Stube, und grüßte sie artig. Dobrunkas Herz pochte so stark, daß ihr das Schnürleibchen schier zu eng ward!
Die Mutter sammelte Holz im Wald, Dobrunka war folglich allein. Als sie ihn begrüßt und eingeladen, sich zu setzen, ging sie wieder zu ihrem Spinnrad. »Hast Du gut geschlafen?« fragte der Jüngling, und nahm sie bei der Hand. »Wohl Herr!« - »Was träumte Dir denn?« - »Ach, ich hatte einen sonderbaren Traum!« - »Erzähle ihn mir, ich kann Träume gut deuten.« - »Ich kann ihn Euch nicht erzählen.« - »Warum denn?« - »Nun, weil ich von Euch träumte.« - »Eben deshalb mußt Du mir den Traum erzählen.« So stritten sie miteinander, bis ihm Dobrunka den Traum dennoch erzählte.
»Sieh, bis auf die Katze kann sich Dein Traum erfüllen.« - »Wie könnte ich jemals so eine Frau werden!« - »Willst Du nicht mein Weib sein?« - »Herr, Ihr scherzt!« - »Nicht doch, Dobrunka, es ist kein Scherz. Ich meine es ernstlich, und bin heut absichtlich gekommen, Dich zu fragen, ob Du mir Deine Hand reichen willst.« Dobrunka bedachte sich ein wenig, und reichte dann errötend dem Reiter die Hand.
Da trat die Mutter herein. Der Jüngling grüßte sie, eröffnete ihr sogleich ohne Umschweife, daß er Dobrunka lieb habe, so wie sie ihn, und daß ihnen zu ihrem vollkommenen Glücke nichts fehle, als der mütterliche Segen. »Ich habe mein Haus«, fügte er hinzu, »und vermag ein Weib wohl zu ernähren; auch für Euch, Mütterchen, ist Raum genug in meinem Hause und an meinem Tisch.« Als dies die Alte hörte, weigerte sie sich nicht lange, ihnen ihren Segen zu geben. Darauf sprach er zu Dobrunka: »Spinne nur fleißig, meine Liebe, Holde! Bis Du Dir Dein Hochzeitshemd gesponnen, komme ich um Dich zu werben.« Dann küßte er sie, reichte der Mutter die Hand, schwang sich auf seinen Rappen und ritt schnell davon.
Von dieser Zeit an ging die Mutter mit Dobrunka viel freundlicher um. Für das Geld, das ihnen der Herr hinterlassen, kaufte die Alte auch Manches für Dobrunka, obwohl Zloboha dennoch das Meiste bekam. Dobrunka aber kümmerte das nicht; ihre Freude war nur, am Spinnrad zu sitzen, fleißig zu spinnen, und an ihren Verlobten zu denken.
So verrann ihr die Zeit, und ehe sie sich dessen versah, war das Hochzeitshemd gesponnen. Ihr Verlobter mußte das wohl berechnet haben, denn er kam an dem selben Tage, wie er es zugesagt. Dobrunka lief ihm entgegen; er drückte sie an sein Herz, und fragte sie scherzend: »Hast Du Dein Hochzeitshemd fertig?« - »Freilich.« - »So kannst Du sogleich mit mir gehen.« - »Ei warum so eilig?« - »Ich kann nicht anders, meine Liebe! Morgen muß ich in den Krieg, und so möchte ich gern, daß Du mich daheim vertretest, und kehre ich zurück, mich als mein Weib begrüßest.« - »Was wird aber die Mutter dazu sagen?« - »Sie wird zufrieden sein.«
Sie gingen in die Stube zur Mutter, welcher der Bräutigam seinen Wunsch eröffnete. Ihr Gesicht verfinsterte sich, denn sie hatte im Stillen einen ganz anderen Plan ausgeheckt. Allein was sollte sie tun? Sie mußte sich in den Willen des reichen Bräutigams fügen. Als sie das Paar segnete, sprach der Jüngling zu ihr: »Nehmt Eure Sachen und kommt zu Dobrunka, daß ihr nicht bange. Wenn Ihr in die Stadt gelangt, fragt nur im fürstlichen Schlosse nach Dobromil; die Leute werden Euch schon zeigen, wohin Ihr zu gehen habt.« Dann faßte er die weinende Dobrunka bei der Hand, setzte sie vor sich aufs Roß und jagte fort.
Im fürstlichen Schlosse waren viel Leute versammelt, alles rüstete sich zum Kriege. Einige aber standen am Tor, und es schien, als ob sie wen erwarteten. Da kam der Reiter gesprengt, vor sich auf dem Rosse die Jungfrau, die an Schönheit dem Tage glich. »Er kommt!« schrien sie, daß das Schloß erdröhnte, und alle ließen ihre Arbeit liegen und liefen zum Tor. Als Dobromil mit Dobrunka in den Schloßhof sprengte, drängten sich alle heran, und als ob sie sich verabredet hätten, erscholl es mit einer Stimme: »Hoch lebe unsere Fürstin! Hoch lebe unser Fürst!«
Dobrunka war wie im Traume und wußte nicht, was sie davon denken solle. »Dobromil, bist Du denn der Fürst?« fragte sie, in sein strahlendes Antlitz schauend. - »Ich bin es, und ist Dir das nicht lieb?« - »Mir gilt das gleich viel, sei wer Du magst; doch sprich, warum täuschtest Du mich so?« - »Ich täuschte Dich nicht, versprach ich Dir doch, daß sich Dein Traum erfüllen solle, wenn Du mich zum Manne nimmst.«
Damals waren zu einer Hochzeit nicht so viele Vorbereitungen nötig, wie jetzt. Wenn zwei einander lieb hatten, und die Eltern eingewilligt, war die Sache abgetan. Darum stellte Dobromil seine Dobrunka auf der Stelle seinen Untertanen vor, worauf sich diese in den großen Saal begaben, wo sie bis spät in die Nacht beim fröhlichen Mahl saßen. Des anderen Tags nahm der junge Gatte von Dobrunka Abschied, und zog in den Krieg.
Wie ein verirrtes Lamm ging die junge Fürstin in dem prächtigen Schlosse umher; sie hätte sich lieber im Wald getummelt, und in der einsamen Hütte die Rückkehr ihres Gatten erwartet, als hier, wo ihr bang war wie in der Fremde. Das währte in deß nicht lange; in einem halben Tag machte sie sich alle durch ihre Güte und Herzlichkeit geneigt. Tags darauf sandte sie um ihre Mutter; die kam und brachte ihr auch das Spinnrad. Nun war die Langweile vorbei.
Dobrunka dachte, es werde für die Mutter eine angenehme Überraschung sein, wenn sie höre, was ihre Tochter geworden; Diese jedoch sah finster drein, denn sie wünschte im Herzen, es möchte solch Glück lieber Zloboha genießen. Das wurmte sie. Nach einigen Tagen sagte sie zu Dobrunka: »Ich weiß, liebe Tochter, daß Dir Deine Schwester viel Unrecht zugefügt; sie bereut es aber. Verzeihe ihr also, und nimm sie zu Dir!« - »Das würde ich schon vom Herzen gern getan haben, wenn ich hätte hoffen können, daß sie zu mir gehe. Wollt Ihr, so holen wir sie auf der Stelle.« - »Ja, tun wir das!«
Die Fürstin befahl den Wagen bereit zu machen; dann setzten sich Beide ein, und fuhren zum Wald. Als sie an dessen Rand gelangten, stiegen sie ab. Dobrunka befahl dem Diener zu warten, und ging mit der Mutter zur Hütte. Als sie sich der Hütte näherten, kam ihnen Zloboha entgegen gelaufen, küßte ihre glückliche Schwester und wünschte ihr, es möchte ihr immer so gut ergehen. Hierauf führten die Betrügerinnen sie in die Stube. Kaum aber hatte sie den Fuß über die Schwelle gesetzt, so ergriffen sie Beide, und Zloboha stieß ihr das bereit gehaltene Messer in den Leib.
Dann hieben sie ihre Hände und Füße ab, schälten ihr die Augen aus, und schleppten die so verstümmelte Leiche in den Wald; Augen, Füße und Hände jedoch hoben sie auf, und nahmen sie mit sich ins Schloß, in dem sie glaubten, der Fürst würde sie nicht so lieb haben, wenn nicht etwas von der vorigen Frau im Hause wäre. Zloboha zog die Kleider Dobrunkas an, und verließ mit der Mutter die Hütte. Hinterm Walde setzten sie sich in den Wagen und fuhren zum Schloß. Im Schlosse bemerkte Niemand, daß dies nicht die wahre Frau sei; den Dienern schien es nur, ihre Herrin sei Anfangs viel besser gewesen als jetzt.
Inzwischen war die arme Dobrunka nicht tot; sie kam nach einigen Stunden zum Bewußtsein, und da fühlte sie, daß sie eine warme Hand streichle und ihr Arzneitropfen in den Mund träufelte. Wer es sei, wußte sie freilich nicht, weil sie keine Augen hatte. Als sie sich allmählich an alles erinnerte, begann sie sich über die unnatürliche Mutter und die grausame Schwester zu beklagen. »Schweig' und klage nicht!« ließ sich eine leise Stimme neben ihr vernehmen. »Alles wird glücklich enden.« - »Ach, wie ist das möglich, da ich keine Augen, keine Füße und Hände habe! Nie mehr werde ich die helle Sonne schauen und den grünen Hain; nie mehr meinen Dobromil umarmen, noch Hemden für ihn spinnen. Was hab' ich verschuldet, Du schlimme Mutter, und Du noch schlimmere Schwester, daß Ihr mich so elend gemacht?«
Inzwischen ging der Greis, der vor dem zu ihr geredet, aus der Höhle heraus, worin sie sich befanden, und rief dreimal. Da kam ein Knabe zu ihm gelaufen, und fragte ihn, was er wünsche. Er befahl ihm zu warten, bis er wieder kehre. In einer Weile brachte er ein goldenes Spinnrad, und sprach: »Mit diesem Spinnrad wirst Du in die Stadt gehen, in das fürstliche Schloß. Dort wirst Du Dich mit ihm hinsetzen, und fragt Dich jemand, was es koste, so sagst Du: 'Zwei Augen,' und gibst es niemandem, der Dir nicht zwei Augen bringt.« Mit diesem Auftrag sandte er den Knaben fort, und kehrte zu Dobrunka zurück.
Der Knabe schritt zur Stadt und gerade in das Schloß, wo er sich mit dem Spinnrad beim Tore niedersetzte, eben als Zloboha mit ihrer Mutter von einem Spaziergang zurückkam. »Seht doch, Mutter,« rief sie, »welch prachtvolles Spinnrad! Auf dem könnte ich selbst spinnen. Wartet, ich will fragen, ob es feil ist.« Sie trat näher zu dem Knaben, und fragte, was das Spinnrad koste. »Zwei Augen, Frau!« - »Zwei Augen?« - »Ja.« - »Das ist sonderbar. Warum gerade zwei Augen?« - »Das weiß ich nicht. Der Vater hat es so befohlen, und darum darf ich es nicht für Geld verkaufen.«
Zloboha besah sich das Spinnrad in einem fort, und je mehr sie sich es besah, um desto mehr gefiel es ihr. Auf einmal erinnerte sie sich an Dobrunkas Augen. »Seht, Mutter, als Fürstin muß ich doch etwas haben, was sonst niemand hat. Kommt der Fürst nach Hause, so wird er haben wollen, daß ich spinne, und bedenkt, wie schön, wenn ich dann auf goldenem Spinnrad spinne. Wir haben Dobrunkas Augen verwahrt, geben wir sie ihm dafür; uns bleiben ja noch die Füße und Hände!«
Die Mutter, leichtsinnig wie die Tochter, willigte ein. Zloboha brachte die Augen der Schwester, und gab sie für das Spinnrad hin. Der Knabe eilte mit den Augen zum Wald. Als er zu der Höhle kam, übergab er sie dem Greis und ging. Dieser begab sich mit ihnen zu Dobrunka und setzte sie sanft in ihre Augenhöhlen ein. Plötzlich sah sie wieder. Sie sah einen Greis vor sich, dessen weißer Bart bis über die Brust floß. Ein graues Gewand umhüllte seine hohe Gestalt vom Haupt bis zum Fuße. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne fielen durch den schmalen Eingang auf sein ehrwürdiges und freundliches Antlitz, und übergossen es mit rosigem Glanz.
Dobrunka war es, als ob ein Gott vor ihr stände. »Wie,« sprach sie, »Du heiliger Mann, werde ich im Stande sein, Dir Deine Liebe zu vergelten? Ach vermöchte ich nur Deine Hände zu küssen!« - »Sei still,« unterbrach sie der Greis, »und warte alles ruhig ab!« Hierauf entfernte er sich, brachte Dobrunka auf einem Holzteller schmackhaftes Obst, und stellte es auf ihr Lager aus duftendem Laub und Moos; dann suchte er rote Erdbeeren aus, und wie die besorgte Mutter ihr Kind, so ätzte er Dobrunka und gab ihr auch aus einem Holzbecher zu trinken.
Des anderen Tags zeitig früh stand der Greis wieder vor der Höhle, und rief dem Knaben. Als Der gelaufen kam, gab er ihm eine goldne Spindel und sprach: »Mit dieser Spindel wirst Du wieder ins fürstliche Schloß gehen und Dich beim Tor nieder setzen. Fragt Dich, jemand, was sie koste, so sagst Du: 'Zwei Füße,' und gibst sie niemandem früher, als bis er Dir zwei Füße bringt.« Der Knabe ging mit der Spindel davon und der Greis kehrte in die Höhle zurück.
Zloboha stand am Fenster, und sah in den Hof, eben als sich der Knabe mit der Spindel zeigte. So gleich lief sie zur Mutter, und sagte zu ihr: »Kommt doch und seht! Beim Tor sitzt wieder der Knabe, und hat eine wunderschöne Spindel!« Sie begaben sich zu ihm. »Was kostet die Spindel?« fragte sie den Knaben. »Zwei Füße, Frau!« - »Zwei Füße?« - »Ja.« - »Sage an, was macht Dein Vater damit?« - »Das kann ich Euch nicht sagen, denn ich frage den Vater nie, warum dies oder jenes zu geschehen habe. Was er befiehlt, das tue ich, und so kann ich Euch die Spindel für nichts Anderes lassen als für zwei Füße.« -
»Hört Mutter, da ich das Spinnrad habe, so ziemte es sich doch, daß ich die Spindel gleichfalls hätte. Wir haben Dobrunkas Füße verwahrt: wie, wenn ich sie ihm dafür gäbe? Uns bleiben ja noch die Hände.« - »Tue, wie Du willst,« entgegnete die Mutter. Zloboha brachte also die Füße, die verhüllt waren, und gab sie dem Knaben für die Spindel hin. Hierauf kehrte sie freudenvoll in ihre Gemächer zurück, und der Knabe eilte zum Wald.
Als er zur Höhle kam, übergab er die Füße dem Greise, und ging fort. Dieser begab sich mit ihnen in die Höhle, nahm eine Salbe, bestrich Dobrunkas Wunden, und setzte ihr die Füße wieder an. Sie wollte von ihrem Lager aufspringen, der Greis aber gestattete es nicht. »Bleibe jetzt ruhig liegen, bis Du ganz gesund bist; dann will ich Dir erlauben, daß Du aufstehst!« Sie mußte sich zufrieden geben, was sie auch gern tat; denn sie war überzeugt, daß ihr der Greis nichts Arges rate.
Am dritten Tage zeitig früh rief der Greis dem Knaben, gab ihm einen goldenen Rocken und sprach: »Trage auch den Rocken zum Verkauf ins fürstliche Schloß. Fragt Dich jemand, was er koste, so sage: 'Zwei Hände,' und wer Dir zwei Hände gibt, dem gib den Rocken.« Als der Knabe mit dem Rocken ins Schloß kam, und sich beim Tor nieder setzte, lief Zloboha zu ihm, die sich gerade mit der Mutter im Hof erging. »Was kostet denn der Rocken, Knabe?« fragte sie ihn. »Zwei Hände, Frau!« - »Das ist doch sonderbar, daß Du nichts für Geld verkaufst!« - »Ich kann nicht anders, hohe Frau, als wie mir befohlen ist.«
Jetzt war Zloboha im Zweifel. Der Rocken war allerliebst, und sie hätte ihn gar zu gern zu dem Spinnrad gekauft, um damit prahlen zu können. Das jedoch verdroß sie, daß sie zwei Hände dafür geben sollte, und daß ihr dann nichts von Dobrunka übrig bleibe. »Sagt mir doch, Mutter, muß ich etwas von Dobrunka haben, daß mich der Fürst so liebe, wie sie?« - »Nun,« versetzte die Mutter, »besser wär es, wenn Du etwas behieltest; ich wenigstens hörte immer, das sei ein gutes Mittel, sich des Gatten Liebe zu bewahren. Doch meinethalben tue, wie Du willst.«
Zloboha bedachte sich ein Weilchen, dann aber lief sie, verführt von dem Vertrauen auf ihre Schönheit und von ihrer Eitelkeit, um die zwei Hände zu holen, und gab sie dem Knaben hin. Der Rocken, an dem ein Flachs erglänzte, feiner als Seide und mit einem roten Band umwunden, war von gediegenem Gold. Voll Freude über das prachtvolle Gerät ging sie, um es zum Spinnrad und zur Spindel hin zu stellen; die Mutter aber schüttelte den Kopf und war verdrießlich über die Torheit der Tochter.
Der Knabe war in deß schon wieder zurück. Als er dem Greise die Hände übergeben hatte, verschwand er. Dieser ging mit ihnen zu Dobrunka, und nachdem er ihre Wunden bestrichen, wie Tags zuvor, fügte er sie an ihren Leib. Kaum vermochte Dobrunka die Hände zu bewegen, so ließ sie sich nicht länger auf dem Lager halten. Sie sprang empor, und dem Greise zu Füßen fallend, küßte sie die Hände, die ihr so viel Gutes erwiesen hatten. »Tausendfältigen Dank Dir, Du mein Wohltäter!« rief sie unter Freudentränen. »Vergelten kann ich Dir es nie, das weiß ich; aber begehre von mir, was Du willst, und wenn es das Schwerste wäre, so will ich es gern, vom Herzen gern tun für Dich.«
»Ich begehre nichts von Dir,« erwiderte der Greis, und erhob sie sanft vom Boden. »Was ich für Dich getan, täte ich für jeden anderen; das ist meine Pflicht. Nun bleibe so lange hier, bis jemand um Dich kommt. Um Nahrung sei unbesorgt, ich schicke sie Dir.« Dobrunka wollte ihm noch etwas sagen, doch er verlor sich vor ihren Augen, und sie sah ihn nie mehr. Sie lief aus der Höhle, um sich Gottes Welt wieder anzuschauen. Nun erst kannte sie den Wert der Gesundheit. Und sie warf sich auf die Erde und küßte sie; bald hüpfte sie und umarmte die schlanken Tannen, bald streckte sie sehnsuchtsvoll mit Tränen die Arme nach der Stadt aus. Vielleicht wäre sie dahin geeilt, hätten sie nicht des Greises Worte an den Ort gefesselt.
Inzwischen trugen sich im Schlosse sonderbare Dinge zu. Reisende nämlich brachten die Nachricht, daß der Fürst aus dem Kriege Heim kehre. Alle freuten sich auf den guten Herrn, denn sie waren mit der Frau nicht sehr zufrieden. Zloboha und ihrer Mutter ward doch ein wenig Angst, wie es ausfallen werde. In einigen Tagen kam der Fürst. Mit freudigem Antlitz lief ihm Zloboha entgegen, und er drückte sie mit Inbrunst an sein Herz. Nun hatte sie keine Angst mehr, daß er sie erkennen werde.
Es wurde ein Festmahl bereitet; denn mit dem Fürsten waren viele Gäste gekommen, die bei ihm ausruhen und einige Tage in heiterer Lust zubringen wollten. Zloboha, die an Dobromils Seite saß, konnte ihn nicht genug betrachten; der stattliche Fürst gefiel ihr, und sie war froh, daß ihr der Streich mit der Schwester so wohl gelungen war.
Als das Fest vorüber war, fragte Dobromil seine vermeintliche Gemahlin. »Wie hast Du die Zeit zugebracht, meine Liebe? Gewiß hast Du gesponnen?« »Du hast es erraten,« antwortete Zloboha gleißnerisch. »Aber mein altes Spinnrad ist verdorben. Es kam ein Knabe her, und bot ein wunderschönes goldenes Spinnrad feil: das habe ich mir statt des frühern gekauft.« »Das mußt Du mir zeigen,« sprach der Fürst, nahm sie bei der Hand und führte sie aus dem Saal.
Sie ging mit ihm in das Gemach, wo sie das Spinnrad aufbewahrt hatte, und zeigte es ihm. Dobromil gefiel das Spinnrad sehr. »Setze Dich, Dobrunka,« sprach er, »und spinn darauf! Ich möchte Dich gern wieder einmal spinnen sehen.« Sie ließ sich nicht lange nötigen, und setzte sich geschwind zum Spinnrad. Sie drückt mit dem Fuße auf den Tritt, um das Rad in Schwung zu bringen; da schallt es aus dem Spinnrad heraus:
»Herr, miß ihr keinen Glauben bei,
Sie ist voll Trug und Gleißnerei.
Dein wahres Weib, sie war es nie,
Dein Weib ist ermordet, gefallen durch sie.«
Zloboha war wie vom Donner gerührt. Der Fürst fuhr zusammen, und verwundert durch flog er mit seinen Blicken das ganze Gemach, um zu sehen, woher das Lied komme; doch als er niemand erblickte, befahl er, daß Zloboha weiter spinne. Zitternd gehorchte sie. Kaum jedoch begann sich das Rad zum zweiten Mal zu drehen, erscholl es wieder:
»Herr, miß ihr keinen Glauben bei,
Sie ist voll Trug und Gleißnerei.
Erschlagen hat sie ihr Schwesterlein,
Und schleppte in den Wald hinein.«
Ganz außer sich wollte Zloboha vom Spinnrad hinweg eilen; doch der Fürst, der plötzlich an ihren Angst entstellten Zügen erkannte, daß dies nicht seine holde Dobrunka sei, faßte sie bei der Hand, zwang sie, sich nieder zu setzen, und gebot ihr mit strenger Stimme, daß sie weiter spinne. Noch einmal drehte sich das Rad, und es erscholl zum dritten Male:
»Herr schwinge auf Dein Roß Dich bald,
Und eile hinaus zum grünen Wald!
Dein Weib sitzt in der Höhle dort,
Und sehnet nach Dir sich fort und fort.«
Jetzt verließ Dobromil die schändliche Zloboha, stürzte aus dem Gemache auf den Hof, und befahl, man solle ihm augenblicklich das schnellste Roß satteln. Die Diener, erschrocken über das fürchterliche Aussehen ihres Herren, rannten, was sie konnten, um seinen Befehl zu erfüllen. Als bald stand ein gesatteltes Roß vor Dobromil, und kaum fühlte es dessen Sporen, so flog es über Berg und Tal, daß es mit seinen Hufen die Erde kaum berührte.
Als der Fürst in den Wald gelangte, wußte er nicht, wo die Höhle zu suchen sei. Er ritt geraden Weges. Als er jedoch ein Stück geritten war, setzte plötzlich ein weißes Reh über den Weg; das Pferd erschrickt, springt rechts hin ab und rennt mit seinem Herrn durch Dick und Dünn, bis es an einem Felsen stehen bleibt. Dobromil steigt vom Rosse, und bindet es an einen Baum, in der Absicht, Dobrunka zu Fuß im Walde zu suchen. Er klettert zuerst auf den Felsen; da sieht er zwischen den Bäumen etwas blinken. Begierig zu erfahren, was es sei, klettert er weiter, und steht auf einmal vor einer Höhle. Doch welche Freude für ihn, als er hinein tritt, und seine Dobrunka erblickt!
Er fällt ihr um den Hals, umarmt und küßt sie, und nach dem er lange genug ihr liebreizendes Antlitz betrachtet hat, ruft er; »Wo hatte ich nur meine Augen, daß ich Dich, Du Engel, von Deiner teuflischen Schwester nicht unterschied!« »Was weißt Du von meiner Schwester? Wer sagte Dir etwas?« fragte Dobrunka, die von dem Spinnrad nicht das Geringste wußte. Da erzählte ihr der Fürst alles, und sie berichtete wieder ihm, was sich nach seinem Abzug mit ihr zugetragen. »Von der Zeit an, wo mich der Greis verließ,« schloß sie, »bringt mir täglich ein kleiner Knabe zu essen.«
Hierauf ließen sie sich zusammen auf dem Rasen nieder, und sie brachte ihm auf einem Holzteller Obst zur Labung. Nachdem sie gegessen und ein wenig geplaudert, nahmen sie den Holzteller und den Holzbecher zum Andenken mit sich, und stiegen den Felsen hinab. Dobromil setzte sein wahres Weib vor sich aufs Pferd, und jagte mit ihr heim. Seine Diener harrten schon auf ihn, um ihm zu melden, was sich in seiner Abwesenheit begeben; aber sie sahen einander wie verwirrt an, als sie gewahrten, daß ihr Herr die selbe Frau mit sich bringt, die erst kurz vorher samt deren Mutter der böse Geist vor ihren Augen in der Luft davon getragen.
Der Fürst, der bemerkte, was sie verwirre, erzählte ihnen kurz das Ereigniß mit seiner Gemahlin. Da gönnten alle einhellig der gottlosen Schwester die wohlverdiente Strafe. Das goldene Spinnrad war verschwunden, Dobrunka suchte ihr altes her vor, und spann fleißig Hemden für ihren lieben Gatten. Niemand im ganzen Lande hatte so feine Hemden, und niemand war so glücklich, als Fürst Dobromil.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
VOM METALLHERRSCHER ...
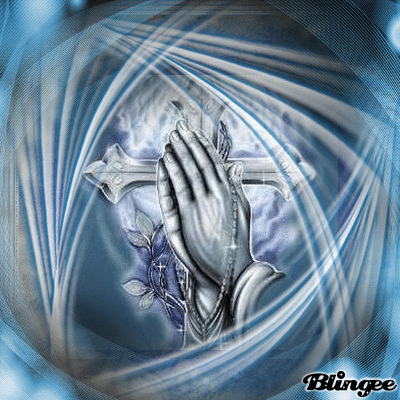
Es war einmal eine Witwe, und die hatte eine sehr schöne Tochter. Die Mutter war ein demütiges Weib, allein die Tochter war ein stolzes Mädchen. Es kamen viele Brautwerber, doch keiner war ihr recht, und je mehr sich die Bursche um sie bemühten, um so hoffärtiger ward sie.
Einst in einer hellen Nacht erwachte die Mutter, und da sie nicht gleich wieder einschlafen konnte, nahm sie den Rosenkranz von der Wand, und begann für das Heil ihrer Tochter zu beten, die ihr Sorgen machte. Die Tochter lag neben ihr und schlief. Die Mutter sah mit Wohlgefallen auf ihr schönes Kind; da lächelt die Tochter im Schlaf. »Was mag wohl dem Mädchen Schönes träumen, daß sie so lieblich lächelt!« denkt die Mutter, betet das Vaterunser zu Ende, hängt den Rosenkranz wieder auf, legt ihr Haupt neben das der Tochter und schläft ein.
Des Morgens fragte sie die Tochter: »Aber Tochter, sage mir, was hat Dir heut Nachts Schönes geträumt, daß Du im Schlaf lächeltest?« - »Was mir geträumt hat, Mutter? Ei mir träumte, es komme um mich ein Herr in kupfernem Wagen, und gebe mir einen Ring mit Steinlein, die wie die Sterne am Himmel funkelten. Und als ich in die Kirche kam, da schauten die Leute nur auf die Mutter Gottes und auf mich.«
»Ach Kind, was für hoffärtige Träume hast Du!« sagte die alte Mutter und schüttelte den Kopf; die Tochter aber ging singend an ihre Arbeit. Des selben Tags fuhr ein Bauernwagen in den Hof, und es kam ein in gutem Rufe stehender Dorfbursche, sie als Gattin zu Bauernbrot zu erbitten. Der Mutter gefiel der junge Bräutigam sehr, allein die stolze Tochter fertigte ihn ab, in dem sie sprach: »Und wenn Du in kupfernem Wagen um mich kämst, und mir einen Ring gäbst, dessen Steinlein wie die Sterne am Himmel funkelten, ich würde dennoch nicht mit Dir ziehen!« Der Bräutigam empfahl sich auf diese hoffärtigen Worte, und fuhr traurig von dannen. Die Mutter aber tadelte die Tochter.
In der zweiten Nacht erwachte die Mutter wieder, nahm den Rosenkranz, und betete für das Heil ihrer Tochter noch inbrünstiger. Auf einmal lacht diese im Schlaf laut auf. »Was träumt doch dem Mädchen!« denkt die Mutter, betet noch ein Vaterunser, und hängt den Rosenkranz wieder an die Wand, kann jedoch lange nicht einschlafen. Des Morgens fragte sie die Tochter beim Ankleiden: »Aber Tochter, was hat Dir wieder Sonderbares geträumt? Du lachtest ja im Schlaf laut auf.« -
»Was mir geträumt hat, Mutter? Ei mir träumte, es komme um mich ein Herr in silbernem Wagen und schenke mir ein goldenes Stirnband. Und als ich in die Kirche kam, da schauten die Leute nicht so sehr auf die Mutter Gottes, als auf mich.« »O was sprichst Du da, Kind! Was für hoffärtige Träume! Bete, Tochter, bete daß Du nicht in Versuchung geratest!« so tadelte sie die Mutter; allein die Tochter schlug die Tür zu und ging hinaus, um die Predigt der Mutter nicht anhören zu müssen.
Des selben Tags fuhr ein Herrschaftswagen in den Hof, und es kamen Edelleute, sie als Gattin zu Herrenbrot zu erbitten. Die Mutter schätzte sich das für eine Ehre; die Tochter aber fertigte sie stolz ab, indem sie sprach: »Und wenn Ihr in silbernem Wagen um mich kämt, und mir ein goldenes Stirnband brächtet, ich würde dennoch nicht mit Euch ziehen!« Die Brautwerber empfahlen sich; allein die Mutter schalt die Tochter und wehklagte: »Ach Tochter, laß ab vom Stolz! Der Stolz schmeckt nach der Hölle.« Die Tochter verlachte sie jedoch.
In der dritten Nacht schlief die Tochter neben der Mutter; allein die Mutter konnte vor Sorgen nicht einschlafen, und gab den Rosenkranz gar nicht aus der Hand. Da schlägt die Tochter im Schlaf ein helles Gelächter auf. »Gott,« ruft die Mutter ärgerlich, »was träumt dem unglücklichen Kinde wieder!« und betet, betet bis zum lichten Tage für das Heil ihrer Tochter. »Aber Tochter, was hat Dir heut Nacht wieder geträumt? Du schlugst ja im Schlaf ein helles Gelächter auf,« fragte sie die Tochter, als diese erwachte. - »Wollt Ihr mich wieder auszanken?« entgegnete die Tochter. »Sage mir es, sage mir es!« drang die Mutter in sie. -
»Nun, mir träumte, sie kämen in goldenem Wagen um mich und brächten mir ein Gewand von lauter Golde. Und als ich in die Kirche kam, da schauten die Leute nur auf mich!« Die Mutter rang die Hände, die Tochter aber sprang aus dem Bette, nahm ihre Kleider und lief, sich außen anzukleiden, damit sie die Ermahnung der Mutter nicht anhören müßte.
Des selben Tags fuhren drei Wagen in den Hof, ein kupferner, ein silberner und ein goldener. Vor den ersten waren zwei, vor den zweiten vier, vor den dritten gar acht stolze Rosse gespannt. Aus dem kupfernen und silbernen Wagen sprangen Edelknaben mit roten Hosen und grünen Kappen und Dolmanen; aus dem goldenen Wagen aber sprang ein schöner Herr in einem Gewand von lauter Golde. Alle gingen gerade in die Stube, und der junge Herr bat die Mutter um die Tochter.
»Ei wenn wir nur solches Glückes würdig wären!« entschuldigte sich die Mutter; die Tochter aber dachte bei sich, als sie den Herrn erblickte: »Das ist ja der selbe, von dem mir träumte!« und begab sich hurtig in die Kammer, um den Strauß zu binden. Als sie den Strauß gebunden und dem Bräutigam als Pfand gereicht hatte, bekam sie von ihm einen Ring mit Steinlein, die wie die Sterne am Himmel funkelten, ein goldenes Stirnband und ein Gewand von lauter Golde.
Hurtig begab sie sich in die Kammer, um sich anzukleiden, und die Mutter, sorgenvoll, fragte den Bräutigam: »Und zu was für Brot erbittet Ihr meine Tochter?« - »Bei uns ist das Brot von Kupfer, von Silber und von Gold. Sie kann sich wählen, welches ihr beliebt!« erwiderte der Bräutigam. Die Mutter wunderte sich über alles das; doch die Tochter hatte keine Sorgen und fragte nach nichts. Als sie das goldene Gewand angelegt hatte, war sie überaus schön. Der Bräutigam faßte sie bei der Hand, und sie gingen sogleich zur Trauung, ohne daß die Tochter früher um den Segen der Mutter bat, ohne daß sie nach altherkömmlicher Sitte von dem Mädchentum Abschied nahm.
Die Mutter, Angst gequält, stand an der Schwelle und betete für das Paar. Als die Trauung vorüber war, setzte sich die Braut mit dem Bräutigam in den goldenen Wagen, das Geleite in den silbernen und den kupfernen, und so fuhren sie von dannen, ohne daß die Tochter der Mutter Lebewohl sagte.
Sie fuhren und fuhren, bis sie zu einem Felsen gelangten, in den ein großes Loch ging, groß wie ein Stadttor. In dieses Tor lenkten plötzlich die Rosse. Als sie innen waren, kam ein furchtbares Erdbeben, so daß der Felsen hinter ihnen einstürzte. Sie befanden sich in der Dunkelheit. Die Braut erschrak heftig und fürchtete sich; doch der Bräutigam sprach zu ihr: »Fürchte Dich nicht und warte nur! Es wird schon hell, es wird schon schön werden.«
Und jetzt kamen von allen Seiten Bergmännchen gelaufen mit roten Hosen und grünen Kappen, brennende Fackeln in der Hand, und die begrüßten alle ihren Herrn, den Metallherrscher, und leuchteten ihm. Nun erst sah die hoffärtige Braut, wem sie gefolgt war, wen sie zum Gatten habe. Doch machte ihr das keinen Kummer.
Aus dem finstern Felsen gelangten sie in ungeheuere Wälder und in Berge, die himmelhoch empor reichten; aber all die Fichten, Tannen, Buchen, all die Berge waren von Blei. Als sie die Berge hinter sich hatten, kam wieder ein Erdbeben, so daß alles hinter ihnen einstürzte. Aus den bleiernen Bergen gelangten sie auf eine schöne Ebene, wo alles prächtig strahlte, und inmitten der Ebene stand ein goldenes Schloß, mit Silber und Edelsteinen ausgelegt.
In das Schloß führte der Metallherrscher seine Braut, und sagte ihr, daß dies alles auch ihr gehöre. Mit Freude und Verwunderung beschaute die junge Frau all den Reichtum; als sie alles ringsumher betrachtet hatte, war sie müde, und sah es gern, daß die Bergmännchen einen goldenen Tisch deckten. Sie fühlte Hunger. Sie setzte sich also zu Tische. Es wurden Speisen aus Kupfer aufgetragen, Speisen aus Silber und aus Gold. Alle aßen, doch die Braut konnte nicht davon genießen.
Sie bat daher den Bräutigam um ein Stückchen Brot. »Gern, meine Holde!« sagte der Metallherrscher und sogleich befahl er den Bergmännchen, einen Laib kupfernen Brots zu bringen. Es lief eins, und brachte einen Laib kupfernen Brots; allein die Braut konnte nicht davon essen. Der Metallherrscher befahl einen Laib silbernen Brots zu bringen. Sie brachten einen Laib silbernen Brots; allein die Braut konnte nicht davon essen. Er befahl einen Laib goldenen Brots zu bringen; allein auch hiervon konnte die Braut nicht essen.
»Gern würde ich Dir dienen, meine Holde; doch haben wir kein anderes Brot,« sagte der Metallherrscher. Da sah die Braut, daß es übel mit ihr stehe, und brach in Tränen aus; allein der Metallherrscher sprach zu ihr: »Es hilft nichts, daß Du weinst und wehklagst. Du hast gewußt, was für Brot Du erfreist. Wie Du gewählt, so hast Du es nun.« Und so war es und nicht anders. Was geschehen war, ließ sich nicht ungeschehen machen, die Braut mußte unter der Erde bleiben, und wird dort von Hunger gequält, weil sie nur Gold verlangte.
Nur an drei Tagen im Jahre ist ihr es gestattet, ans Sonnenlicht hinauszugehen, wenn nämlich der Metallherrscher die Pforten zu den Schätzen der Erde öffnet. Das ist an den drei Bitttagen. Da läßt er sie hinaus, und sie bettelt um Brot.
Slowakei: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
DER GLÄSERNE BERG ...
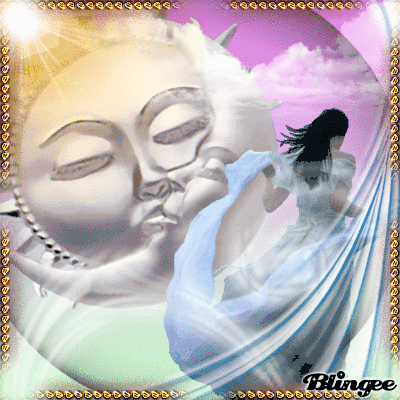
Es war einmal ein Vater, der drei Kinder hatte; zwei waren Knaben, eins ein Mädchen. Nach dem Tode ihrer rechten Mutter bekamen sie eine Stiefmutter. Die Stiefmutter hatte die Kinder nicht lieb, besonders die zwei Knaben nicht. So oft sie die Knaben an sah, gab sie ihnen Schimpfnamen und verwünschte sie: „Dass ihr doch zu Raben würdet!“ Der Mann ermahnte sie oft: „Weib, verwünsche meine Kinder nicht! Es könnte ihnen oder dir selbst etwas Böses erfahren.“
Allein sie achtete nicht darauf, und als die Knaben wieder einmal an sah, rief sie wieder: „Dass ihr doch zu Raben würdet!“ Kaum hatte sie es gerufen, so wurden sie wirklich zu Raben. Sie setzten sich auf einen Baum vor dem Haus und harrten, bis die Schwester Heim käme. Als sie kam, krächzten sie traurig und nahmen Abschied von ihr. Die Schwester wusste sogleich, dass sie auf dem gläsernen Berg verwünscht seien, nur wusste sie nicht, wo der gläserne Berg wäre.
Sie machte sich auf den Weg, um die Brüder zu suchen. Lange ging sie. Endlich kam sie zu dem Sonnenherrn und fragte ihn, ob er nicht von dem gläsernen Berg wisse, den eine Zauberin ihre zwei Brüder verwünscht habe. Der Sonnenherr antwortete: „Ich leuchte den ganzen Tag, allein auf dem gläsernen Berg habe ich noch nie geleuchtet. Weißt du was, gehe zu meinem Bruder dem Mondherrn und frage ihn! Hier aber gebe ich dir zum Abschied ein Kleid. Verwahr es in einer Nussschale!“
Sie nahm das Kleid, verwahrte es in einer Nussschale, bedankte sich und ging zum Mondherrn. Als sie hin kam, sprach sie: „Mich schickt dein lichter Bruder, der Sonnenherr, damit ich dich, den Mondherrn, frage, ob du nicht von dem gläsernen Berg wissest, auf dem eine Zauberin meine zwei Brüder verwünscht hat.“
Der Mondherr antwortete: „Ich leuchte des Nachts auf hässliche und liebliche Orte, auf hohe Felsen und in tiefe Schlünde; allein von dem Berge weiß ich nicht. Ich will dir aber raten. Gehe zu meinem Vetter, dem Windherrn und frage ihn! Hier gebe ich dir zum Andenken ein Kleid. Verwahr es in einer Nussschale!“ Sie nahm das Kleid, verwahrte es in einer Nussschale, bedankte sich und ging zum Windherrn. Der Mondherr leuchtete ihr in der Dunkelheit.
Als sie hin kam, sprach sie: „Mich sendet dein Vetter, der Mondherr, damit ich dich, den Windherrn, frage, ob du nicht wissest, wo der gläserne Berg ist, auf dem eine Zauberin meine zwei Brüder verwünscht hat. Gerne ging ich hin, o sei so gut, mir zu raten.“ Der Windherr antwortete: „Ich blase schon Jahrhunderte, allein so weit, habe ich nie geblasen. Deine Brüder sind am Leben und befinden sich wohl. Du kannst zu ihnen kommen; doch musst du tun, wie ich dir rate.
Hier hast du einen Windsattel; setze dich auf ihn, und ich werde blasen, Hier hast du auch runde Steinlein. Vermag ich nicht mehr zu blasen, lege ein Steinchen auf den gläsernen Berg, es wird kleben bleiben, tritt darauf, sonst glitscht dir der Fuß aus. Habe ich ausgeruht, so reiten wir weiter. Und hier hast du auch ein Kleid; es wird dir gute Dienste leisten. Verwahr es in deiner Nussschale!“ Sie verwahrte das Kleid in einer Nussschale, setzte sich auf den Sattel und ritt.
Zuletzt begann der Windherr zu ermatten. Sie legte ein rundes Steinchen auf den gläsernen Berg und stand darauf, bis der Windherr ausgeruht hatte. So rastete sie einige Male, so dass am Ende kein Steinlein mehr übrig war. Da klagte der Windherr, er vermöge nicht weiter zu blasen; allein in dem Augenblicke trat sie auf den Gipfel des gläsernen Berges. Sie dankte dem Windherrn, und er kehrte zurück.
Die beiden Brüder erkannten die Schwester sogleich und riefen: „Herzgeliebte Schwester, wie hast du uns hier gefunden?“ Die Schwester entgegnete: „Ich war bei dem Sonnenherrn, dem Mondherrn und dem Windherrn, und der letzte blies mich her. Ich bin gekommen, euch zu fragen, wie ich euch helfen könnte.“ – „Oh, das bist du nicht imstande!“ meinten die Brüder. „Was uns erretten könnte, ist ein zu schweres Werk!“ Ich gelobe euch, dass ich es vollbringe!“ rief die Schwester.
Da gaben sie ihr einen Pelz aus Mäusefellen und sagten zu ihr: „Wohlan! Du darfst drei Jahre kein Wörtlein sprechen, stumm musst du leiden und dein Schicksal tragen, selbst wenn du an den Galgen kämst. Und nu gehe als Bettlerin in die Welt!“ Sie schritt vom Berge hinab, indem ihr die Brüder beistanden.
Nun ging sie, bis sie zu einem Schlosse gelangte, wo viele Diener waren und ein großes Fest gefeiert wurde. Der König des Schlosses wollte sich eine Gemahlin wählen. Eben versammelten sich die Gäste, als auch sie in das Schloss kam, die Bettlerin in ihrem Pelz aus Mäusefellen. Man ließ sie in das Schlosse und gab ihr Federvieh zu besorgen. Als sie gefragt wurde, ob sie den Dienst annehmen wolle, nickte sie bloß mit dem Kopfe.
Es kam der Abend, wo der König wählen wollte. Sie fühlte Lust, das Fest zu sehen, zog das Kleid des Sonnenherrn an und ging in den Saal. Da sprach der König zu seiner Schwester: „Die Prinzessin gefällt mir! Welches Königs Tochter mag sie sein?“ Doch sie verlor sich bald, hüllte sich wieder in den Mäusepelz und ging zu ihren Hühnern. Alles wunderte sich, wohin sie geraten sei; der König aber befahl, man möchte des nächsten Abends Acht haben, wem er zu trinken reichen würde.
Des anderen Abends zog sie das Kleid des Mondherrn an und begab sich so in den Saal. Der König erkannte sie sogleich, reichte ihr zu trinken und ließ seinen Ring in den Becher fallen. Doch sie verlor sich, hüllte sich wieder in den Mäusepelz und ging zu ihren Hühnern. Man konnte sie nicht finden. Da befahl der König: „Habt acht, ob sie des dritten Abends kommt! Ich wähle keine andre zur Gemahlin.“ – „Wir wollen sie kennzeichnen“, sagte einer der Diener. „Sie soll uns nicht verloren gehen!“
Des dritten Abends zog sie das schönste Kleid, das des Windherrn, an und begab sich in den Saal. Der Diener tupfte sie, ohne dass sie es merkte, mit einer Farbe auf die Hand. Als sie sich nun verloren hatte, suchte man überall, bis man zu der Hühnermagd kam, die im Mäusepelz bei ihren Hühnern schlief, und die war es, die das Kennzeichen an der Hand trug. Alles murrte, dass der König ein solches Wesen zur Gemahlin nehmen wolle; allein der König bestand darauf. Er vermählte sich mit ihr.
Drei Vierteljahr verstrichen, ohne dass sie ein Wörtlein sprach. Da musste der König in den Krieg ziehen; aber sie blieb daheim und gebar von ihm einen Knaben. Die Hebamme nahm den Knaben, ging zum Flusse und wollte ihn ertränken. Auf einem Strauche beim Flusse saß ein Rabe und krächzte: „Du bist mir lieber, als das Wasser“, rief die Hebamme. „Du wirst mich nicht verraten. Da nimm dir das Kind!“ Dieser Rabe war einer von den verwünschten Brüder der Königin; er nahm das Kind in seine Krallen und flog davon.
Ihr, der Mutter, sagte man, dass sie eine Missgeburt zur Welt gebracht, die man ihr gar nicht zeigen könne, und verspottete sie. Und als der König aus dem Kriege zurück kehrte, erzählte man ihm das selbe. Sie aber sprach kein Wort. Nach einiger Zeit musste der König abermals in den Krieg. Die Königin weinte, denn sie fürchtete, man würde sie töten, bevor der König käme. Sie gebar wieder einen Knaben, und die Hebamme nahm den Knaben wieder und trug ihn zum Flusse, um ihn zu ertränken. Auf dem Strauche beim Flusse saß ein anderer Rabe, der zweite Bruder der Königin und krächzte.
„Vortrefflich!“ rief die Hebamme. „Den ersten hat der erste gefressen, den zweiten frisst der zweite, ohne dass es wer erfährt.“ Und sie gab ihm das Kind, und der Rabe nahm es und flog mit ihm davon. Der Mutter sagte man, und dem König schrieb man, dass sie wieder eine Missgeburt zur Welt gebracht. Traurig kehrte der König aus dem Kriege zurück; er blickte düster und unzufrieden, und da man ihm vorwarf, sein häusliches Glück sei eine Strafe dafür, dass er eine stumme, verworfene Bettlerin genommen, verurteilte er sie zum Galgen. Sie aber sprach kein Wort.
Geduldig bereitete sie sich zum Tode. Schon wurde sie zum Galgen geführt, schon ward ihr der Strick um den Hals gelegt. Da kamen plötzlich ihre zwei Brüder zu Rosse gesprengt, ein jeder hatte vor sich einen Knaben mit einem strahlenden Sterne, und mit lauter Stimme riefen sie: „Haltet ein! Schont die Unschuld! Gerechtigkeit!“ Und sie sprachen zu ihrer Schwester: „Die drei Jahre sind verflossen, unsere Befreiung ist durch dich vollbracht. Hier hast du deine Kinder; in Rabengestalt haben wir sie aus den Händen der Hebamme gerettet und erzogen. Und nun, herzliebste Schwester, rede!“
Und der König dankte den Brüdern, und dann warf sie sich dem König zu Füßen und redete. Da enthüllte sich dem König die Wahrheit. Gerührt hob er die Königin vom Boden und drückte sie mit Wonne an seine Brust. Die Hebamme aber befahl er auf einen Scheiterhaufen zu verbrennen und ließ auch über die anderen Gericht halten, die ihr geraten hatten. Und nun lebte der König und die Königin glücklich miteinander, und die beiden Knaben mit den Sternen wuchsen zu stattlichen Jünglingen empor und machten ihren Eltern Freude und Ehre, bis diese eines seligen Todes starben.
Quelle: Ein Märchen aus Mähren
DER HIRT UND DIE ZWERGE ...
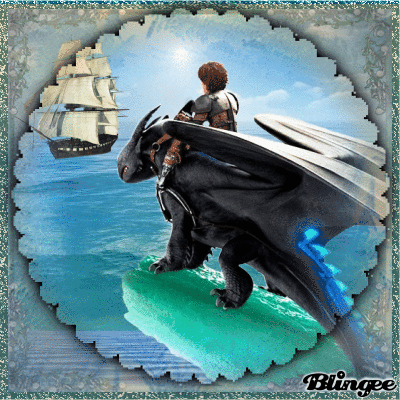
Es war einmal ein König, welcher einen alten, kränklichen Schafhirten hatte. Als dieser starb, brauchte man einen anderen Hirten, denn die Schafe konnten unmöglich ohne Hüter bleiben. Der König ließ daher in seinem Land bekannt machen, daß der alte Schäfer gestorben sei und er einen neuen in Dienst nehmen werde.
Zu der Zeit kam ein junger Hirte in die Stadt, ließ sich beim König melden, und wie er zu dem selben ins Zimmer trat, sprach er: "Ich bin ein Schäfer, und da ich hörte, daß Ihr einen solchen braucht, so will ich, wenn es Euch gefällt, Eure Schafe hüten."
Der junge Mensch gefiel dem König, und er befahl ihm, am nächsten Morgen wieder zu kommen. In der Früh kam der Hirt. Der König faßte seine Hand und führte ihn in den Stall zu den Schafen, welche recht mager aussahen, da sie schon lange nicht auf der Weide gewesen waren; anderes Futter hatten sie nicht bekommen. Nachdem der König dem Hirten die Schafe übergeben hatte, ging er fort.
Der junge Schäfer nahm nun seine Flöte und die Peitsche, ließ die Herde aus dem Stall und trieb sie zur Stadt hinaus. Als der Hirt das Stadttor verlassen hatte, dachte er, wie er wohl einen guten Weideplatz für seine ausgehungerten Schafe ausfindig machen könnte. Es war aber nicht leicht, zu jener Zeit eine gute Weide zu finden, denn es war schon Spätherbst.
Nach langem Herumziehen kam unser Hirt mit seinen Schafen zu einem mächtigen, hochstämmigen Wald, vor welchem sich eine mit üppigem Gras bedeckte Wiese ausbreitete. Die hungrigen Tiere machten sich gleich über das Gras her, und es schmeckte ihnen vortrefflich, so daß sie allmählich zunahmen. Vergnügt setzte er sich nieder, nahm die Flöte zur Hand und spielte.
Mittlerweile kamen aus dem Wald sieben kleine Männchen heran gehüpft. Der Schäfer bemerkte sie nicht eher, als bis die selben ganz nahe standen und um ihn herum sprangen, tanzten und die wunderlichsten Possen trieben. Als unser Hirt diese kleinen Wesen gewahr wurde, konnte er sich über die Männchen nicht genug wundern; er gewann sie bald lieb und spielte ihnen auf der Flöte vor, während die Männlein tanzten. Auf diese Weise verkürzte sich der Schäfer die Langeweile. Dies dauerte den ganzen Tag bis zur sinkenden Nacht, und unser Hirt unterhielt sich dabei so gut, daß er selbst sein Mittagessen vergessen hatte.
Kaum war der erste Stern am Himmel erschienen, so verschwanden die Männchen von der Wiese, und der Hirt trieb frohen Mutes die wohlgenährten Schafe nach Hause. Als der König die Schafe erblickte und sah, wie die selben an Fleisch zugenommen hatten, war er hoch erfreut. Beim Zählen jedoch fehlten sieben Stück von der Herde. Der Schäfer erschrak und konnte nicht sagen, wo diese sieben Schafe hin gekommen seien. Diesmal vergab es ihm der König, weil die Herde so gut genährt war.
Die Schafe verloren in dessen über Nacht all ihr Fleisch und waren am nächsten Tag so mager wie vorher, denn sie hatten das Gras einer Zauberwiese gefressen, dessen Wirkung nur bis Mitternacht währte. Unbekümmert darum trieb der Hirt seine Schafe wieder auf die üppige Wiese, nahm sich aber vor, auf die Herde besser Acht zu geben.
Die Schafe weideten, und der Schäfer spielte auf der Flöte. Alsdann kamen die Männlein wieder herbei, hüpften wie gestern und trieben ihren Schabernack den ganzen Tag.
Am Abend, als der König die Schafe zählte, fehlten wiederum sieben Stück. Diesmal konnte er es nicht so hin gehen lassen; zur Strafe bekam der Hirt keinen Lohn, und der König drohte ihn fort zu jagen, wenn ähnliches noch einmal vorfalle. Eine solche Drohung ängstigte den Schäfer, und er dachte nach, wer wohl der Dieb sein möge - ein Wolf oder gar die Männchen.
Trotzdem aber trieb er am dritten Tag die Herde auf den alten Weideplatz, da das Treiben der kleinen Wesen ihn ergötzte. Als daher der Hirt am Morgen auf die Wiese kam, so warteten die Männchen schon und baten ihn, er möge ihnen auf der Flöte vorspielen. Der gutherzige Schäfer konnte ihre Bitte nicht abschlagen; er spielte, und die Männlein tanzten und sprangen. Abends trieb der Schäfer die Herde heim, aber wehe - auch diesmal fehlten sieben Schafe. Darüber wurde der König zornig und sprach: "Du hast bei mir ausgedient, über die Nacht lasse ich dich noch hier, aber morgen früh verläßt du die Stadt."
Am anderen Morgen wanderte der Hirt traurig aus dem Schloß, in dem er nur drei Tage gedient hatte. Tief gebeugt langte er auf seinem Weideplatz an, und vor Schmerz warf er sich ins Gras und klagte: "Was fange ich nun an, ich armer Wicht, ohne Dienst, ohne Brot? Der Winter steht vor der Tür, und ich muß geradezu verhungern." Er weinte und bereute es tausendmal, die Herde auf diese verhexte Wiese getrieben zu haben.
Plötzlich stand vor dem Hirten ein graues Männlein und sprach: "Beruhige dich, und höre mich an, denn ich bin derjenige, welcher dir dreimal sieben Stück Schafe gestohlen hat." "Du bist der Schurke?" schrie der Hirt. "So gib sie mir zurück." Das Männchen antwortete: "Ich habe die Schafe nicht mehr, jedoch werden sie dir reichlich ersetzt werden, sei nur ruhig. - Sieh mich an; vor vielen Jahren habe ich anders ausgesehen, denn damals war ich der König der Zwerge. Höre nun, wie die Herrschaft über mein Volk für mich verloren ging:
Der König der Schlangen, nämlich der Drache, ist einst mit allen Schlangen ausgezogen, um für den Winter eine bequeme und schöne Wohnung aufzusuchen. Da hörte das Ungeheuer von meinem Zwergenberg, indem es so prächtig aussieht, und von dem großen Schatz, den wir bewachen. Solche Nachricht gefiel ihm, und er machte sich in unser Reich auf.
Meine Zwerge konnten den Schlangen keinen Widerstand entgegen stellen, denn jede versetzte einem Zwerg einen tödlichen Biß. Nur mich und meine sieben Kinder verschonten die Schlangen, welche darauf von meiner Wohnung Besitz nahmen und seit dem jeden Winter zurück kehren. Mein goldenes Gewand wurde in dieses graue verwandelt, und weil ich früher den Leuten viele Wohltaten erwiesen habe, wurde ich von den Schlangen, welche der Menschen Feinde sind, verurteilt, den selben Schaden zuzufügen.
Darum mußte ich dir dreimal sieben Stück Schafe stehlen, und zwar tat ich es in der Zeit, als meine Kinder um dich herum tanzten und du auf die Herde nicht aufmerksam warst. Vergib es mir und sei sicher, ich tat es nur meiner Kinder wegen, welche großen Hunger hatten, denn der Drache gibt uns im Sommer nichts zu essen, nur den Winter über bekommen wir etwas. Unsere Pflicht besteht darin, für die Schlangen zu wachen und sie vor Gefahr zu beschützen.
Nun aber habe ich das Leiden satt und bitte dich, Jüngling, sei unser Retter! Als Lohn erhältst du den großen Schatz." "Recht gerne, aber wie?" antwortete der Hirt. Der Zwerg sprach: "Folge mir", und nun gingen beide in den Wald, in dessen Mitte sich ein mächtiger Berg erhob.
Als diese zwei bei dem Berg anlangten, sprach der Zwergenkönig zum Hirten: "Besteige die Spitze des Berges, und du findest dort einen Baum und unter dem Baum einen schwarzen Stein. Diesen nimm heraus, grabe nach, du wirst ein goldenes Kästchen erblicken. In demselben befinden sich ein Schwert, ein weißes Tuch und ein kristallenes Gefäß mit einer Salbe. Dieses Kästchen nimm heraus und bringe es mir. Und nun geh, ich beschütze dich." Der Hirt kam ohne Gefahr hinauf, fand alles so, wie der Zwerg gesagt hatte, und brachte das Kästchen herunter.
Jetzt sprach wieder der Zwergenkönig, in dem er das Kästchen dem Schäfer übergab: "Mit der Salbe in dem Kristallgefäß reib deinen Körper ein, damit dir das Gift der Schlangen nicht schade, nimm hierauf Schwert und Tuch, verstecke dich im Gebüsch, und erwarte die Schlangen, denn heute ist der Tag, an dem sie kommen, um über den Winter im Berg zu schlafen.
Sind alle Schlangen im Berg drinnen, so trittst du nach einer Weile hervor, gehst zu der Stelle, an welcher die Schlangen in den Berg krochen, pflückst dort ein Blümchen, welches an dieser Stelle wächst, berührst mit dem selben den Berg, der öffnet sich dann, und du kannst eintreten. Am leichtesten wirst du den Drachen töten, wenn du auf seinen Rücken trittst, denn so kann er dir nicht schaden.
Nimm hierauf das Schwert in die rechte Hand, und breite mit der linken über die Krone, welche der Drache auf dem Kopf trägt, das weiße Tuch aus, und nimm die selbe weg. Ist dies geschehen, so erwachen der Drache und auch die Schlangen, welche auf dich zu stürzen werden; jedoch hau nur kräftig um dich herum, und von dem Rücken des Drachen steig nicht herab. Dann wird der Drache mit dir davonfliegen.
Gewahrst du im Flug Wasser unter dir, so schlage mit der im weißen Tuch eingewickelten Krone den Drachen siebenmal auf den Kopf. Darauf stürzt der Drache ins Wasser, du aber fällst auf ein Schiff, welches dich ans Ufer bringt. Dort angelangt, wirf die Krone auf die Erde, tritt auf sie und sprich: ‚Ich will bei den Zwergen sein!', und in einem Augenblick bist du bei uns und empfängst deinen Lohn. Jetzt lebe recht wohl, sei mutig und vertraue auf unsere unsichtbare Hilfe." Damit verschwand der Zwergenkönig.
Der Hirt begab sich nun hinter ein Gebüsch und rieb seinen Körper mit der Salbe ein, nahm das Schwert in die rechte Hand, das weiße Tuch in die linke. So gerüstet erwartete er die Schlangen. Es dauerte nicht lange, und diese kamen unter Zischen heran. Der König kroch zu erst. Als er beim Berg ankam, riß er mittels seiner Zunge ein grünes Kraut aus, berührte mit dem selben den Berg, dieser sprang auf, und er kroch hinein. Eine unendliche Reihe von Schlangen folgte seinem Beispiel. Als die letzte Schlange im Berg verschwunden war, schloß sich der Felsen.
Nach einer Weile trat der Hirt hervor und berührte mit dem Hexenkraut den Felsen, wie er es von den Schlangen gesehen hatte, und der Felsen tat sich auf. Der Schäfer trat nun in das Innere des Berges, und nachdem er eine Reihe von prachtvollen Gängen und Gemächern durchschritten hatte, kam er in einen äußerst kostbar geschmückten Saal, dessen Wände aus Gold und mit Edelsteinen reich besetzt waren.
In der Mitte des selben stand ein kristallener Tisch, auf dem zusammengerollt der Schlangenkönig lag; am Boden um den Tisch herum schliefen die übrigen Schlangen *. Mutig schritt der Hirt über die Schlangen hinweg, ohne daß er ihnen oder sie ihm geschadet hätten, frisch auf den Tisch zu, stieg auf den Rücken des Drachen und nahm ihm mit der in das weiße Tuch gewickelten Hand die Krone weg. Kaum war dies geschehen, so streckte sich der Drache aus, und nun setzte sich der Hirt so auf den Drachen, als wollte er auf ihm reiten.
Der Drache sprühte in seinem Grimm Feuer aus dem Rachen, und die erwachten Schlangen sprangen auf den Hirten zu und wollten ihn beißen; allein dieser hieb einer jeden Schlange, welche in seine Nähe kam, den Kopf ab. - Jetzt bekam der Drache Flügel, erhob sich mit großem Geräusch, durchbrach den oberen Teil des Berges und gelangte ins Freie. Er flog nun, mit dem Hirten auf dem Rücken, über Berg und Tal pfeilschnell fort. Als der Schäfer unter sich plötzlich Wasser erblickte, schlug er den Drachen mit der Krone siebenmal auf den Kopf - und siehe da, der Drache senkte sich mit fürchterlichem Gebrüll ins Meer.
Der Hirt fiel, wie der Zwerg vorher gesagt hatte, auf ein Schiff, und dieses brachte ihn ans Ufer. Hier angekommen, gedachte er abermals der Worte des Zwergenkönigs, warf die Krone auf die Erde, trat darauf und sprach: "Ich will bei den Zwergen sein!" Im gleichen Augenblick war er an dem gewünschten Ort und stand vor dem rauchenden Berg unter den jubelnden Zwergen, welche ihn als ihren Retter begrüßten.
Mit vielen Danksagungen übergab der Zwergenkönig dem Schäfer den großen Schatz. Der Hirt war nun überreich, kaufte dem König, bei dem er früher gedient hatte, sein Land ab, heiratete eine seiner Töchter und lebte viele Jahre lang glücklich. Die Zwerge aber zogen in ein anderes Land und machten sich dort ansässig.
Von den Schlangen wurden die meisten verbrannt oder von dem einstürzenden Berg erschlagen, jene aber, denen es gelang, sich zu verkriechen oder zu entkommen, wurden von der Hitze so geblendet, daß sie alle blind wurden und es heutigen Tages noch sind. Seit dieser Zeit, sagen die Leute, gibt es wohl Wassereidechsen, aber wenige Schlangen und gar keinen Drachen mehr.
Während des Winterschlafes sind die Schlangen gefühllos und so starr, als wären sie aus Stein. Zuerst erwacht die älteste Schlange (der Drache) und weckt dann die übrigen auf, indem sie ruft: "Es ist Zeit!"
Quelle: Märchen aus der Umgebung von Moldautein im südlichen Böhmen
KÖNIG ILTIS ...
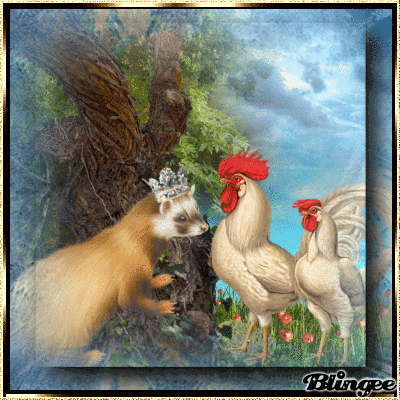
Einst wurden die Frösche mit ihrer alten Verfassung unzufrieden; sie quakten und quakten so lange, bis sie endlich unter Quaken den langbeinigen Storch zu ihrem König wählten.
Als dies die Hühner und Hennen sahen, wollten sie hinter den Fröschen nicht zurück bleiben; sie meinten, es wäre gut, wenn sie auch ihren König hätten. Sie hielten daher einen allgemeinen Landtag und begannen sich zu beraten. Alle waren bisher eines Sinnes gewesen. Als es aber dazu kam, wer König sein solle, begannen sie zu zanken und zu hadern; denn niemand wollte dulden, daß der Andere über ihn herrsche, sondern jeder hätte selbst gern über die anderen geherrscht. Es stellten sich die Hähne zum Kampfe, und hackten mit den Schnäbeln aufeinander los, daß die Federn von einander stoben und ihre Kämme bluteten.
Endlich riet ihnen ein alter weiser Hahn, es wäre das Beste, wenn sie den König Iltis zu ihrem König nähmen; der sei ein gewaltiger Herr mit starken Zähnen, den jeder fürchten, und der gewiß Ruhe und Ordnung herstellen werde. Der Rat gefiel den Hähnen, und sie sandten sogleich an den Iltis, um mit ihm einen Vertrag zu schließen.
Als der Iltis ihr Begehren vernommen, zeigte er sich sehr freundlich und bereitwillig; er versprach ihnen auch, sie vor dem Hühnergeier, der ihre Kinder fort trage, vor dem Marder, der ihre Eier austrinke, und vor dem Spatzen, der ihnen die Körner vor der Nase weg stehle, zu schützen, und verhieß ihnen, die schönen, großen Hähne zu seinen Kammerherren zu machen, und zu anderen Würden zu erheben. Allen gefiel, was er versprach, den Hennen und den Hähnen, und so setzten sie den Iltis feierlich auf den Thron, und waren froh, daß sie einen so mächtigen und gütigen König hätten.
Es währte nicht lange, so gelüstete den Iltis nach einem Huhn. Um die Gemüter nicht gleich durch offenbare Gewalt zu erbittern, beschloß er, unter irgend einem tauglichen Vorwand ein Huhn tot zu beißen, und dessen Blut auszusaugen. Er ließ daher einen schönen fetten Hahn vor sich rufen, und fragte ihn, ob er was rieche.
Der Hahn war eine gute ehrliche Haut, und sagte aufrichtig: »Verzeiht, Herr König, ich rieche etwas, das entsetzlich stinkt.« Es war dies der Gestank, den die Iltisse gewöhnlich verbreiteten. »Du unverschämter Wicht,« fuhr der Iltis auf, »das wagst Du Deinem König ins Gesicht zu sagen?« und schnapps! biß er ihm den Kopf ab, und sog ihm das Blut aus. Dann ließ er einen zweiten Hahn rufen, und fragte ihn gleichfalls, ob er was rieche.
Der Hahn, der seines Kameraden Leib ohne Kopf da liegen und des Iltis Maul von Blut triefen sah, merkte, daß es übel mit ihm stehe. Er begann vor Angst am ganzen Leibe zu zittern, und vermochte kein Wort über die Lippen zu bringen. »Warum zitterst Du?« fragte ihn der Iltis streng. »Mir scheint, Du hast kein gutes Gewissen. Sprich, was riechst Du?« Der Hahn raffte alle seine Kraft zusammen, verneigte sich tief, und sagte mit feiner, süßer Stimme: »Herr König, ich rieche etwas, das wunderlich duftet.« - »Tückischer Verräther,« rief der Iltis zornig, »Du willst Deine Erbärmlichkeit mit Schmeicheleien beschönigen?« und schnaps! biß er ihm den Kopf ab, und sog ihm das Blut aus.
Der Iltis hatte zwar schon zur Genüge, allein das Spiel mit den Hähnen machte ihm Vergnügen; drum ließ er noch einen dritten Hahn vor sich rufen, und fragte ihn ebenfalls, was er rieche. Der aber war pfiffig; er sah zwar die zwei Leichname ohne Kopf und bemerkte Blut an des Iltis Barte, doch tat er nichts dergleichen. Er verneigte sich einige Male nach Gebühr und erwiderte dem Iltis vorsichtig: »Verzeiht, Herr König, das Wetter ist schlecht, ich habe einen furchtbaren Schnupfen.«
Der Iltis, der sah, wie klug sich der Hahn aus der Schlinge ziehe, und dem gerade nichts Anderes einfiel, was er gegen ihn vorbringen könnte, lächelte huldreich, und entließ ihn in Gnaden.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
ZITEK, DER HEXENMEISTER ...
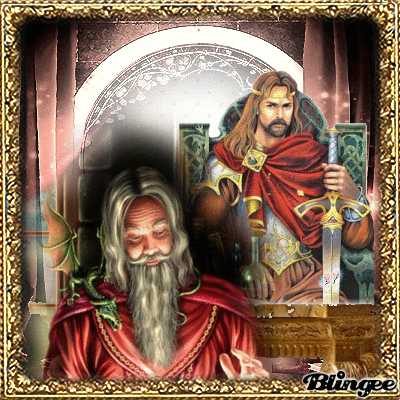
König Wenzel IV. war ein fröhlicher Herr und ein Liebhaber von Scherzen und Späßen. Er hielt an seinem Hofe auch einen gewissen Zitek, ein über die Maßen gescheites und gewandtes Männlein, dem es oblag, den König in seinen vielen Leiden, die ihm die widerspenstigen böhmischen Herren verursachten, mit seinem Witz zu erheitern; kurz, er war des Königs viel geliebter Hofnarr.
Aber Zitek verstand mehr, als Brot zu essen und Späße zu machen; er war in die geheime Kunst eingeweiht, und es ging das allgemeine Gerücht aus, daß er mit den Geistern verkehre. Daher fürchteten sich alle Hofleute des Königs vor ihm, und sahen ihm manches nach, was sich ein anderer nicht hätte erlauben dürfen. Der König aber empfand seine Lust an ihm, und hielt ihn selbst dazu an, Dem oder Jenem, den er seines Vorwitzes oder eines anderen leichten Vergehens wegen strafen wollte, etwas anzutun, was ihn dem Gelächter der Übrigen preisgab. Doch auch ohne Antrieb des Königs führte er oft verschiedene Späße mit den Hofleuten und den Gästen aus, die der König gern zu sich lud, da er lustige Gesellschaft liebte.
Gewöhnlich aß Zitek mit den Edelknaben und Kammerjunkern des Königs und nur auf besondere Einladung an der königlichen Tafel. Das war jedoch ein hungriges Völklein, diese Edelknaben und Junker, lebensmutige Leute mit gesunden Mägen, so daß es nicht geheuer war, mit ihnen an einem Tische zu sitzen. Und Zitek hatte auch seine Lieblingsspeisen, denen er gern zu sprach, weshalb es nicht zu verwundern war, daß bei Tische eine ungewöhnliche Tätigkeit der Kinnbacken und Zähne herrschte, und wer nicht dazu tat, in Gefahr kam, hungrig vom Tische auf zu stehen.
Zitek aber liebte über alles die Bequemlichkeit; er war ein wahrer Wohlschmecker, der guten Bissen gern mit einer Art Andacht aß, damit ihn ihr Wohlgeschmack länger vergnüge. Darum verdroß ihn oft die Gier der jungen Leute, und er beschloß, sie bei einer schicklichen Gelegenheit zu strafen.
Da traf sich einst, daß ein wunderschöner gesulzter Hecht aufgetragen wurde, wobei unserem Zitek, dessen Leibgericht das war, das Herz im Leibe hüpfte, und der Mund wässerte. Kam die Schüssel in die Hände der eßlustigen Herrlein, so war es um sein Vergnügen geschehen. Die Schüssel ging in die Runde. Zuerst wollte der Stallmeister des Königs nehmen; doch siehe, statt mit der Hand, aus der ihm die Gabel entfiel, greift er mit einem Pferdefuße zu, worüber er nicht wenig erschrak und bleich wie die Wand wurde, während die übrigen Tischgenossen, die errieten, daß es eins von den Stücken Ziteks sei, ungeheuer über ihn lachten.
Zitek faßt die Schlüssel, und reicht sie nach der Reihe seinem Nachbar, aber auch dem, als er zugreifen will, verwandelte sich die Hand in einen Huf. Da hörte das Lachen auf, denn der Gesellschaft bemächtigte sich die Ahnung, es sei nicht bloß auf den Stallmeister abgesehen. Zitek reicht weiter; aber wer in die Schüssel langen wollte, hatte einen Huf statt der Hand. So ging er am ganzen Tisch herum und des Hechts wurde nicht weniger; worauf er sich bequem auf seinen Platz setzte, die Schüssel vor sich hin stellte, und sich an die Arbeit machte, ohne eher nach zu lassen, als bis von dem lieben Hecht kein Bissen übrig war.
Hierauf erhob er sich, wünschte den Tischgenossen ein: »Wohl bekomm´s,« und verließ den Saal. In diesem Augenblicke hatte jeder wieder seine Hand. - Als der König von dem Stückchen hörte, konnte er sich des Lachens nicht enthalten. Das junge Volk hätte sich an Zitek gern gerächt; weil es sich jedoch vor ihm fürchtete, getraute es sich nicht an ihn, denn es wußte, daß er jede Kränkung ahnde.
Wie sich Zitek zu rächen pflegte, zeigt folgendes Beispiel. Einst führte er zur Kurzweile vor dem königlichen Hofe in Gegenwart einer zahllosen Menge von Zuschauern verschiedene Stückchen auf. Bald nahm er diese, bald jene, bald eine furchtbare, bald eine lächerliche Gestalt an, fuhr in einer Nußschale, die zwei Käfer zogen, und produzierte mehr der gleichen Dinge. Endlich spannte er einen Hahn an einen dicken und langen Balken, der vor dem königlichen Palast lag, und den kaum zehn starke Kerle in die Höhe gehoben hätten, und siehe: der Hahn warf den Kopf leicht empor, schritt aus und zog den Balken wie Nichts.
Da war die Verwunderung allgemein, als sich auf einmal unter den Zuschauern eine weibliche Stimme meldet, die ruft: »Ei was, der Hahn soll einen Balken ziehen? Seht Ihr denn nicht, daß es nur ein Strohhalm ist?« - Die Zuschauer sehen sich nach der Person um, die spricht, und es steht ein Mägdlein da, mit einem Korb voll Heu auf dem Rücken, das die Arme in die Seiten stemmt, und sie laut auslacht daß sie sich von dem Gaukler so verblenden ließen. Es verhielt sich in der Tat so, denn die Hauptkunst Ziteks bestand in der Täuschung der Sinne, und das, was allen ein schwerer Balken schien, war wirklich nur ein Strohhalm, der sich bloß dem Mägdlein in seiner Wesenheit darstellte, weil es im Korbe zwischen dem Gras ein vierblättriges Kleeblatt hatte, das, wie Jedermann weiß, eine besondere Zaubermacht besitzt.
Das verdroß Zitek, und er nahm sich vor, das Mägdlein für seine Keckheit zu bestrafen. »Nimm Dich in Acht, Mägdlein,« sprach er, »daß Dir heut nichts Widerwärtiges begegne:« Es war nach dem Gaukelspiel. Die Zuschauer gingen auseinander, und auch das Mägdlein begab sich mit seinem Gras nach Hause. Da scheint es ihm auf einmal, als schreite es im Wasser, und das wachse ihm bis an die Knöchel, ja höher bis an die Knie, so daß es das Röcklein schürzen mußte und laut schrie, zum Ergötzen aller derer, die eben Augenzeugen waren. Es war kein Wasser, sondern eine ähnliche Täuschung der Sinne, wie mit dem Balken, und das Mägdlein schritt eigentlich trockenen Fußes über den Platz.
Einst saß der König mit seinen Zechgesellen zusammen, unter denen sich auch Zitek befand. Ungewöhnlich aufgeheitert forderte er Zitek auf, irgend eine Kurzweile zu veranstalten. Zitek versprach es, ohne jedoch scheinbar eine Vorbereitung zu treffen, und das frohe Gespräch ging weiter. Plötzlich erhebt sich außen ein furchtbarer Lärm, und aus dem Gewirr verschiedener Stimmen lassen sich die Worte hören: »Es brennt, schlagt zu, schont nicht!« Da springen die Zecher auf und stürzen zu den Fenstern, um zu sehen, was es gebe; nur der König, der seinen Hofnarren und dessen Stückchen kannte, bleibt sitzen in Erwartung der kommenden Dinge.
Als die Gäste des Königs die Köpfe zu den Fenstern hinaus steckten, ward es still, in dem Hofe war keine lebende Seele zu schauen. Alles war ruhig wie früher. Sie wollten nun die Köpfe zurückziehen, doch wehe, Jedem waren zwei ungeheure Hirschhörner angewachsen, die den Rückzug wehrten. Als der König dies sah, brach er in ein lautes Gelächter aus, und ergötzte sich eine geraume Zeit an den sonderbaren Gebärden der in der Falle gefangenen Gäste, die sich trotz aller Mühe umsonst anstrengten, aus der unangenehmen Lage zu entkommen, bis der König, nachdem er sich satt gelacht, Zitek ein Zeichen gab, damit er sie aus ihrer Haft befreie.
Allein Zitek war kein bloßer Hofnarr des Königs, er erwies ihm manchmal durch seine Kunst gewichtige Dienste, wofür der König erkenntlich war und ihn in Ehren hielt. Zum Zeugniß dient Folgendes:
Vor Jahren hatte der König einigen böhmischen Herren Krongüter verpfändet, und jetzt, als er sie zurück forderte, und sie auslösen wollte, weigerten sie sich, sie zurück zu erstatten, worüber der König sich sehr erboste; doch sie beachteten den Zorn des Königs nicht, und behielten die Güter, ja sie wagten der königlichen Macht zu trotzen. In dieser Verlegenheit riet Zitek dem König, und dieser befolgte seinen Rat.
Der König tat lange Zeit keine Erwähnung von der Auslösung der verpfändeten Güter, so daß es endlich schien, als hatte er die Sache vergessen, oder sie bei Seite gesetzt, und die Besitzer der Güter, die früher dem König ausgewichen, besuchten den Hof wieder wie sonst. Eines Tages lud sie der König zu einem freundschaftlichen Mahl, und sie, nichts ahnend, folgten der Einladung. Es wurde lustig getafelt, und Zitek saß mit unter des Königs Gästen. Als aber alles in der besten Laune ist, da öffnen sich plötzlich auf ein Zeichen des Königs die Türflügel, und herein tritt im Scharlachkleid mit einem langen Schwert in der Hand, wie zum Richtgeschäft bereit, des Königs furchtbarer Schwager.
Die Gäste erschraken; sie beginnen aus vollem Halse: »Verrat!« zu schreien, und wollen sich von den Stühlen erheben und ihre Schwerter zücken. Wie wächst jedoch ihr Schrecken, als sich keiner zu rühren im Stande ist, und die Schwerter nicht aus den Scheiden mögen! Zitek hat sie alle fest gebannt. Es stelle sich jeder vor, wie den Armen zu Mute gewesen sein mußte, als sie sich hin und her wanden, an den Griffen der Schwerter zogen, und alles umsonst! Sie sahen den gewissen Tod vor sich.
Da winkte der König seinem Schreiber, und der legte jedem der angefrornen Herren eine Schrift vor, worin die Summe für das verpfändete Gut quittiert war. »Unterschreibe, Herr Jan, und stelle mir mein Schloß zurück!« sprach der der König zu dem, und zu anderen: »Unterschreibe, Herr Benesch, und Herr Plichta, Du! Und daraus zieht die Lehre, daß man sich fremdes Gut nicht zu eignen soll. Bevor Ihr nicht unterschreibt, rührt Ihr Euch nicht von der Stelle, und die Verstockten wird mein Schwager bedienen!« -
Was blieb den Herren übrig, als zu unterschreiben? Worauf sie von dem König in Frieden entlassen wurden. So gelangte der König auf leichte Art zu seinen Gütern; seit der Zeit aber feindeten ihn die Herren an, taten ihm alles zum Trotze, und nahmen ihn sogar zweimal gefangen, und setzten ihn fest.
Eines Tages ging Zitek übers Feld, und kam zu einer abgemähten Wiese, die dem reichen Bäcker Mikesch gehörte, der als ein Geizhals verschrien war, und auf der das Heu in Schobern aufgehäuft lag. Da fiel es Zitek ein, einen Scherz zu machen, und er verwandelte alle Schober, deren dreißig waren, in Schweine, die er durch das nahe Städtchen an Mikesch´s Haus vorbei trieb. Mikesch stand im Haustor, und als er die beleibten Schweine vorbei treiben sah, fragte er, ob sie zu verkaufen seien. Zitek wurde mit ihm bald einig, und Mikesch, in der Meinung, er habe wohlfeil gekauft, zahlte bereitwillig die verabredetet Summe.
Beim Scheiden erteilte ihm Zitek die Warnung, er solle die Schweine nicht schwemmen, und auf sein Heu Acht haben. Mikesch aber beachtete das nicht, und trieb die Schweine noch an dem selben Tage in den Bach, der bei dem Städtchen vorbei floß. Doch wehe! Sobald die Schweine das Wasser berührten, verwandelten sie sich wieder in das, was sie früher gewesen waren, und in dem Bache schwamm Mikesch´s Heu. Man kann sich leicht die Wut des alten Geizhalses vorstellen, der sich so um sein Geld betrogen sah, besonders als ihm gemeldet war, sein Heu sei von der Wiese verschwunden.
Es war jetzt seine Sorge, wie er wieder zu seinem Gelde gelangen könnte; darum fragte er in dem ganzen Städtchen nach, wo jemand den Schweinetreiber gesehen hätte. Man wies ihn in die Schenke, wo er Zitek auch fand, der auf einer Bank lag und schlief. Mikesch wollte ihn wecken und packte ihn beim Fuße; allein wie groß war sein Entsetzen, als ihm der Fuß in der Hand blieb, der vollends ausgerenkt war. Zitek erwachte nun, erhob ein fürchterliches Geschrei, und schickte nach dem Richter, der Mikesch verhörte und zu einer ansehnlichen Geldstrafe verurteilte. Zitek aber setzte sich hierauf den Fuß wieder an, und ging wohl behalten seines Weges. Mikesch trug nur Spott davon, und von der Zeit an heißt es von jemandem, der bei einem Kauf übel wegkommt: »Es ist ihm ergangen wie Mikesch mit den Schweinen.«
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
VOM VERSTELLTEN NARREN ...
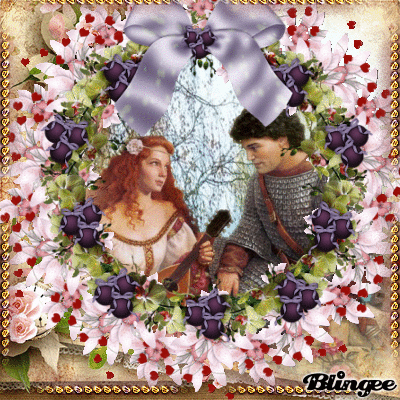
Es war einmal ein königlicher Sohn, ein Prinz. Er sagte zu seinem Vater, er werde in die Welt hinaus ziehen, um die Welt kennen zu lernen. »Na«, sagt dieser, »was wirst du dort in der Welt machen? Du bist doch kein Handwerker?« Er ging also. Der Vater ließ ihn gehen und er ging in die Welt wandern. Also wanderte er bis in ein anderes Land. So gelangte er bis zu einer Stadt.
Als er hin kam, ging er zu einem Gärtner und bat ihn um Arbeit, ob er ihn nicht als Gesellen aufnehmen möchte. Und dieser sagte: »Ah, ich allein darf nicht, das ist ein königlicher Garten, aber ich muss den Herrn König fragen, ob ich einen Gesellen aufnehmen darf.« Der König willigte ein; wenn er geschickt sei, so solle er ihn nehmen. Also wies ihm der Gärtner im Garten die Arbeit an, die Bäume zu zu schneiden und den Garten zu reinigen. Es ging ihm gut bei ihm, er hatte eine gute Kost und alles, was er brauchte; ihm gefiel das. Schon wohnte er dort einige Wochen.
Also der König hatte eine Prinzessin, die sagte zu sich: »Ich möchte gerne diesen Gesellen zu sehen bekommen, was für ein Mensch das ist.« Sie ging also hin in den Garten spazieren. Als sie hin kam in den Garten, wand er einen schönen Blumenkranz. Sie ging zu ihm, grüsste ihn, bewillkommte ihn und er sie; er wüsste schon was zu tun. Sie schaut ihn an und sagt zu ihm, was er für den Kranz wolle; sie werde ihn ihm abkaufen. Er wollte aber kein Geld dafür; sie solle ihm nur erlauben, in ihre Stube zu kommen.
Sie sagte zu ihm: »Das kann nicht sein, dort hin darf kein Mann zu mir kommen, nur eine Frau.« Sie belehrte ihn aber, dass sie ihm abends die Frauenkleider durch das Dienstmädchen schicken werde; er solle die Frauenkleider anlegen, und dann werde er zu ihr kommen können. Er kleidete sich also wirklich in die Frauenkleider um und ging abends zu ihr. Nachdem er also zu ihr gekommen war, unterhielten sie sich, sie hatte gute Speisen bereit, gute Getränke; so erzählten sie sich verschiedene Dinge, und dann wollte er zu ihr ins Bett schlafen gehen, aber sie willigte nicht ein.
Zeitlich früh kehrte er wieder zum Gärtner in den Garten zurück und arbeitete nach allen seinen Kräften. Sie fühlte doch nach ihm Begehren, er gefiel ihr sehr; sie ging wieder in den Garten spazieren. Er aber wand wieder einen Kranz, einen kostbaren Kranz. War der erste schön, war dieser noch schöner; ihr gefiel er noch besser als der erste. Sie wollte also den Kranz von ihm, wollte ihn ihm bezahlen; sie werde ihn gut bezahlen. Er wollte ihr ihn schenken, sie wollte ihn aber nicht umsonst haben. Sie verabredeten sich also, sie nahm ihn für den Kranz wieder zu sich, zur Nacht. Sie schickte ihm wieder die Frauenkleider, und er kam zur Nacht, zu ihr.
Als er also zu ihr kam, war alles wieder zum Essen und Trinken bereit. Also endlich wollte er, sie solle ihm erlauben, sich mit ihr ins Bett legen. Also sie willigte schon ein, er dürfe sich zu ihr legen. Als sie so lagen, legte sie einen Säbel in mitten des Bettes, damit er sich nicht rühre. Das alles war aber vergebens; sie selbst schob dann den Säbel bei Seite und sie spaßten so lange miteinander, bis sie etwas ausführten. In der früh ging er wieder nach Hause, in den Garten arbeiten.
In dessen ging sie nicht mehr in den Garten; schon einige Wochen ging sie nicht mehr in den Garten. Aber mit ihr war es schon anders auf der Welt, sie war krank, weil sie schon schwanger war. Sie kam also einmal zu ihm in den Garten und beschwerte sich bei ihm, dass es ihr schlecht gehen wird, wenn der Vater erfährt, wie es mit ihr steht. Er riet ihr also, recht viel Geld als Reisekosten mit zu nehmen, da sie fliehen wollten. Sie befolgte es. Sie nahm viel Geld mit, und zur Nachtzeit ging er mit ihr in die Heimat, zu seinem König. Alles Geld nahm er ihr ab, sie ließ nichts für sich zurück.
Sie kamen in ein Dorf, sie war hungrig. Er sagte: »Alles ist vergebens, das Geld haben wir verbraucht, wir haben kein Geld mehr, wir müssen betteln gehen. Du gehst auf diese Seite des Dorfes betteln und ich werde auf der anderen Seite betteln gehen. Jeder für sich.« Er ging aber in ein Wirtshaus, dort aß er, trank, machte dann Einkäufe. Sie aber ging von einer Hütte zur anderen und bettelte. Sie erbettelte einige Stücke Brot. Er aber kaufte einen ganzen Laib Brot im Wirtshaus, zerschnitt ihn in lauter Stücke. Nun schaute er nach ihr, wie sie herum ging. Wie sie also zusammen kamen, gingen sie wieder miteinander.
Sie zeigte ihm also, wie viel Brot sie hatte, und er zeigte auch sein Brot. Sie sagte zu ihm: »Wie kommt es, dass all dein Brot gleich ist, meine Brotstücke aber jedes anders?« Er sprach zu ihr: »Ja auf dieser Seite backen sie von einer Hütte zur anderen alle gleiches Brot, dort aber, auf der Seite, backen sie in jeder Hütte ein anderes Brot.« Sie aß also von dem Brote, er aber aß nichts, er brauchte es nicht; er hatte sich schon im Wirtshaus am Braten satt gegessen und am Weine satt getrunken.
Schon waren sie in die Stadt gekommen, woher er war, wo sein Vater König war. Also er ging und mietete ein Quartier und sagte zu ihr: »Da wirst Du wohnen« und ging fort. Es dauerte nicht lange, nach kurzer Zeit kam er zu ihr und sagt zu ihr: »Morgen wird hier ein Jahrmarkt sein.« Er ging und kaufte neue Töpfe vom Töpfer und sagte zu ihr: »Da auf diesem Platze wirst Du die Töpfe verkaufen.« Also ging sie auf den Platz, den er ihr angewiesen hatte, und er ging nach Hause zu seinem König, zu seinem Vater, und erzählte ihm alles, was er getan.
Er nahm sich einen Kutscher mit Wagen, mit zwei Pferden, und fährt auf die selbe Stelle, wo sie mit den Töpfen sass, und diese verkaufte. Dem Kutscher befahl er, er solle die Töpfe überfahren, um sie alle zu zerschlagen. Dieser tat es wirklich so und zerschlug alle Töpfe. Sie weinte und ging in ihre Wohnung. Er aber fuhr wieder nach Hause, kleidete sich um und ging zu ihr. Sie weinte und klagte. Er fragte sie, warum sie weine? »Es fuhr ein Herr in einer Kutsche, und der Kutscher fuhr in die Töpfe hinein und zerschlug alle.« Er sagte also zu ihr: »Na, weine nicht, das macht nichts.«
Dann sagte er zu ihr: »Ich werde ein Wirtshaus mieten, ich kaufe die Getränke, und es sind viele Soldaten hier; jeder Soldat trinkt gerne Branntwein. So können wir viel Geld dabei gewinnen.« Er kaufte also die Getränke, das Wirtshaus, und sie sollte als Wirtin den Soldaten den Branntwein verkaufen. Und er ließ im Heere Kund machen: »Die Jenigen, die große Trinker sind, sollen hin in das Wirtshaus gehen;« und er schenkte ihnen das Geld, dass sie trinken und ihr noch mehr zahlen sollten, als sie verlangen würde.
Die Soldaten waren froh - jeder trinkt gerne, - tranken und zahlten gut. Sie hatte einen schönen Gewinn und hatte keine Getränke mehr. Die Soldaten wollten mehr zu trinken, sie hatte aber nichts mehr. Die Soldaten zogen sich also zurück und gingen nach Hause, jeder in seiner Richtung. Er kam zu ihr: »Nun, wie ist es Dir ergangen?« »Ah gut. Das sind brave Soldaten, die tranken und zahlten gut. Ich habe mehr Geld bekommen, als ich verdient hatte.«
Er sagte also zu ihr: »Morgen wirst Du wieder hin gehen, und wir müssen von den Getränken mehr einkaufen.« Am zweiten Tag also war sehr viel zum Trinken da; sie ging wieder hin verkaufen, und er befahl den Soldaten, sie sollen hin gehen und gut trinken, aber nicht zahlen. Sie sollten die Gläser zerschlagen, ihr aber sollten sie nichts Böses an tun. So hatte er befohlen gehabt und so geschah es auch. Daraufhin floh sie weinend fort, es gab nichts mehr zum Verkaufen; auch hatte sie kein Geld mehr.
Er sagte zu ihr: »Weißt Du was, ich gehe zum König und werde den König bitten, dass er Dich als Köchin in die Küche nehme.« Also gut. Er nahm sie mit und führte sie hin. Sie kochte nun in der Küche und tat alles, was eben zu tun war. Es geschah an dem Tage, als sie schon dort war; ein großes Gastmahl wurde gegeben, große Herrschaften waren dort und es war Musik da. Sobald das Essen zu Ende war, spielte die Musik auf und alle tanzten. Die Prinzessin hatte schon vorher bestimmt, daß wenn sie Köchin sein würde, sie einen Topf mit zwei Henkeln sich an die Beine anbinden würde und von allem, was zu Essen sein würde, wie Fleisch und die Brühe, wolle sie für ihn mitbringen.
Als alle schon tanzten, ging er als Prinz in die Küche - sie erkannte ihn nicht - und nahm sie zum Tanz. Sie wollte aber nicht gehen, zuletzt musste sie aber doch gehen. Er, sobald er mit ihr zu tanzen anfing, einmal, zweimal herum, stieß ihr mit dem Knie an den Topf, der Topf zerbrach, und die Brühe, das Fleisch, alles war am Fußboden. Für sie war es eine große Schande und sie fing an bitterlich zu weinen.
Er nahm sie aber gleich bei der Hand, mit in eine Stube, sie solle sich nichts daraus machen. In der Stube lag schon ein schönes Kleid, wie es einer Prinzessin gebührt, bereit; er gab sich ihr zu erkennen und bat sie um Verzeihung, er habe sie nur geprüft, als er sie so quälte; und nun bat er den Vater, er solle ihm, sie zu heiraten erlauben. Nun machten sie also eine schöne Hochzeit. Früher noch, ehe die Hochzeit war, schickten sie einen Brief an den König, ihren Vater: »Der und der Königssohn nimmt sie.« Nun hatte dieser auch eine große Freude darüber; er wurde auf die Hochzeit geladen.
Ihr Vater kam mit schönem Gelde gefahren und brachte einige Tausend Dukaten an Aussteuer mit, und nun aßen und tranken sie, bis ihnen alle Adern sprangen - und backten das Brot aus Korn, und du, Kostka, lüge nicht.
Tschechien: Václav Tille, böhmisches Märchen
VOM SCHAFHIRTEN UND DEM DRACHEN ...

Es war ein Schafhirt, und als Schafhirt weidete er Schafe. Wenn er die Schafe weidete, blies er sich gewöhnlich eins auf seiner Hirtenpfeife, oder lag auf dem Boden, und sah nach dem Himmel, nach den Bergen, auf die Schafe und auf den grünen Rasen.
Eines Tages - es war im Herbst, zu der Zeit, wo die Schlangen in die Erde schlafen gehen - lag der liebe Schafhirt auf dem Boden, den Kopf auf den Ellenbogen gestützt, und schaute vor sich hin den Berg hinab. Da sah er sein Wunder. Eine große Menge Schlangen kroch von allen Seiten zu dem Felsen heran, der gerade vor ihm stand; als sie bei dem Felsen angekommen, nahm jede Schlange ein Kraut, das dort wuchs, auf die Zunge und berührte mit dem Kraut den Felsen; dieser öffnete sich, und eine Schlange nach der anderen verschwand im Felsen.
Der Schafhirt erhob sich vom Boden, befahl seinem Hund Dunaj die Schafe zu weiden, und ging zu dem Felsen, in dem er bei sich dachte: »Muß doch sehen, was das für ein Kraut ist, und wohin die Schlangen kriechen!« Es war ein Kraut, er kannte es nicht; als er es aber ab riß, und den Felsen damit berührte, öffnete sich der Felsen auch ihm.
Er ging hinein und befand sich in einer Höhle, deren Wände von Gold und Silber strahlten. In der Mitte der Höhle stand ein goldener Tisch; auf dem Tische lag, kreisförmig in sich gewunden, eine ungeheure alte Schlange. Um den Tisch herum lagen lauter Schlangen; alle schliefen so fest, daß sie sich nicht rührten, als der Schafhirt eintrat.
Dem Schafhirten gefiel die Höhle, so lange er in ihr herum ging; dann bekam er lange Weile, erinnerte sich an die Schafe, und wollte zurück, in dem er bei sich dachte: »Habe gesehen, was ich wollte, will jetzt gehen.« Es war leicht zu sagen. »Will jetzt gehen!« - aber wie hinaus? Der Felsen hatte sich hinter dem Schafhirten geschlossen, als er in die Höhle trat; der Schafhirt wußte nicht, was zu tun, was zu sprechen, damit sich ihm der Felsen öffne, und so mußte er in der Höhle bleiben.
»Ei, wenn ich nicht hinaus kann, will ich schlafen,« sagte er, hüllte sich in seine Kotze, legte sich auf den Boden und schlief ein. Es schien ihm, daß er nicht lange geschlafen hatte, als ihn ein Rauschen und Flüstern weckte. Er blickt um sich und meinte, daß er in seiner Hütte schlafe; da sieht er über sich, um sich die strahlenden Wände, den goldenen Tisch, auf dem Tische die alte Schlange, und um den Tisch eine Menge Schlangen, die den goldenen Tisch lecken, indem sie dazwischen fragen: »Ist es schon Zeit?«
Die alte Schlange läßt sie reden, bis sie langsam den Kopf erhebt und sagt: »Es ist Zeit!« Als sie dies gesprochen hatte, streckte sie sich vom Kopf bis zum Schwanze wie eine Rute, kroch vom Tisch auf den Boden, und begab sich zum Eingang der Höhle. Alle Schlangen krochen ihr nach.
Der Schafhirt streckte sich gleichfalls, wie es sich gehört, gähnte, stand auf, und ging den Schlangen nach, in dem er bei sich dachte: »Wo sie gehen, will ich auch gehen.« Es war leicht zu sagen: »Will ich auch gehen« - aber wie? Die alte Schlange berührte den Felsen; der öffnete sich und die Schlangen, eine nach der anderen, schlüpften hinaus. Als die letzte Schlange draußen war, wollte auch der Schafhirt hinaus, allein, der Felsen schloß sich ihm vor der Nase, und die alte Schlange zischte ihm mit pfeifendem Tone zu: »Du, Menschlein, mußt da bleiben!«
»Ei, was sollt ich da bei Euch machen? Gesellschaft habt ihr keine, und schlafen werde ich nicht in einem fort. Laßt mich hinaus, habe die Schafe auf der Weide und zu Hause ein schlimmes Weib, das mich auszanken würde, käme ich nicht zur Zeit nach Hause,« sagte der Schafhirt. »Du darfst nicht von hier, bevor du nicht einen dreifachen Eid ablegst, daß du niemandem sagst, wo du gewesen, und wie du zu uns gekommen bist,« pfiff die Schlange.
Was sollte der Schafhirt tun? Gern schwor er einen dreifachen Eid, nur um hinaus zu kommen. »Hältst du aber den Eid nicht, wird es dir schlimm ergehen!« drohte die alte Schlange, als sie den Schafhirten hinaus ließ. - Doch welche Verwandlung draußen! Dem Schafhirten begannen vor Schrecken die Knie zu zittern, als er sah, wie sich die Jahreszeit verändert habe, daß anstatt des Herbstes Frühling sei.
»O ich Ärmster, was habe ich getan, daß ich den Winter im Felsen verschlief! Je, je, wo finde ich meine Schafe, und was wird mein Weib sagen!« So weh klagte er, in dem er traurig zu seiner Hütte hinauf schritt. Er sah von weitem sein Weib, das womit beschäftigt war. Noch nicht vorbereitet auf ihre Vorwürfe, versteckte er sich in eine Hürde. Als er in der Hürde saß, sah er, daß ein hübscher Herr zu seinem Weibe trat und er hörte, daß er sie fragte, wo sie ihren Mann habe.
Das Weib begann zu weinen, und erzählte, wie eines Tags im Herbst der Hirt die Schafe auf die Weide getrieben, und nicht mehr wieder gekommen sei. Der Hund Dunaj habe die Schafe gebracht, der Schafhirt, der sei dahin. »Vielleicht haben ihn die Wölfe gefressen,« schloß sie, »vielleicht die Kobolde in Stücke zerrissen!«
»Weine nicht!« rief ihr der Schafhirt aus der Hürde zu. »Ich bin am Leben, mich haben nicht die Wölfe gefressen, noch die Kobolde in Stücke zerrissen, ich habe den Winter in der Hürde verschlafen.« Allein das bekam dem Schafhirten übel.
Sobald sein Weib die Worte vernommen, hörte sie auf zu weinen und fing an zu zanken: »Daß dich das Wetter, du fauler Schlingel! Bist du ein ordentlicher Mensch? Bist du ein Schafhirt? Emphielt die Schafe dem lieben Herrgott, legt sich in die Hürde, und schläft wie die Schlangen im Winter!«
Der Schafhirt gab seinem Weibe im Stillen Recht; weil er aber nicht verraten durfte, was mit ihm vor gegangen war, schwieg er und muckste nicht. Der schöne Herr aber sagte zu dem Weibe, ihr Mann habe nicht in der Hürde geschlafen, er sei wo anders gewesen, und wenn ihm der Schafhirt seine Frage beantworte, wolle er ihm viel Geld geben.
Das Weib giftete sich furchtbar über ihren Mann, daß er sie belogen hatte, und wollte mit aller Gewalt wissen, wo er gewesen ist. Der schöne Herr aber schickte sie fort, und versprach ihr Geld, wenn sie schweige. Er selbst gedachte den Schafhirten zu packen.
Als das Weib sich entfernt hatte, nahm der schöne Herr seine natürliche Gestalt an, und da sah der Schafhirt einen Zauberer aus den Bergen vor sich stehen. Er erkannte ihn, weil ein Zauberer drei Augen im Kopf hat. Der Zauberer war ein gewaltiger Mann, er konnte sein Äußeres nach Belieben wechseln, und wer sich ihm widersetzt hätte, den hätte er zum Beispiel in einen Widder verwandelt.
Der Schafhirt erschrak entsetzlich vor dem Zauberer; er hatte noch größere Furcht vor ihm, als vor seinem Weibe. Der Zauberer fragte ihn, wo er gewesen, was er gesehen? Der Schafhirt erbebte bei der Frage. Was sagen? Er fürchtete sich vor der alten Schlange und vor dem Eidbruch, und vor dem dreiäugigen Zauberer fürchtete er sich auch.
Als ihn aber der Zauberer zum dritten Male fragte, und zwar mit furchtbarer Stimme, wo er gewesen, und was er gesehen, und als seine Gestalt, wie es ihm schien, immer größer und größer ward - da vergaß der Schafthirt des Eidschwurs. Er bekannte, wo er gewesen, und wie er in den Felsen gekommen.
»Gut,« sprach der Zauberer, »jetzt komme mit mir, und zeige mir den Felsen und das Kraut!« Der Schafhirt mußte gehen. Als sie zu dem Felsen kamen, riß der Schafhirt das Kraut ab, legte es auf den Felsen, und der Felsen öffnete sich. Der Zauberer wollte aber nicht, daß der Schafhirt hinein gehe, noch ging er selbst weiter, sondern zog ein Buch her vor, und begann daraus laut zu lesen. Der Schafhirt ward blaß vor Angst.
Da erzitterte auf einmal die Erde, aus dem Felsen ließ sich ein Zischen und Pfeifen hören, und heraus kroch ein riesiger Drache, in welchen sich die alte Schlange verwandelt hatte. Aus dem Rachen loderte Feuer, der Kopf war riesengroß, mit dem Schwanz schlug er links und rechts, und berührte er einen Baum, so schmetterte er ihn nieder.
»Wirf ihm die Halfter um den Hals!« befahl der Zauberer, in dem er dem Schafhirten eine Art Zaum reichte, ohne die Augen vom Buche zu wenden. Der Schafhirt nahm den Zaum, fürchtete sich aber dem Drachen zu nahen; erst als ihm der Zauberer zum zweiten und dritten Male gebot, war er bereit, zu gehorchen. Doch ach des armen Schafhirten! Der Drache drehte sich hin und her, und ehe es sich der Schafhirt versah, saß er auf des Drachen Rücken, und der Drache flog mit ihm in die Luft empor.
In dem Augenblicke ward es pechfinster; nur das Feuer, das der Drache aus Rachen und Augen spie, leuchtete auf den Weg. Die Erde zitterte, die Steine kollerten von den Bergen in die Täler. Zornig schlug der Drache mit seinem Schwanz links und rechts, und rechts und links, und die Buchen, die Tannen, die er traf, zerbrachen wie Rütlein - und er sprudelte so viel Wasser nieder, daß es von den Bergen strömte, dem Wagfluß gleich. Das war etwas Schreckliches, Entsetzliches: der Schafhirt war halb tot.
Allmählich aber schien sich die Wut des Drachen zu dämpfen; er schlug nicht mehr mit dem Schwanz, er sprudelte kein Wasser, er spie kein Feuer mehr. Der Schafhirt kam zur Besinnung, und meinte, der Drache werde sich hinunter lassen. Doch dieser hatte nicht genug, er wollte den Schafhirten noch ärger strafen. Höher und immer höher stieg der Drache in die Luft, beständig höher und höher, bis dem Schafhirten die riesigen Berge und Wälder wie Ameisenhaufen erschienen, und immer noch höher stieg er, und als der Schafhirt nichts als Sonne, Sterne und Wolken erblickte, blieb der Drache mit ihm in der Luft hangen.
»Je, je, du lieber Gott, was fange ich an! Da hänge ich in der Luft. Springe ich hinunter, schlag' ich mich tot, und in den Himmel hinauf kann ich nicht fliegen,« weh klagte der Schafhirt, und begann bitter zu weinen. Der Drache muckste nicht. »O Drache, großmächtigster Herr Drache, habt Erbarmen mit mir!« bat er. »Fliegt mit mir wieder hinunter! Meinen Lebtag will ich Euch nie mehr in Zorn bringen!«
Ein Stein hätte sich über den armen Schafhirten erbarmt; der Drache schnaubte und geiferte, sprach nicht eine Silbe und rührte sich auch nicht. Da schlägt auf einmal ans Ohr des Schafhirten Lerchengesang. Der Schafhirt freute sich. Näher und näher flog die Lerche zu ihm, und als sie über ihm schwebte, bat sie der Schafhirt: »O Lerche, du gottgefällig Vöglein, ich bitte Dich, fliege zum himmlischen Vater, und klage ihm meine Not! Sage ihm, daß ich ihn schön grüßen lasse, und ihn um seine Hilfe flehe!«
Die Lerche flog zum himmlischen Vater und richtete die Bitte des Schafhirten aus. Und der himmlische Vater erbarmte sich über den Schafhirten, schrieb etwas mit goldener Schrift auf ein Birkenblatt, steckte das Blatt der Lerche in den Schnabel, und befahl ihr, es auf das Haupt des Drachen niederzulassen. Die Lerche flog, ließ das Blatt, das mit goldner Schrift beschriebene, auf des Drachen Haupt fallen, in dem Augenblick stieg der Drache mit dem Schafhirten zur Erde hinab.
Als der Schafhirt zur Besinnung kam, sah er, daß er bei seiner Hütte stand, sah den Hund Dunaj, wie er die Schafe weidete, nahm das Betglöcklein wahr - und die Geschichte ist alle.
Slowakei: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
DER LANGE, DER BREITE UND DER SCHARFÄUGIGE ...
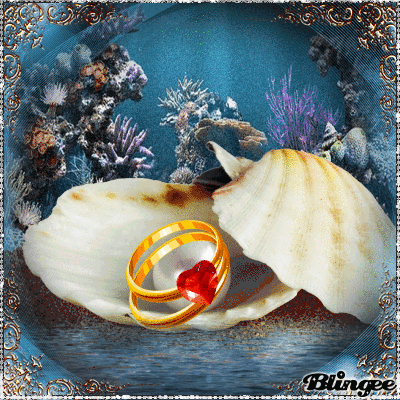
Es war ein König, und er war schon alt, und hatte nur einen einzigen Sohn. Einst berief er den Sohn vor sich und sprach zu ihm: »Mein lieber Sohn, du weißt wohl, daß reifes Obst abfällt, um anderem Platz zu machen. Mein Haupt reift auch allmählich, und vielleicht wird es die Sonne bald nicht mehr bescheinen; aber ehe ich sterbe, möchte ich doch noch gern meine künftige Tochter, deine Gemahlin, schauen. Nimm Dir ein Weib, mein Sohn!«
Und der Königssohn sprach: »Gern, o Vater, möchte ich deinen Willen vollziehen; doch ich habe keine Braut, ich kenne keine.« Da griff der alte König in die Tasche, zog einen goldenen Schlüssel heraus, und gab ihn dem Sohne: »Gehe in den Turm hinauf, ins oberste Stockwerk, blicke dort um Dich, und sage mir welche Braut du am liebsten hättest.« Der Königssohn säumte nicht, und ging. Noch nie in seinem Leben war er dort oben gewesen, und hatte auch nie gehört, was es dort gebe.
Als er hinauf kam bis in das letzte Stockwerk, sah er an der Decke eine kleine eiserne Tür gleich einem Deckel, und sie war verschlossen; die öffnete er mit dem goldenen Schlüssel, hob sie in die Höhe, und trat über sie empor. Da war ein großes, rundes Gemach, die Decke blau wie der Himmel in heiterer Nacht, silberne Sterne glänzten an ihr; der Fußboden war mit einem grünen Seidenteppich überzogen, und rings in der Mauer waren zwölf hohe Fenster in goldenen Rahmen, und in jedem Fenster auf kristallenem Glas war eine Jungfrau mit Regenbogenfarben abgebildet, mit einer Königskrone auf dem Haupt, in jedem Fenster eine andere in anderem Gewand, aber jede schöner als die andere, so daß der Königssohn ganz geblendet war.
Und während er sie so voll Verwunderung betrachtete, ohne zu wissen, welche er wählen solle, da begannen sich die Jungfrauen zu bewegen, als ob sie lebendig wären, und blickten nach ihm, und lächelten ihn an, als ob sie sprechen wollten. Da bemerkte der Königssohn, daß eins der Fenster mit einem weißen Vorhang verhüllt sei, und er zog den Vorhang weg, um zu sehen, was es dahinter gebe.
Da war eine Jungfrau in weißem Gewand, mit einem Silbergürtel gegürtet, mit einer Perlenkrone auf dem Haupt; sie war die schönste von allen, aber traurig und bleich, als ob sie aus dem Grabe gestiegen wäre. Der Königssohn stand lange vor dem Bilde, wie im Traum, und während er sie so betrachtete, ward ihm weh ums Herz und er sprach: »Die will ich und keine Andere!« Und sobald er das Wort gesprochen, neigte die Jungfrau das Haupt, ward rot wie eine Rose, und in dem Augenblick verschwanden die Bilder alle.
Als er wieder hinunter kam, und dem Vater sagte, was er gesehen und welche Jungfrau er sich gewählt, betrübte sich der alte König, bedachte sich und sprach: »Du hast übel getan, mein Sohn, daß du enthüllt hast, was verdeckt war, und hast dich mit deinem Worte in große Gefahr begeben. Diese Jungfrau ist in der Gewalt eines bösen Zauberers, in eisernem Schlosse gefangen; wer es bisher noch versucht hat, sie von dort zu befreien, ist nie mehr wieder gekehrt. Allein was geschehen, läßt sich nicht ungeschehen machen; gegebenes Wort ist Gesetz. Gehe, versuche dein Glück, und kehre wohl behalten Heim!«
Der Königssohn nahm Abschied von dem Vater, setzte sich aufs Roß, und ritt fort, um die Braut zu holen. Und er gelangte in einen großen Wald, und ritt in einem fort durch den Wald, bis er endlich den Weg verlor. Und als er so im Dickicht und zwischen Felsen und Sümpfen mit seinem Roß umher irrte, ohne zu wissen, wohin, hörte er jemanden hinter sich rufen: »He da, wartet!« Der Königssohn sah sich um, und erblickte einen hochgewachsenen Menschen, der ihm nach eilte. »Wartet und nehmt mich mit euch, und nehmt ihr mich in eure Dienste, werdet ihr es nicht bereuen!«
»Wer bist denn du?« sprach der Königssohn, »und was kannst du?« »Ich heiße der Lange und kann mich ausstrecken. Seht ihr dort auf der hohen Tanne das Vogelnest? Ich lange euch das Nest herunter, ohne daß ich hinauf zu klettern brauche.« Und er begann sich auszustrecken, sein Leib wuchs mit Schnelligkeit, bis er so hoch war, als die Tanne; dann langte er nach dem Nest, und augenblicklich schrumpfte er wieder ein, und reichte es dem Königssohn.
»Du verstehst deine Sache gut, allein was helfen mir Vogelnester, wenn du mich aus dem Walde nicht hinaus führen kannst!« »Hm, das ist leicht!« sprach der Lange und begann sich wieder auszustrecken, bis er dreimal so hoch war, als die höchste Föhre im Walde; er blickte ringsum und sagte: »Auf jener Seite dort ist der nächste Weg aus dem Wald.« Dann schrumpfte er wieder ein, nahm das Pferd beim Zaum und ging voran, und ehe sich der Königssohn versah, hatten sie den Wald hinter sich.
Vor ihnen war eine weite Ebene, und hinter der Ebene hohe graue Felsen, wie Mauern einer großen Stadt, und Wald bewachsene Berge. »Dort, Herr, geht mein Kamerad,« sprach der Lange, und zeigte seitwärts auf die Ebene, »den solltet ihr gleichfalls zu euch nehmen; er würde uns wahrlich treffliche Dienste leisten.« Schrei nach ihm und ruf ihn, daß ich sehe, was an ihm ist.«
»Es ist etwas weit, Herr,« sprach der Lange, »kaum würde er mich hören, und lange würde es dauern, ehe er käme, weil er viel zu tragen hat. Ich will ihn lieber holen.« Da streckte sich der Lange wieder in die Höhe, daß sein Kopf bis in die Wolken reichte, machte zwei, drei Schritte, faßte den Kameraden beim Arm, und stellte ihn vor den Königssohn. Es war ein muskulöser Kerl, und hatte einen vier Eimer dicken Bauch.
»Wer bist denn du?« fragte ihn der Königssohn, »und was kannst du?« »Ich, Herr, heiße der Breite, und kann mich ausdehnen.« »Zeig mir das!« »Herr, reitet geschwind fort, geschwind in den Wald!« rief der Breite und begann sich aufzublähen. Der Königssohn wußte nicht, warum er davon reiten solle; allein da er sah, daß der Lange mit Hast zum Wald laufe, spornte er sein Roß, und eilte ihm nach. Und es war hohe Zeit davon zu reiten, sonst hätte der Breite ihn und sein Roß erdrückt, so schnell wuchs sein Bauch nach allen Seiten; es war auf einmal alles voll von ihm, als ob sich ein Berg heran gewälzt. Dann hörte der Breite auf, sich aufzublähen, blies die Luft aus sich heraus, daß sich die Wälder bewegten, und wurde wieder so, wie er gewesen.
»Du hast mich durch gehetzt!« sprach der Königssohn, »aber so einen Kerl finde ich nicht alle Tage, komm mit mir!« Sie zogen nun weiter. Als sie den Felsen nahe kamen, begegneten sie Einem, der die Augen mit einem Tuch verbunden hatte. »Herr, das ist unser dritter Kamerad,« sagte der Lange, »den solltet ihr auch in eure Dienste nehmen; er würde wahrlich sein Brot nicht umsonst essen.« »Wer bist denn du?« fragte ihn der Königssohn, »und warum hast du die Augen verbunden? Du siehst ja nicht den Weg.«
»Hoi, Herr, umgekehrt; gerade weil ich zu scharf sehe, muß ich mir die Augen verbinden. Ich sehe mit verbundenen Augen, wie ein anderer mit unverbundenen, und wenn ich das Tuch weg nehme, so blicke ich überall durch und durch, und sehe ich auf etwas scharf hin, so fängt es Feuer, und was nicht brennen kann, zerspringt in Stücke. Darum heiße ich der Scharfäugige.« Dann kehrte er sich zu dem gegenüber stehenden Felsen, nahm das Tuch ab, und heftete die feurigen Augen auf ihn; und der Felsen begann zu prasseln, und die Stücke flogen nach allen Seiten, und in einer kleinen Weile war von dem Felsen nichts übrig als Sand. In dem Sand glänzte etwas wie Feuer. Der Scharfäugige ging und brachte es dem Königssohn. Es war gediegenes Gold.
»Hoho, du bist ein unbezahlbarer Kerl!« sprach der Königssohn; »ein Tor, der sich deiner nicht bedienen wollte! Aber, wenn du ein so gutes Auge hast, sieh doch, und sage mir, wie weit wir noch zu dem eisernen Schlosse haben, und was jetzt dort vorgeht?« »Wenn ihr allein rittet, Herr,« antwortete der Scharfäugige, »so würdet ihr vielleicht in einem Jahre nicht hin kommen; aber mit uns seid ihr heute noch dort - eben bereiten sie für uns das Nachtmahl.« »Und was macht dort meine Braut?«
»Hinter eisernem Gitter
Des Zaub'rers Macht
In hohem Turme
Sie streng bewacht.«
Und der Königssohn sprach: »Wer mein Freund ist, der helfe mir sie befreien!« Und sie versprachen ihm alle, daß sie ihm helfen würden. So führten sie ihn zwischen den Felsen durch den Durchbruch, den der Scharfäugige mit seinen Augen gemacht, und durch die Felsen über hohe Berge und durch dichte Wälder weiter und weiter, und wo ein Hinderniß im Wege war, da räumten es die drei Gesellen sogleich bei Seite. Und als die Sonne sich zum Untergang neigte, begannen die Berge niedriger, die Wälder dünner zu werden, und die Felsen sich zwischen Heidekraut zu verbergen; und als der Sonnenuntergang nahe war, sah der Königssohn nicht weit vor sich das eiserne Schloß; und als die Sonne unterging, ritt er über die eiserne Brücke zum Tor hinein, und nach dem die Sonne untergegangen, hob sich die eiserne Brücke von selbst empor, die Tore schlossen sich plötzlich, und der Königssohn und seine Gesellen waren in dem eisernen Schlosse gefangen.
Als sie im Schloßhof sich umgesehen, gab der Königssohn sein Roß in den Stall - alles war schon für sie eingerichtet - und dann gingen sie in das Schloß. Im Hof, im Stall, im Schloßsaal und in den Gemächern sahen sie in der Dämmerung viel reich gekleidete Leute, Herren und Diener; aber niemand von ihnen rührte sich, alle waren versteinert. Sie gingen durch mehrere Gemächer, und kamen in das Speisezimmer. Das war es hell erleuchtet, in der Mitte ein Tisch, auf ihm der guten Gerichte und Getränke in Fülle, und gedeckt war für vier Personen.
Sie warteten und warteten, dachten, es werde jemand kommen; allein, als lange niemand kam, setzten sie sich und aßen und tranken, so viel ihnen schmeckte. Als sie sich satt gegessen, begannen sie sich um zu sehen, wo sie schlafen würden. Da flog plötzlich die Türe auf und in das Zimmer trat der Zauberer, ein gebückter Greis in langem, schwarzem Gewand, das Haupt kahl, den grauen Bart bis ans Knie, anstatt des Gürtels drei eiserne Reife um den Leib. An der Hand führte er eine schöne, wunderschöne Jungfrau, die weiß angezogen war; um den Leib hatte sie einen Silbergürtel und eine Perlenkrone auf dem Haupt, aber sie war bleich und traurig, als wäre sie aus dem Grab gestiegen.
Der Königssohn erkannte sie sogleich, sprang auf, und ging ihr entgegen; doch ehe er noch ein Wort sprechen konnte, hub der Zauberer zu ihm an: »Ich weiß, warum du gekommen bist; diese Königstochter willst du von hier fort führen. Wohl denn, es sei, du darfst sie dir nehmen, wenn du sie durch drei Nächte so zu hüten weißt, daß sie dir nicht entschlüpft. Entschlüpft sie dir, so wirst Du samt deinen drei Dienern zu Stein, wie alle, die früher kamen, als du.« Dann wies er der Königstochter einen Sitz, daß sie sich setze, und entfernte sich.
Der Königssohn konnte von der Jungfrau die Augen gar nicht abwenden, so schön war sie. Er begann zu ihr zu sprechen, und fragte sie Verschiedenes; allein sie antwortete nicht, lächelte nicht und sah auf niemanden, als ob sie von Marmor wäre. Er setzte sich neben sie, und gedachte die ganze Nacht nicht zu schlafen, damit sie nicht entschlüpfe; und zu größerer Sicherheit streckte sich der Lange wie ein Riemen aus, und wand sich um das ganze Zimmer an der Wand herum; der Breite setzte sich zwischen die Tür, blähte sich auf und verstopfte sie so, daß nicht einmal ein Mäuslein hätte durch kriechen können, und der Scharfäugige stellte sich zur Säule mitten im Zimmer auf die Wacht. Doch in einer Weile begannen alle zu schlummern, schliefen ein und schliefen die ganze Nacht, als ob man sie ins Wasser geworfen hätte.
Als es Morgens zu dämmern anfing, erwachte der Königssohn zu erst; doch ihm war, als ob ihm jemand ein Messer ins Herz stieße - die Königstochter war verschwunden. Und als bald weckte er die Diener, und fragte, was zu tun sei. »Seid unbesorgt, Herr,« sprach der Scharfäugige, und blickte zum Fenster hinaus, »schon sehe ich sie! Hundert Meilen von hier ist ein Wald und mitten des Waldes eine alte Eiche, und auf der Eiche oben eine Eichel - und die Eichel ist sie.
Der Lange soll mich auf die Schulter nehmen, und wir bekommen sie.« Und der Lange lud ihn sich auf, streckte sich aus und ging - ein Schritt zehn Meilen, und der Scharfäugige zeigte den Weg. Und es verstrich nicht so viel Zeit, als jemand braucht, um herum zu kommen um eine Hütte, und schon waren sie wieder da, und der Lange reichte dem Königssohn die Eichel und sprach: »Herr, laßt sie auf den Boden fallen!« Der Königssohn tat es, und in dem selben Augenblick stand die schöne Königstochter neben ihm. Und als sich die Sonne hinter den Bergen zu zeigen anfing, flog die Tür krachend auf, und der Zauberer trat ins Zimmer, und lachte tückisch; doch als er die Königstochter erblickte, sah er finster, brummte - und krach! sprang ein eiserner Reif an seinem Leib entzwei und fiel ab. Dann nahm er die Jungfrau bei der Hand, und führte sie hinweg.
Den ganzen Tag über hatte der Königssohn nichts zu tun; er ging im Schloß umher und um das Schloß herum, und sah, was es da Besonderes gebe. Überall war es, als ob das Leben in einem Augenblick erstorben wäre. In einem Saal sah er einen Königssohn, der mit beiden Händen ein Schwert geschwungen hielt, als wollte er wen entzwei hauen; doch er hatte den Hieb nicht zu Ende geführt, er war versteinert. In einem Zimmer war ein versteinerter Ritter, als ob er ängstlich von jemandem flöhe, an der Schwelle anstieße und fallen wollte; doch war er noch nicht ganz zu Boden gefallen.
An einem Kamin saß ein Diener, und hielt in der einen Hand ein Stück Braten vom Nachtmahl, mit der anderen wollte er es sich in den Mund stecken, brachte es aber nicht so weit: als er es schon beim Munde hatte, ward er versteinert. Und noch viel andere Versteinerte sah er da, jeden so und in der Stellung, in welcher er war, als der Zauberer sprach: »Werde zu Stein!« Auch gewahrte er da viel versteinerte, schöne Pferde, und im Schlosse und um das Schloß herum war alles wüst und tot. Bäume gab es, doch ohne Blätter; Wiesen gab es, doch ohne Gras; ein Fluß war da, allein er floß nicht; nirgend war ein Vöglein, das gesungen hätte, nirgend ein Blümlein, das geblüht hätte, noch ein Fischlein, das im Wasser wäre geschwommen.
Früh, zu Mittag und des Abends fand der Königssohn mit seinen Gesellen im Schloß ein gutes und reiches Mahl: die Speisen trugen von selbst sich auf, und der Wein schenkte von selbst sich ein. Als das Nachtmahl vorüber war, öffnete sich die Tür wieder und der Zauberer führte die Königstochter herbei, damit sie der Königssohn hüte. Aber obwohl alle entschlossen waren, sich mit aller Macht des Schlafes zu erwehren, so half es ihnen doch nichts, sie schliefen wieder ein. Und als früh in der Dämmerung der Königssohn erwachte und sah, daß die Königstochter verschwunden sei, sprang er empor, und rüttelte den Scharfäugigen an den Schultern: »Hei, steh auf, du Scharfauge! Weißt du, wo die Königstochter ist?«
Der rieb sich die Augen, schaute und sagte: »Schau sehe ich sie! Zweihundert Meilen von hier ist ein Berg, und in dem Berg ein Felsen, und in dem Felsen ein Edelstein, und der Edelstein ist sie. Wenn mich der Lange hin trägt, bekommen wir sie.« Der Lange nahm ihn sogleich auf die Schulter, streckte sich aus und ging - ein Schritt zwanzig Meilen. Der Scharfäugige heftete hierauf seine feurigen Blicke auf den Berg, und der Berg zerstob, und der Felsen in ihm zersprang in tausend Stücke, und zwischen ihnen glänzte der Edelstein. Den nahmen sie und brachten ihn dem Königssohn, und sobald er ihn auf die Erde fallen ließ, stand die Königstochter wieder da. Und als dann der Zauberer kam und sie da sah, funkelten seine Augen vor Galle - und krach! sprang wieder ein eiserner Reif an seinem Leib entzwei, und fiel ab. Er brummte und führte die Königstochter aus dem Zimmer.
An diesem Tage war wieder alles, wie am vorigen. Nach dem Nachtmahl führte der Zauberer die Königstochter wieder herbei, blickte dem Königssohn scharf ins Auge, und warf höhnisch die Worte hin: »Es soll sich zeigen, wer mehr vermag: ob du siegst oder ich!« und hiermit entfernte er sich. Und es gaben sich diesmal alle noch größere Mühe, um sich des Schlafes zu erwehren; sie wollten sich nicht einmal setzen, wollten die ganze Nacht hin durch gehen; aber alles umsonst, es war ihnen angetan: Einer nach dem anderen schlief gehend ein, und die Königstochter entschlüpfte ihnen dennoch.
Des Morgens erwachte der Königssohn wieder zuerst, und als er die Königstochter nicht gewahrte, weckte er den Scharfäugigen: »Hei, stehe auf, du Scharfauge! Sieh, wo die Königstochter ist!« Der Scharfäugige sah lange hinaus: »Hoho, Herr!« sagte er, »sie ist weit, gar weit! dreihundert Meilen von hier ist das schwarze Meer, und mitten im Meer auf dem Boden liegt eine Muschel, und in der Muschel ein goldner Ring - und dieser Ring ist sie. Allein sorgt nicht, wir bekommen sie doch! Heut aber muß der Lange auch den Breiten mit sich nehmen, wir werden ihn brauchen!«
Der Lange nahm auf eine Schulter den Scharfäugigen, auf die andere den Breiten, streckte sich aus und ging - ein Schritt dreißig Meilen. Und als sie zu dem schwarzen Meer kamen, zeigte ihm der Scharfäugige, wohin er nach der Muschel ins Wasser langen solle. Der Lange streckte die Hand aus, so viel er vermochte, allein bis zum Boden konnte er doch nicht reichen. »Wartet, Kameraden, wartet ein wenig, will euch schon helfen!« sprach der Breite, und blähte sich auf, so viel es sein Bauch zuließ; dann legte er sich ans Ufer und trank. In einer kleinen Weile fiel das Wasser so, daß der Lange leicht zum Boden reichte, und die Muschel aus dem Meere holte. Er nahm den Ring heraus, lud die Kameraden auf die Schultern und eilte zurück. Allein auf dem Wege ward es ihm doch zu schwer, mit dem Breiten zu laufen, weil dieser noch das halbe Meer im Bauche hatte; er schüttelte ihn also in einem Tal von der Schulter ab. Das plumpste, als ob ein Sack von einem Turm fiele, und augenblicklich stand das ganze Tal unter Wasser und glich einem großen See; der Breite selbst kroch kaum aus ihm heraus.
Inzwischen war im Schloß dem Königssohn arg zu Mute. Das Morgenrot begann sich hinter den Bergen zu zeigen, und die Diener waren noch nicht zurück, und je flammender das Licht empor stieg, je größer wurde seine Bangigkeit; Todesschweiß bedeckte seine Stirn. Bald darauf erschien die Sonne im Osten wie ein dünner Feuerstreif - und da sprang die Tür plötzlich donnernd auf, und auf der Schwelle stand der Zauberer und sah rings im Zimmer umher, und als er die Königstochter nicht gewahrte, kicherte er abscheulich und trat ins Zimmer. Doch in dem Augenblicke zersplitterte das Fenster in Stücke, und der goldene Ring fiel auf den Boden, und die Königstochter stand wieder da.
Der Scharfäugige nämlich hatte gesehen, was im Schlosse vorging, und in welcher Gefahr sein Herr sich befand, und sagte es dem Langen; der Lange machte einen Schritt, und warf den Ring durchs Fenster in das Zimmer. Der Zauberer brüllte vor Zorn, daß das Schloß erbebte, und krach! da borst sein dritter eiserner Reif und fiel ab, und der Zauberer ward ein Rabe und flog durch das zerbrochene Fenster davon.
Und da redete die schöne Jungfrau sogleich und dankte dem Königssohn, daß er sie befreit habe, und ward rot, wie eine Rose. Und im Schlosse und rund um das Schloß umher belebte sich alles: Der, welcher im Saale das Schwert geschwungen hielt, hieb damit durch die Luft, daß es pfiff, und steckte es dann in die Scheide; Der, welcher an der Schwelle angestoßen, fiel auf den Boden, stand aber gleich wieder auf, und faßte sich an der Nase, um zu fühlen, ob sie noch ganz sei; Der, welcher am Kamin saß, steckte das Stück Braten in den Mund und aß weiter; und so tat ein jeder jedes zur Genüge ab, was er begonnen und wo er aufgehört. In den Ställen stampften und wieherten die Pferde lustig; die Bäume um das Schloß grünten wie das Immergrün, auf den Wiesen war alles voll von bunten Blumen, hoch in der Luft trillerten Lerchen und in dem schnellen Fluß schwammen Schaaren kleiner Fische. Alles Leben. Alles Fröhlichkeit!
Inzwischen kamen in dem Zimmer, wo sich der Königssohn befand, viele Herren zusammen, und alle dankten ihm für ihre Befreiung. Er aber sprach: »Nicht mir habt ihr zu danken; wären meine treuen Diener nicht gewesen, der Lange, der Breite und der Scharfäugige, so wäre ich jetzt gleichfalls Das, was ihr gewesen.« Und gleich darauf machte er sich auf den Heimweg zu seinem Vater, dem alten König, mit seiner Braut und seinen Dienern, dem Langen und dem Scharfäugigen, und alle die Herren begleiteten ihn. Unterwegs begegneten sie dem Breiten und nahmen ihn gleichfalls mit.
Der alte König weinte vor Freude, daß sein Sohn so glücklich gewesen; er dachte schon, daß er nicht mehr wieder kehre. Bald darauf war fröhliche Hochzeit; sie währte drei Wochen, und alle Herren, die der Königssohn befreit hatte, waren geladen. Als die Hochzeit vorüber war, zeigten der Lange, der Breite und der Scharfäugige dem jungen König an, daß sie wieder in die Welt wollten, Arbeit zu suchen. Der junge König redete ihnen zu, sie möchten bei ihm bleiben. »Ich will euch alles bis zu eurem Tod geben, was ihr bedürft; ihr braucht nichts zu arbeiten.« Aber ihnen gefiel solch faules Leben nicht; sie nahmen Urlaub von ihm und gingen, und bis auf den heutigen Tag tummeln sie sich irgendwo in der Welt herum.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
DER HUND UND DER WOLF ...
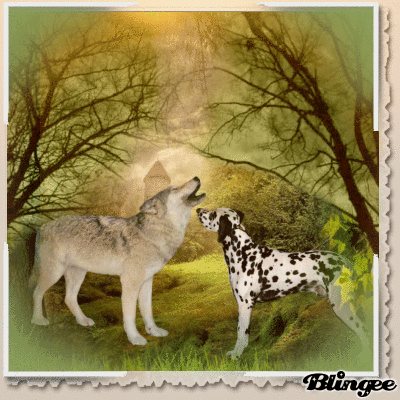
Es war einmal eine Bauernfamilie, welche unter ihren Haustieren auch einen Hofhund namens Sultan hatte. Als der Hund alt geworden war, jagte ihn der Bauer fort, in dem er meinte, daß der selbe seinen Dienst nicht mehr pünktlich versehen könne.
Ganz niedergeschlagen, mit gesenktem Kopf, verließ der Hund das Dorf und klagte für sich: "So belohnt man meine Treue in dem beschwerlichen Dienst; nachdem ich hier meine jungen und kräftigen Jahre in Arbeit zu gebracht habe, jagt man mich im schwachen Alter davon und gönnt mir nicht die Ruhe." So trauernd ging er weiter und irrte viele Tage umher, ohne eine leidliche Unterkunft zu finden. Von dieser langen Wanderung abgemagert und schwach geworden, langte er bei einem Wald an.
Da kam aus dem Wald ein Wolf heraus, rannte auf den armen Hund los und schrie: "Halt! alter Kerl, nun bist du in meiner Gewalt; mache dich also bereit." Als unser Sultan den Wolf so reden hörte, erschrak er und sprach: "Lieber Freund, schau mich nur zuerst recht an, und dir vergeht gewiß der Appetit auf mich; an mir findest du den schlechtesten Braten, welchen du je gehabt hast, denn ich bin nichts als Haut und Bein. Aber ich wüßte Rat."
Der Wolf sprach: "Von dir bedarf ich keines Rats, elender Wicht. Ohne daß du mir ihn sagst, weiß ich, wie er lauten würde: nämlich, ich solle dir das Leben schenken. Nein, es bleibt beim alten, kurz und gut, ich fresse dich!" Hierauf erwiderte der Hund: "Mir fällt gar nicht ein, so von dir zu denken, denn ich will nicht länger leben. Beiß zu, solange du noch gute Lust hast, aber ich rate dir nur zum besten. Wäre es nicht wohl getan, wenn du mich früher mästen und, nachdem ich fett geworden, erst dann fressen würdest? Das Futter ginge dabei nicht verloren, denn du findest auf einmal alles an mir. Das wäre dann ein tüchtiges Stück Braten, was meinst du, Bruder Wolf?"
Der Wolf sprach: "Ich bin zufrieden, wenn die Fütterung nicht lange dauert; folge mir in meine Hütte." Der Hund tat dies, und beide gingen nun tiefer in den Wald. Bei der Hütte angelangt, kroch Sultan hinein, der Wolf aber ging fort, um für den schwachen Hund einiges Wild zu erjagen. Als der selbe zurückkam, warf er seine Beute dem Sultan vor, und dieser ließ es sich wohl schmecken.
Am anderen Tag kam der Wolf und sprach zum Hund: "Gestern hast du gefressen, heute will ich fressen." Der Hund erwiderte: "Aber was fällt dir denn ein, lieber Wolf? Das gestrige Futter habe ich kaum im Magen gespürt." Der Wolf ärgerte sich zwar, mußte aber zufrieden sein und abermals in den Wald gehen, um für den Hund neues Wild zu erjagen. Mit einer ähnlichen Entgegnung fertigte unser Sultan so lange den Wolf ab, wie er sich noch nicht stark genug fühlte, um es mit dem selben aufzunehmen.
Der Wolf jagte fortwährend und brachte seine Beute dem Hund; selbst aß er jedoch wenig oder gar nichts, damit nur Sultan genug bekomme. So kam es, daß der Hund immer mehr an Fleisch und Kraft zu nahm, dem Wolf erging es aber gerade umgekehrt. Am sechsten Tag trat der Wolf vor den Hund und sprach: "Nun glaube ich, daß du reif bist." Sultan antwortete: "O ja, und zwar fühle ich mich so wohl, daß ich es mit dir aufnehmen werde, im Falle du mich nicht frei läßt."
Der Wolf sprach: "Du scherzt! Bedenke, ich habe dich sechs volle Tage hindurch gefüttert, ja selber nichts gegessen, und sollte nun so leer ausgehen? Das geht nimmer mehr!" Hierauf erwiderte Sultan: "Einesteils hast du wohl recht; jedoch wie glaubst du zu meiner Auffressung berechtigt zu sein? " "Dies ist ja das Recht des Starken über den Schwachen", gab der Wolf zur Antwort. "Wohlan", entgegnete der Hund, "so hast du über dich selbst das Urteil gesprochen. Bei diesen Worten machte er einen kühnen Sprung, und ohne daß sich der Wolf versah, lag er am Boden, von Sultan überwältigt.
"Weil du mich am Leben gelassen hast, so will ich dich ebenfalls nicht gleich verderben und lege das Leben in dein Glück; wähle dir noch zwei Genossen, wie ich es auch tue, und erscheine morgen mit den selben hier im Wald, wo wir dann unseren Streit schlichten wollen." Beide trennten sich nun, um Mitkämpfer zu suchen. Der Wolf ging erzürnt tiefer in den Wald; der Hund eilte dem nächsten Dorf zu. Der Wolf fand nach langem Zureden an dem mürrischen, brummigen Bär und dem schlauen Fuchs zwei Kameraden.
Unser Sultan lief zu erst ins Pfarrhaus und bewog dort die große, graue Katze, mit zu gehen. Von da richtete er seine Schritte auf den Hof des Ortsrichters und fand an dem mutigen Hahn den zweiten Mitkämpfer. Kaum dämmerte es, und der Hund war schon mit seinen Bundesgenossen auf der Reise. Es fehlte wenig, so hätte er seine Feinde noch in tiefem Schlaf überrascht.
Der Wolf war am ersten erwacht, weckte seine Kameraden und sprach dann zum Bären: "Du kannst auf Bäume klettern, nicht wahr? Sei so gut, steige da auf diese hohe Tanne, und schau, ob du nicht unsere Feinde erblickst." Der Bär tat dies, und als er oben war, schrie er herunter: "Flieht, unsere Feinde sind schon da, ganz in der Nähe, und welch mächtige Feinde! Es reitet einer stolz einher und trägt sehr viele scharfe Säbel bei sich, welche in der Morgensonne stark glänzen; hinter diesem schreitet bedächtig einer und zieht eine lange Eisenstange nach sich. O wehe uns!"
Bei diesen Worten erschrak der Fuchs so gewaltig, daß er es für das ratsamste hielt, sich aus dem Staub zu machen. Der Bär kletterte eiligst vom Baum herab und verkroch sich in ein dichtes Gestrüpp, so daß von ihm nur die äußerste Schwanzspitze hervorschaute. Jetzt kamen die Feinde heran. Der Wolf, welcher sich von seinen Genossen verlassen sah, wollte das Weite suchen, doch Sultan kam ihm zuvor. Ein Sprung, und der Hund hielt den Wolf am Genick und machte ihm den Garaus.
Unterdessen bemerkte die Katze die im Gebüsch sich bewegende Schwanzspitze des Bären, und in der Hoffnung, eine Maus zu erhaschen, schnappte sie nach der selben. Erschreckt fuhr der Bär aus seinem Versteck hervor und flüchtete sich in aller Eile auf einen Baum und glaubte hier vor den Feinden sicher zu sein; in dessen täuschte er sich, denn es war ja noch der Hahn da. Als der Hahn den Bären auf dem Baum erblickte, sprang er auf den nächsten Ast und so fort immer höher. Der Bär war außer sich, und vor Schreck fiel er herab und blieb mausetot liegen. So endete dieser Kampf.
Die Nachricht von der Heldentat Sultans und seiner Genossen verbreitete sich weit umher und auch in jenes Dorf, in dem Sultan früher gedient hatte. Die Folge davon war, daß die Bauernfamilie ihren treuen Hofhund wieder zu sich nahm und verpflegte.
Quelle: Fabel aus dem südlichen Böhmen
DER TIERE HERBSTGESPRÄCH ...
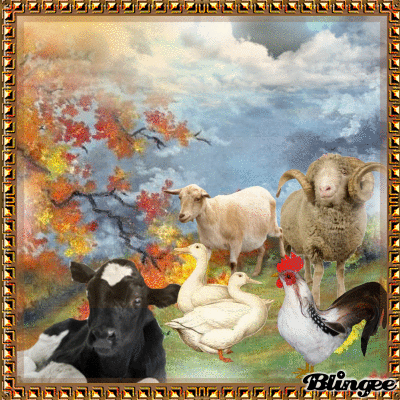
Im Herbst, wenn der scharfe Wind bläst, beginnt die Ziege, weil sie erfroren ist, sich auf der Weide zu schütteln, und schreit damit der Hirt nach Hause treibe, so laut sie kann: »Mich friert schon weh!« Der Widder, der noch nicht nach Hause mag, weil er einen warmen Pelz hat, geht um die Schafe herum, und antwortet der Ziege verdrießlich: »Noch liegt ja kein Schnee!«
Zur Kirchenweihe hat es das Flügelvieh gut; es bekommt Brocken von den Kuchen und manchmal auch eine Handvoll Korn. Das gefällt dem Hahn, er schlägt mit den Flügeln, streckt den Hals und fragt: »Wie lange noch schmausen wir so froh?« Der Gänserich, der im Hof herum wackelt, antwortet ihm: »eine Woche lang, eine Woche lang,« und der Enterich stimmt ihm bei: »Sieben Tage, sieben Tage.«
Aber das abgespänte Kalb im Stalle, das kein Futter bekommt, weil die Magd ins Wirtshaus zur Musik ist, und sich dort verspätet hat, und das nun hört, wie lang noch die Kirchweihe währen soll, das klagt erbärmlich. »Muh, muh! Hu, hu!«
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
DIE DREI WUNDERFISCHE ...
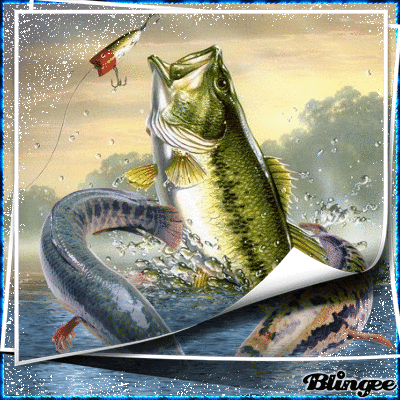
Ein Fischer, welcher schon viele Tage hindurch nichts gefangen hatte, machte sich abermals zum See auf, um die Netze auszuwerfen. Er hatte zwar wenig Hoffnung, allein er mußte es versuchen, denn Weib und Kinder schrien nach Brot.
Der Fischer warf das Netz ins Wasser, und als er das selbe herauszog, lag ein Stein darin. Zum zweiten Mal zog der Fischer einen ersäuften Eber hervor; dann warf er das dritte Mal das Netz hinein, und als er das selbe herausholte, siehe, da lag in dem Netz ein kleines Kästchen.
Der Fischer nahm das Kästchen heraus und öffnete es. Aber wie erschrak er, als aus dem Kästchen ein Riese heraus stieg und zum Fischer sprach: "Dafür, daß du mich ans Tageslicht gebracht hast, empfange deinen Lohn: Ich befehle dir, jetzt selbst in das Kästchen zu steigen, wenn nicht, so bist du des Todes."
Der Fischer jammerte und sprach: "Aber wie soll ich denn in diesem kleinen Kästchen Platz finden?" Der Riese wollte dem Fischer zeigen, daß darinnen genug Raum sei, und stieg wieder in das Kästchen. Kaum war der Riese drinnen, so schloß der Fischer schnell das Kästchen und wollte es in den See werfen. Der Riese bat, er solle dieses nicht früher tun, als bis er ihm ein Geheimnis anvertraut habe.
Der Fischer gewährte ihm diese Bitte, und der Riese sprach: "Ich bin der Geist des Sohnes deines Königs. Mein Vater warf mich in diesen See, weil ich ein großer Sünder gewesen bin, ich hatte nämlich den Menschen nur immer Böses zugefügt, ja viele Rechtschaffene ermordet. Ich sollte nach dem Ausspruch meines Vaters nur dann Ruhe finden, wenn ich gegen jenen, welcher mich auffindet, mich wohl tätig erweise, und das will ich denn tun. Höre: Nicht weit von hier findest du einen Teich, in diesen wirf dein Netz, und du wirst jeden Tag einen Fisch fangen. Diesen trage an den königlichen Hof, und du bekommst für jeden solchen Fisch einen Dukaten."
Wie der Geist gesagt, so ist auch alles geschehen. Der Fischer fand wirklich den Teich, warf sein Netz ins Wasser und fing einen wunderschönen Fisch. Diesen trug er in das Schloß des Königs. Als die Köchin den prächtigen Fisch erblickte, gefiel er ihr sehr, und sie gab dem Fischer den verlangten Dukaten dafür; und sie glaubte dem König heute etwas Besonderes vor zu setzen.
Die Köchin legte den Fisch in die Pfanne und wollte ihn backen, aber kaum war er über dem Feuer, so sprach er: "Solange ihr Gutes tut, so lang wird es euch gut gehen, sobald ihr aber Böses tut, wird es euch schlimm gehen." Und hierauf flog er durch den Rauchfang fort. Als am zweiten Tag der Fischer mit einem ebenso schönen Fisch kam, kaufte die Köchin abermals den Fisch, aber es ereignete sich das selbe wie mit dem ersten Fisch. Dieses wurde dem König hinterbracht, und am dritten Tag war er selbst bei der Bereitung des Fisches zu gegen, und es geschah das selbe.
Der König ließ den Fischer holen. Als dieser kam, erzählte er alles vom Anfang bis zum Ende, was er von dem Geist wußte. Der König hatte eine große Freude daran, daß sein Sohn sich gebessert hatte. Den Fischer nahm er mit seiner ganzen Familie ins Schloß und ließ es ihnen an nichts fehlen.
Quelle: Märchen aus Böhmen
DER SCHWARZE VOGEL ...
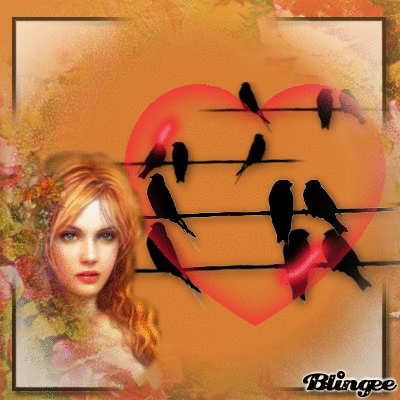
Ein Mann hatte zwölf Söhne und eine sehr schöne Tochter. Diese war das Herzkind ihrer Mutter, während die Söhne sehr streng von ihr behandelt wurden. Deshalb beschlossen die Söhne ihre Eltern zu verlassen und in der Fremde ihr Glück zu suchen. Sie wußten, daß ihr Vater sie nicht fort lassen würde, und hielten daher ihren Plan geheim. Sie sparten einiges Reisegeld und warteten nur auf eine schickliche Gelegenheit, um aus dem elterlichen Haus zu entfliehen.
Eines Tages besuchten die Eltern mit der Schwester einen Jahrmarkt, von dem sie erst nach zwei Tagen zurück kehren konnten. Kaum hatten die zwölf Brüder dies erfahren, so rafften sie ihre Habseligkeiten zusammen, und wenige Stunden nach Abreise ihrer Eltern kehrten auch sie dem väterlichen Haus den Rücken. Sie setzten ihre Reise bis spät in die Nacht fort und waren schon eine ziemliche Strecke gegangen, als es ihnen an Lebensmitteln mangelte. Sie sahen um her, allein nirgends gewahrten sie eine gastfreundliche Hütte.
Immer schneller eilten sie jetzt weiter und kamen an einen Wald, durch den nur ein sehr schmaler Weg führte. Der Hunger trieb ihre Füße an, und sie gelangten nach einer halben Stunde an das andere Ende des Waldes. Hier erblickten sie eine kleine Hütte. Fröhlich eilten sie auf diese zu und klopften an die verschlossene Tür, doch nichts regte sich. Sie klopften immer stärker und stärker, und endlich wich die Tür ihrer Gewalt. Sie traten in das Innere des Häuschens und fanden auch hier nichts, was darauf schließen ließ, daß es bewohnt sei.
Überall lag Staub und Moder, und Spinnen hatten mit ihren Netzen die Wände überzogen. Sie machten eine zweite Tür auf, welche sie in ein geräumiges Gemach führte, das allen Anzeichen nach als Wohnzimmer gedient haben mochte. Aus dieser Stube führte eine andere Tür in ein kleines Gemach; und als sie dieses betraten, sahen sie einen Greis, der auf einem Stuhl saß und mit dem Kopf auf dem Tische ruhte. Die Brüder glaubten, es sei der Hausherr, und wollten sich aus Ehrfurcht vor seinem grauen Haupt zurück ziehen. Als aber der jüngste an den Stuhl stieß, an dem der vermeintliche Hausherr saß, zerfiel dieser zu Staub.
Vor Schrecken sanken die zwölf Brüder zu Boden, und es bedurfte geraumer Zeit, ehe sie sich wieder erholten. Hierauf machten sie ein Grab und begruben die Asche des Greises. Da keine anderen Erben da waren, so nahmen sie das Haus in Besitz und reinigten es sorgfältig. Sie durchsuchten es dann näher und fanden noch manches, was die Zeit nicht verwüstet hatte und das ihnen gute Dienste leistete. In dem Tisch, auf welchem der Greis geruht hatte, fanden sie einige Geldrollen, womit sie sich längere Zeit Lebensmittel kaufen konnten.
Einige Tage später sahen sie sich in der Gegend um und entdeckten eine Stunde von ihrer Wohnung entfernt ein Bergwerk, in dem man Arbeiter brauchte. Die Brüder wurden einig, daß immer elf von ihnen hier arbeiten sollten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, während der zwölfte für die übrigen kochen und die anderen häuslichen Arbeiten verrichten sollte.
So war ein Jahr verflossen, als es ihrer Schwester zu Hause auch nicht mehr gefiel, denn was früher die Brüder von ihrer Mutter zu ertragen hatten, mußte jetzt die Schwester vom Vater erdulden. Sie wurde von diesem wie die gemeinste Magd behandelt, weil er glaubte, sie habe um das Vorhaben ihrer Brüder gewußt. Sie beschloß daher, ihre geliebten Brüder auf zu suchen, und bat Gott Tag und Nacht, er möchte ihr den Weg zeigen, der zu ihren Brüdern führe.
Eines Tages schickte sie ihr Vater in eine vier Stunden entfernte Stadt. Sie nahm heimlich ihre Sachen mit und kehrte nicht mehr zurück. Auf Gott vertrauend ließ sie jene Stadt seitwärts liegen und ging weiter, ohne zu wissen, wohin sie ihre Schritte wenden sollte. Fragte sie jemand, der ihr begegnete, wohin sie gehe, so antwortete sie: "Zu meinen Brüdern." Sonst erfuhr man von ihr nichts, und man glaubte, sie sei nicht recht bei Sinnen.
Schon hatte sie einen vollen Tag nichts gegessen und nichts getrunken, als sie bei einer Hütte ankam. Hungernd und dürstend klopfte sie an die Tür des einzeln stehenden Hauses. Das war die Hütte ihrer Brüder. Kaum hatte der älteste Bruder, welcher heute die häuslichen Arbeiten verrichtete, das schüchterne Klopfen gehört, als er auch schon hinaus eilte. Die Schwester bat mit niedergeschlagenen Augen um einen Trank Wasser und um ein Stückchen Brot.
Der Bruder aber ließ sie nicht ausreden, sondern schloß sie vor Freude weinend in seine Arme. Erst jetzt erhob die verschämte Bettlerin ihre Augen und erkannte ihren Bruder. Dieser führte sie in das Haus und gab ihr zu essen und zu trinken. Sie hatten sich so viel zu erzählen, daß die Stunde der Heimkehr der übrigen Brüder unbemerkt heran rückte. Sie kamen und staunten, als sie durch das Fenster ihren Bruder mit einem Mädchen erblickten. Doch als sie in die Stube traten und die Schwester erkannten, ging das Staunen in Freude über. Sie begrüßten einander und erzählten, was sie erlebt hatten.
Am anderen Morgen gingen auf Bitten der Schwester alle zwölf an die Arbeit. Sie aber blieb zu Hause und besorgte die Wirtschaft. Die Sonne war bereits untergegangen, da öffnete sie das Fenster, um die Brüder schon aus der Ferne kommen zu sehen, damit sie ihnen entgegen eilen könnte. Als sie am Fenster saß, kam ein kleiner schwarzer Vogel daher geflogen, der sich auf ihre rechte Hand setzte und ihr einige Tropfen Blut aus sog. Das Mädchen freute sich über den zahmen Vogel und wollte ihn fangen, allein er flog davon. Bald darauf kamen ihre Brüder, welchen sie jedoch nichts von dem Vogel sagte.
So oft sie nach diesem Tag das Fenster öffnete, kam der Vogel und sog ihr eine immer größere Menge Blut aus der Hand; doch so oft sie die Hand nach ihm ausstreckte, flog er davon. Der große Blutverlust wirkte nachteilig auf sie ein, sie wurde immer matter und matter, verlor die gesunde Gesichtsfarbe und das Feuer der Augen. Dies konnte ihren Brüdern unmöglich lange verborgen bleiben. Sie fragten ihre Schwester mitleidig um die Ursache dieser Veränderung, und sie erzählte ihnen nun die Geschichte mit dem Vogel. Die Brüder nahmen sich vor, den Vogel zu töten, und richteten Fallen auf.
Am folgenden Tag mußte einer der Brüder zu Hause bleiben. Der Vogel erschien am Fenster und fing sich in der Falle. Kaum war der kleine Näscher gefangen, so tötete ihn der Bruder und vergrub ihn im Garten. Nach einiger Zeit wuchs auf dem Grab des Vogels ein Apfelbaum, welcher bald zwölf sehr schöne Äpfel trug. Um den Brüdern eine Freude zu machen, pflückte die Schwester die selben und setzte sie ihnen vor.
Die Brüder, welche schon seit der Entfernung aus dem elterlichen Haus keine Äpfel gegessen hatten, griffen freudig nach den schönen Früchten und aßen sie. Doch als sie die selben genossen hatten, schrumpften ihre Glieder zusammen, und sie wurden in solche Vögel verwandelt, wie der war, welcher unter dem Apfelbaum begraben lag. Das Fenster, bei dem der schwarze Vogel gefangen worden war, stand offen, und sie flogen durch das selbe ins Freie.
Von der Zeit an saß die Schwester Tage lang weinend am offenen Fenster, in dem sie sich als die Urheberin dieses Unglücks anklagte. Da flogen die zwölf schwarzen Vögel herbei, und einer sprach: "Du kannst uns erlösen, wenn du von heute an durch zwei Jahre kein Wort über deine Lippen bringst." Sie versprach es zu tun, und unter wehmütigem Gesang erhoben sich die Brüder in die Luft, gleichsam als wollten sie damit ihrer Schwester Lebewohl sagen. Die Schwester verließ nun das Haus, in welchem sie mit ihren Brüdern so viele glückliche Tage verlebt hatte.
An einem heißen Junitag kam sie in eine wüste Gegend, furchtbar quälte sie der Durst, und nirgends war eine frische Quelle, nirgends eine gastliche Hütte, nirgends ein Baum oder Strauch zu sehen. Ermattet sank sie auf die Erde und blieb bewußtlos liegen. Wie sie wieder die Augen aufschlug, sah sie einen stattlichen jungen, vornehmen Mann und einen Bedienten beschäftigt, sie wieder ins Leben zurück zu rufen.
Als sie die Augen aufschlug, hörte man von den Fremden einen Freudenruf. In Eile wurde im Wagen ein Lagerplatz für die Kranke bereitet, und man fuhr sorgfältig in die nächste Stadt. Hier erholte sich das Mädchen bald wieder, und der Vornehme, der ein Graf war, wich nicht mehr von ihrer Seite. Auf alle Fragen des Grafen hatte das Mädchen nur mit Zeichen geantwortet, getreu dem Versprechen, welches sie ihren Brüdern gegeben hatte; daher glaubte der Graf, sie sei stumm. Dennoch gewann er sie lieb und vermählte sich mit ihr.
Bald hatte sich die stumme Gräfin, wie man sie nannte, die Liebe aller Untergebenen erworben, denn kein Bittender ging unbeschenkt von dannen. Aber die Liebe ihrer Schwiegermutter konnte sie sich nicht erwerben, ungeachtet sie dieser alles tat, was sie ihr nur Gutes und Liebes erweisen konnte. Die Mutter des Grafen war eine stolze Frau und konnte es ihrem Sohn nie vergeben, daß er sich, wie sie sagte, "eine auf der Straße gefundene Betteldirne" zur Gemahlin erwählt habe. Überall, wo sie Verachtung gegen des Grafen Gemahlin zeigen konnte, tat sie es mit sichtbarer Freude.
Achtzehn Monate waren sie verehelicht, da brach ein Krieg aus, und der Graf mußte seinem König zu Hilfe ziehen. Hart war der Abschied für den Grafen, aber härter noch war er für die Gräfin, welche ihrem Gatten nicht einmal ein lautes Lebewohl sagen durfte, weil sie ihre Brüder erlösen wollte. Zwei Monate nach diesem traurigen Abschied gebar die Gräfin zwei sehr schöne Knaben. Ihre Schwiegermutter legte nun ihren Haß gegen die Gräfin auf eine entsetzliche Weise an den Tag. Sie gewann durch Schmeicheln und Geld einen Freund des Grafen für sich, sie beredete ihn, er möchte dem Grafen schreiben, seine Gemahlin habe ihm zwei Hunde geboren. Das geschah.
Die Grafenmutter übergab den Brief einem ihr ergebenen Boten, welcher dem Grafen das selbe aussagte, was im Briefe stand. Der jähzornige Graf gab so gleich den Befehl, daß die Gräfin sterben müsse. Mit diesem Todesurteil eilte der Bote schnell zurück. Als er auf der Burg anlangte, erwartete ihn schon die Schwiegermutter der Gräfin und las freudig das Urteil. Sie selbst überbrachte es der Schwiegertochter, die den Brief ruhig und gefaßt durch las.
Zum Vollstrecker des Urteils war der Bote ernannt. Dieser führte die Gräfin des Nachts in einen Wald, und schon zuckte er das Messer auf das Opfer des Hasses, als plötzlich mehrere Stimmen über ihm riefen: "Halt ein!" Erschrocken ließ er das Messer fallen und wandte sich um. Aber er sah niemanden als zwölf Vögel, welche auf ihn zugeflogen kamen. Sie ließen sich vor ihm auf die Erde nieder und verwandelten sich zum Schrecken des Mörders in zwölf Jünglinge.
So hatte die Schwester ihre Brüder erlöst, denn eben war es zwei Jahre seit ihrer Verwandlung, und ihre Schwester hatte selbst in der Todesgefahr kein Wort gesprochen. Dafür wurde sie nun auch von ihren Brüdern gerettet. Diese nahmen den Boten gefangen und führten ihn in das Schloß zurück. Der Graf war so eben angekommen, denn die Vögel hatten ihn von der Unschuld der Gräfin unterrichtet.
Er eilte auf sie zu und bat sie um Verzeihung, und statt aller Antwort schloß sie ihn in ihre Arme. Nun wurden der gedingte Bote und die Grafenmutter von dem Grafen zum Tode verurteilt und konnten selbst durch die Bitten der Gräfin nicht gerettet werden, denn der Graf blieb unerbittlich. Der Freund des Grafen kam mit einer Gefängnisstrafe davon; die Brüder aber blieben bei ihrem Schwager.
DIE WALDFRAU ...

Lieschen war noch ein ganz junges Mädchen. Ihre Mutter war eine Witwe, und besaß nicht mehr, als eine armselige Hütte und zwei Ziegen, aber Lieschen war doch immer frohen Mutes. Vom Frühling bis zum Herbst weidete sie die Ziegen beim Birkenwald. Wenn sie aus dem Hause ging, steckte ihr die Mutter ein Stück Brot in die Tragtasche, und dazu eine Spindel, in dem sie ihr befahl: »Sei fein fleißig!« Weil sie keinen Spinnrocken hatte, schlang sie ihr den Flachs um den Kopf. Lieschen nahm die Tasche, und hüpfte fröhlich singend hinter den Ziegen zum Birkenwald.
Wenn sie hin kamen, gingen die Ziegen weiden; Lieschen setzte sich unter einen Baum, zog mit der Linken die Fäden vom Kopf, der ihr als Spinnrocken diente, und mit der Rechten drehte sie die Spindel, daß diese lustig an dem Boden hin schnurrte. Dabei sang sie, daß der Wald erscholl. Stand die Sonne im Mittag, so legte sie die Spindel bei Seite, rief die Ziegen, gab ihnen vom Brot, damit sie ihr nicht weg liefen, und hüpfte in den Wald, um Erdbeeren oder anderes Obst zu suchen, wie es eben an der Zeit war, um ein Gericht zum Brot zu haben. Hatte sie gegessen, so tanzte sie, indem sie die Hände übereinander legte. Die Sonne lachte dann durch die grünen Bäume nieder, und die Ziegen machten es sich im Grase bequem und dachten: »Wir haben doch eine fröhliche Hirtin!« Nach dem Tanze spann sie wieder fleißig, und wenn sie Abends nach Hause kam, brauchte die Mutter niemals zu schelten, daß die Spindel nicht voll sei.
Einst als sie ihrer Gewohnheit gemäß eben zur Mittagszeit sich nach dem einfachen Mahl zum Tanz anschickte, stand plötzlich eine wunderschöne Frau vor ihr. Sie hatte ein weißes Gewand, dünn wie ein Spinnengewebe; von dem Haupt bis zum Gürtel flossen ihr goldene Haare herab, und auf dem Haupt trug sie einen Kranz von Waldblumen. Lieschen erschrak. Die Frau lächelte sie an, und sprach mit lieblicher Stimme zu ihr: »Lieschen, tanzt du gern?« Als die Frau so freundlich zu ihr sprach, wich Lieschens Schrecken, und sie erwiderte: »O ich möchte den ganzen Tag tanzen!« »Komm denn, tanzen wir mit einander, ich will es dich lehren,« sprach die Frau, schürzte das Gewand, faßte Lieschen und begann mit ihr zu tanzen.
Als sie sich im Kreise zu drehen anfingen, ließ sich über ihnen eine so süße Musik hören, daß Lieschens Herz in Wonne schmolz. Die Spielleute saßen auf den Zweigen der Birken in schwarzen, aschgrauen, braunen und bunten Röckchen. Es war ein Chor von auserlesenen Spielleuten, der sich auf den Wink der schönen Frau versammelt hatte: Nachtigallen, Lerchen, Finken, Stieglitze, Grünlinge, Drosseln, Amseln und die kunstreiche Grasmücke. Lieschens Wangen glühten, ihre Augen strahlten, sie vergaß ihrer Aufgabe und ihrer Ziegen, und schaute nur auf ihre Gefährtin, die sich vor ihr, um sie in den reizendsten Bewegungen drehte und so leicht, daß sich das Gras unter ihren zarten Füßen gar nicht beugte. Sie tanzten vom Mittag bis zum Abend, Lieschens Füße ermüdeten nicht und taten ihr nicht weh.
Da hielt die schöne Frau inne, die Musik schwieg - und wie die Frau gekommen, so verschwand sie. Lieschen blickte um sich, die Sonne neigte sich hinter den Wald - und Lieschen schlug die Hände über dem Kopf zusammen, und in dem sie an den ungesponnenen Flachs griff, gedachte sie der Spindel, die auf dem Boden lag und nicht voll war. Sie nahm den Flachs vom Kopfe, steckte ihn samt der Spindel in die Tasche, rief die Ziegen und trieb sie nach Hause.
Sie sang auf dem Weg nicht, sondern machte sich bittere Vorwürfe, daß sie sich von der schönen Frau hatte berücken lassen, und nahm sich vor, wenn die Frau wieder zu ihr käme, ihr nicht mehr zu folgen. Die Ziegen, die keinen fröhlichen Gesang hinter sich hörten, sahen sich um, ob ihre Herrin wirklich nach schreite. Auch die Mutter wunderte sich, und fragte die Tochter, ob sie krank sei, da sie nicht singe. »Nein, Mütterchen, ich bin nicht krank. Der Hals ist mir vom Singen trocken geworden, darum singe ich nicht,« entschuldigte sich Lieschen, und ging, die Spindel und den ungesponnenen Flachs zu bewahren. Sie wußte, daß die Mutter das Garn nicht so gleich auf weife, und wollte am folgenden Tag einbringen, was sie an dem einen versäumt hatte, und darum erwähnte sie gegen die Mutter nicht das Mindeste von der schönen Frau.
Des anderen Tags trieb Lieschen die Ziegen, wie gewöhnlich, zum Birkenwald. Die Ziegen begannen zu weiden, und sie setzte sich unter einen Baum, und begann fleißig zu spinnen und zu singen; denn beim Singen geht die Arbeit besser von Statten. Die Sonne stand im Mittag. Lieschen gab den Ziegen vom Brote, hüpfte fort, um Erdbeeren im Walde zu suchen, und dann begann sie zu Mittag zu schmausen und mit den Ziegen zu sprechen. »Ach, meine Ziegen, heute darf ich nicht tanzen!« seufzte sie, als sie nach dem Mahl die Brosamen im Schoß zusammen scharrte, und auf einen Stein legte, damit sie die Vögel für sich davon trügen.
»Und warum dürftest Du nicht?« ließ sich eine liebliche Stimme hören, und die schöne Frau stand vor ihr, als wäre sie aus den Wolken gefallen. Lieschen erschrak noch mehr, als das erste Mal, und drückte die Augen zu, um die Frau gar nicht zu sehen; als aber die Frau die Frage wiederholte, antwortete sie schüchtern: »Ach verzeiht, schöne Frau, ich kann nicht mit euch tanzen! Ich würde meine Aufgabe nicht spinnen, und die Mutter würde mich schelten. Ehe heut die Sonne untergeht, muß ich einbringen, was ich gestern versäumt.« -
»Komm nur tanzen; ehe die Sonne untergeht, wird dir geholfen,« sprach die Frau, schürzte das Gewand und faßte Lieschen. Die Spielleute auf den Birken fingen an zu musizieren und die Tänzerinnen drehten sich im Kreise. Und die schöne Frau tanzte noch reizender, Lieschen konnte die Augen nicht von ihr wenden, und vergaß der Ziegen und ihrer Aufgabe. Jetzt hielt sie inne, die Musik schwieg, die Sonne ging unter. Lieschen schlug die Hände über dem Kopf zusammen, um den der ungesponnene Flachs geschlungen war und brach in Tränen aus. Die schöne Frau langte nach ihrem Kopf, nahm den Flachs herab, schlang ihn um einen Birkenstamm, ergriff die Spindel und begann zu spinnen. Die Spindel schnurrte an dem Boden hin und ward sichtlich voller, und ehe die Sonne hinter dem Walde nieder sank, war aller Flachs gesponnen, auch der vom vorigen Tage.
In dem sie dem Mädchen die volle Spindel reichte, sprach die schöne Frau: »Weife auf und murre nicht! Denke meiner Worte: Weife auf und murre nicht!« Hierauf verschwand sie, als hätte sie die Erde verschlungen. Lieschen war zufrieden, und dachte unterwegs bei sich: »Wenn sie so gut ist, will ich wieder mit ihr tanzen, so bald sie kommt.« Sie sang wieder, damit die Ziegen munter vorwärts schritten. Die Mutter aber empfing sie verdrießlich; sie hatte während des Tages das Garn aufweifen wollen und gefunden, daß die eine Spindel nicht voll geworden, und darum war sie verdrießlich. »Was tatest du, Tochter, daß du gestern nicht deine ganze Aufgabe spannst?« sagte sie tadelnd. - »Verzeiht, Mutter, ich tanzte ein wenig.« erwiderte Lieschen demütig, und indem sie der Mutter die Spindel zeigte, setzte sie hinzu: »Heut ist sie dafür übervoll.«
Die Mutter schwieg, ging die Ziegen melken, und Lieschen legte die Spindel an ihren Ort. Sie wollte der Mutter ihr Abenteuer erzählen, allein sie dachte: »Nein, bis die Frau noch einmal kommt, will ich sie fragen, wer sie ist, und dann sage ich es der Mutter.« So dachte sie und schwieg. Des dritten Morgens trieb sie die Ziegen, wie gewöhnlich, zum Birkenwald; die Ziegen begannen zu weiden, und Lieschen, unter einem Baum sitzend, zu singen und zu spinnen. Die Sonne stand im Mittag; Lieschen legte die Spindel ins Gras, gab den Ziegen vom Brote, suchte keine Erdbeeren, und in dem sie die Brosamen den Vöglein hinwarf, sagte sie: »Liebe Ziegen, heute will ich euch eins vortanzen!«
Sie hüpfte, legte die Hände übereinander, und schon wollte sie versuchen, ob sie auch so reizend tanzen könne, als die schöne Frau, da stand diese vor ihr. »Laß uns miteinander tanzen!« sprach sie lächelnd zu Lieschen, und umfaßte sie. Augenblicklich erklang die Musik über ihren Häuptern, und die Tänzerinnen drehten sich in leichtem Fluge. Lieschen vergaß die Spindel und die Ziegen, sah nichts als die schöne Frau, deren Leib sich wie ein Weidenzweig nach allen Seiten bog, und hörte nichts als die liebliche Musik, nach deren Klängen ihre Füße von selbst sprangen.
Sie tanzten vom Mittag bis zum Abend. Jetzt hielt die Frau inne und die Musik schwieg. Lieschen blickte um sich, die Sonne war hinter dem Walde. Weinend schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen und in dem sie sich zur Spindel wandte, die nicht voll war, weh klagte sie, was die Mutter sagen würde. »Gib mir deine Tasche, ich will dir ersetzen, was du heute versäumt,« sprach die schöne Frau. Lieschen gab ihr die Tasche, und die Frau ward auf einige Augenblicke unsichtbar; dann aber reichte sie ihr die Tasche mit den Worten: »Da, zu Hause sieh hinein!« und verschwand, als hätte sie der Wind davon geweht.
Lieschen fürchtete sich in die Tasche zu sehen, allein auf der Hälfte des Weges ließ es ihr doch keine Ruhe; die Tasche war so leicht, als ob nichts in ihr wäre; sie mußte hinein sehen, ob sie die Frau nicht getäuscht. Wie erschrak sie, als sie sah, die Tasche sei voll - Birkenlaub. Da brach sie erst in Tränen aus und machte sich Vorwürfe, daß sie so leicht gläubig gewesen. In ihrer Aufwallung warf sie die Blätter mit beiden Händen heraus und wollte die Tasche umstürzen; dann aber dachte sie: »Ich will das Übrige den Ziegen unterstreuen,« und ließ einiges Laub darin. Sie fürchtete sich, nach Hause zu gehen. Die Ziegen konnten ihre Herrin wieder nicht erkennen.
Die Mutter harrte bekümmert auf der Schwelle. »Um Gottes willen, was für eine Spindel Garn brachtest du gestern nach Hause?« waren die ersten Worte der Mutter. - »Warum denn?« fragte Lieschen ängstlich. - »Als du Morgens fort gegangen, begann ich auf zu weifen. Ich weife auf, weife auf, die Spindel ist beständig voll. Eine Strähne, zwei, drei Strähnen - die Spindel voll. Welcher böse Geist hat das gesponnen! rufe ich erzürnt, und in dem Augenblicke ist das Garn von der Spindel fort, als wäre es weg geblasen. Sage mir, was das ist?«
Da gestand Lieschen und begann von der schönen Frau zu erzählen. »Das war eine Waldfrau!« rief die Mutter entsetzt. »Um Mittag und Mitternacht treiben sie ihr Wesen. Ein Glück, daß du kein Knabe bist, sonst würdest du nicht lebendig aus ihren Armen entkommen sein. Sie hätte so lange mit dir getanzt, als ein Atemzug in dir gewesen wäre, oder sie hätte dich zu Tode gekitzelt. Doch mit Mädchen haben sie Erbarmen, ja beschenken sie oft reich. Hättest du mir etwas gesagt, so würde ich nicht gemurrt haben, und hätte jetzt die ganze Stube voll Garn.«
Da dachte Lieschen der Tasche und ihr fiel ein, es könnte doch vielleicht etwas unter dem Laube sein. Sie nimmt die Spindel von oben weg und den ungesponnenen Flachs, und blickt in die Tasche, blickt noch einmal hinein und schreit: »Seht, Mutter, seht!« Die Mutter blickt hinein und schlägt die Hände über dem Kopfe zusammen. Die Birkenblätter hatten sich in Gold verwandelt. »Sie befahl mir, erst zu Hause hinein zu blicken, ich gehorchte nicht.« - »Ein Glück, daß du nicht die ganze Tasche ausgeleert!« meinte die Mutter. Des Morgens ging sie selbst, um an der Stelle nach zu sehen, wo Lieschen das Laub mit beiden Händen weg geworfen; allein auf dem Wege lag nur frisches Birkenlaub. Doch der Reichtum, den Lieschen nach Hause gebracht, war ohne hin groß genug.
Die Mutter kaufte eine Wirtschaft und sie hatten viel Vieh. Lieschen ging in schöner Kleidung, sie mußte nicht mehr Ziegen weiden; allein wie reich und froh und glücklich sie war, nichts machte ihr so viel Vergnügen, als der Tanz - mit der Waldfrau. Noch oftmals ging sie in den Birkenwald, es lockte sie hin, sie wünschte sich, die schöne Frau noch einmal zu sehen - allein sie erblickte sie nimmer wieder.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
DIE TEUFELSFELSEN ...

Reist man von Klobouk nach Wsetin, so kommt man in das Dorf Lidecko, das in einem angenehmen Tal liegt. Zu beiden Seiten steigen hohe Hügel empor, und neben dem Talweg eilt murmelnd ein Bach nach Wsetin. Hinter Lidecko, erblickt man links auf der Anhöhe große Steine, die in einer Reihe aufgehäuft, und von denen viele zwei Klafter hoch sind.
Diese Steine ziehen sich in gleicher Richtung mit dem Weg dahin; ähnlich finden sich auf der anderen Seite, auf der Anhöhe rechts, gleichfalls in einer Reihe, obwohl Zahl und Größe der Steine hier geringer ist. Es fällt jedem auf, daß es in der ganzen Umgegend, wenigstens so weit das Auge reicht, keine solche Steine gibt. Sind auch die Hügel hoch und mit Bäumen bewachsen, entgeutliche Felsen sieht man nirgend.
Weiter jedoch gibt es deren, und zwar Felsen, die verdienen, daß man sie betrachtet. Geht man nämlich über die Brücke, die über des Talbach gebaut ist, so führt ein Weg rechts nach waldigen Bergen zu Hirtenhütten. Auf diesem Wege kommt man an eine Stelle im Wald, wo die merkwürdigen Felsen stehen.
Mitten aus dem Wald erheben sie sich, wildschön, so sonderbar gestaltet, daß es scheint, als wüchsen aus den Felsen Menschenköpfe hervor, manchmal so nahe an einander, daß das Kinn des einen Kopfes, die Stirn und Nase des anderen bilden. Auch unter den Felsen links vom Wege ist gleich Anfangs einer mit Menschenkopf, aus dem ein Paar Hörner in die Höhe ragen. Woher die Felsen rühren, das will ich Euch erzählen.
Einst war im Wirtshaus zu Lidecko Musik. Damals musizierten sie noch mit Sackpfeife und Hackbrett, und fehlte auch gebranntes Wasser, so waren die Leute doch fröhlich. Als es auf Zwölf ging, trat ein unbekannter Gast in die Stube, und nachdem er den schwarzen Mantel abgelegt, in den er gehüllt gewesen, sah er eine Weile in der Stube umher.
Seine schwarzen Brauen über zwei funkelnden Augen und sein schwarzer Schnurrbart verlieh ihm ein stattliches Aussehen; die grüne Jacke und der Spitzhut mit der Feder ließen vermuten, daß er ein Waidmann sei. Nebst anderen Mädchen war auch Käthchen da, eine vaterlose Waise, die bloß eine alte Mutter hatte. Da sie ein hübsches kleines Haus, Acker und Wiese besaß, dabei fromm, eingezogen lebte und hübsch war, so hätte sie mancher Bursche gern geheiratet.
Auf Käthchen richtete jetzt der Unbekannte seine Blicke. Er machte sich an sie, schwatzte ihr beim Tanze wer weiß was alles vor, und da er sich stattlich ausnahm, vergaffte sie sich in ihn. Er versprach ihr auch, sie bald zu besuchen; doch sagte er, sein Geschäft, das eines Jägers, erlaubte ihm nur, um Mitternacht oder dann und wann um Mittag zu kommen. Dann nahm er seinen Mantel, warf den Musikanten einige Zwanziger hin, und entfernte sich kurz nach Mitternacht.
Der Unbekannte besuchte Käthchen wirklich. Er nannte sich Ladimil. Allein seine späten Besuche gefielen Käthchens Mutter nicht, die ihnen immer beiwohnte. Sie schöpfte Verdacht, weil sein Auge so unruhig umher rollte, weil er sich weder beim Kommen noch Gehen mit Weihwasser besprengte, und wenn sie mit Käthchen zum Abschied ihm Gottes Segen wünschte, immer wild davon schoß.
Es war einst wieder nach elf in der Nacht, als Ladimil erschien, und die Mutter um Käthchens Hand bat. Gegen eine halbe Stunde weigerte sich die Alte unter verschiedenen Ausflüchten; endlich, da er nicht aufhörte zu bitten, sprach sie zu ihm: »Nun gut, ich will Euch meine Tochter geben, aber bloß unter einer Bedingung. Erfüllt Ihr die nicht, und nicht in der Frist, die ich Euch bestimme, wird aus der Hochzeit nichts.«
Da erhob sich der Bräutigam vom Stuhl, als wollte er sagen: »Hier bin ich, rede! Ich erfülle, was Du begehrst.« Die Alte sprach also in der Absicht, die Hochzeit zu vereiteln: »Wenn Ihr noch heute Nacht eine Brücke über unser Tal wölbt von einer Anhöhe zur anderen, bekommt Ihr meine Tochter; wenn nicht, bekommt Ihr meine Tochter niemals!« »Es gilt die Wette!« versetzte der Bräutigam mit wildem Lachen, und eilte zur Türe hinaus.
Als er draußen war, stampfte er auf die Erde, daß das ganze Tal erzitterte und sieh! auf sein Stampfen erschien eine ungeheure Menge verkappter Gesellen, und alle stellten sich im Kreise um ihn her. Er befahl ihnen, sie sollten sich hurtig rings zerstreuen, und sämtliche Hähne in der Umgegend erwürgen, und wenn sie dies getan hätten, ihm zu Hilfe eilen und aus der nächsten Nähe Steine zum Bau einer Brücke zu tragen.
Sie flogen auseinander und erwürgten alle Hähne. Dies hatte der Höllenbräutigam - denn es war der Teufel selbst - zu dem Zwecke befohlen, damit kein Hahn krähe, bevor die Brücke nicht fertig wäre; denn die Hähne haben, wie bekannt, große Macht über den Teufel, und machen allen Streichen ein Ende, die er um Mitternacht auszuführen pflegt. Als die Hähne erwürgt waren, eilten die höllischen Gesellen ihrem Bruder zu Hilfe.
Weil sich aber keine Steine in der Nähe befanden, mußten sie erst zu jener Stelle im Walde; dort brachen sie Steine von riesiger Größe, und trugen sie Pfeil geschwind ihrem Kameraden zu, der mit unglaublicher Schnelligkeit Stein zu Stein fügte, auf den Hügeln zu beiden Seiten des Tals den Grund legte, und schon die Bogen zu wölben begann.
Allein in Lidecko lebte damals ein uraltes Mütterchen, das auch einen Hahn besaß. Weil es jedoch wußte, daß der schwarze Versucher gegen die Hähne gewaltig ergrimmt sei, seit dem ihm die Versuchung am heiligen Petrus mißlungen, fürchtete es sich, der Hahn könnte in des Teufels Krallen geraten, und es selbst könnte dessen Macht unterliegen; darum steckte es den Hahn immer unter einen Trog, an dem bewußten geheimen Ort, wo ihn kein Teufel suchen mochte. So geschah es, daß jener Hahn einzig und allein am Leben blieb, als die höllische Rotte auszog, um sämtliche Hähne in der Umgegend zu erwürgen.
Inzwischen rückte die zwölfte Stunde heran. Der Teufel hatte schon viele Bogen fertig, und sicher hätte er bis Eins die ganze Brücke zu Stande gebracht, und sich des armen, unschuldigen Käthchens bemeistert; doch da krähte auf einmal jener Hahn unter dem Trog an dem bewußten geheimen Ort, und sieh! augenblicklich stürzten die ungeheuren Felsen krachend nieder. Die Bogen, die sich bereits hoch in der Luft über das Tal wölbten, die Pfeiler, alles, alles brach donnernd zusammen.
Daher rühren die Felsen im Walde, die Steine auf den Höhen bei Lidecko - das sind die Überbleibsel jenes Brückenbaues! Der Teufel, der sich damals um Käthchen bewarb, ward Stein, zur Mahnung für alle Verführer, und sein Kopf mit Hörnern ist noch heutigen Tags zu schauen. Von seinen Gehilfen entkamen nur jene, die eben in der Luft schwebten; die übrigen, die in dem Walde Steine brachen, wurden gleichfalls Stein, und ihre Köpfe sind dort noch immer zu gewahren.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
DER HUND UND DIE AMMER ...

In einem Dorf wurde einst eine Hochzeit gehalten, bei welcher man gut schmauste. Der Hund des Bräutigams bekam aber nicht das mindeste und litt großen Hunger. Voll Verdruß ging er in den Garten, der zu dem Haus gehörte, legte sich dort nieder und knurrte.
Da kam eine wachsgelbe Ammer daher geflogen, setzte sich auf einen Baum und blickte auf den Hund herab, der eine traurige Miene machte. Als dies die Ammer bemerkte, flog sie näher zu dem Hund, und fragte ihn, warum er so traurig sei. Der Hund antwortete: "Warum soll ich nicht traurig sein? In unserem Haus ist eine Hochzeit, es wird viel gegessen und getrunken, und ich muß Hunger leiden."
"Mach dir nichts draus", sprach die Ammer, "du wirst schon etwas bekommen. Geh jetzt mit mir ins Haus, und wenn wir in das Vorhaus kommen, so werde ich mich auf die Erde nieder setzen, und diejenigen, welche Speisen aus der Küche in die Stube tragen, werden die Speisen nieder stellen und mich fangen wollen; und du mußt der weil sehen, wo du dich satt fressen kannst."
Beide machten sich auf den Weg, und als sie in dem Vorhaus waren, setzte sich die Ammer auf die Erde nieder. Zu gleicher Zeit trat der Speisenträger mit dem Braten in der Hand aus der Küche und wollte ihn in die Stube der Hochzeitsgäste tragen. Als er aber den gelben Vogel erblickte, stellte er den Teller mit dem Braten auf die Erde nieder, rief die übrigen herbei und sprach: "Schaut, ein schönes und zahmes Vögelchen eben, es kann nicht gut fliegen, fangen wir es!" Und das geschah; sie machten die Stubentür auf, trieben die Ammer hinein, machten die Tür wieder zu, trieben den Vogel hin und her und vergaßen ganz den Braten.
Das kam dem Hund sehr gelegen, er fraß sich unterdessen an dem Braten satt und ging wieder in den Garten. Als die Ammer in der Stube glaubte, daß der Hund genug habe, suchte sie eine Gelegenheit, um zu entwischen. Da erinnerte sich der Speisenträger des Bratens, den er im Vorhaus nieder gestellt hatte; er lief daher aus der Stube, und kaum hatte er die Tür auf gemacht, so war auch schon die Ammer wieder draußen und flog gerade nach dem Garten hin, wo sie den Hund antraf. "Nun", sprach sie zu ihm, "nicht wahr, jetzt bist du satt?"
"Ja, satt bin ich", antwortete der Hund, "aber Durst habe ich noch." "Durst?" fragte die Ammer. "Nun, da weiß ich wieder ein Mittel. Jetzt ist es Mittag", sprach sie, "und die Mägde in der Meierei melken gerade. Geh mit mir hin, und du wirst sicher Gelegenheit finden, wo du dich recht satt trinken kannst. Wir werden uns nämlich vor die Stalltür stellen und warten, bis die Mägde die frisch gemolkene Milch aus dem Stall tragen, dann werde ich mich wieder auf die Erde nieder setzen und mich so stellen, als wenn ich nicht fliegen könnte. Die Mägde werden die Gefäße nieder stellen und mir nach jagen; dadurch gewinnst du Zeit und kannst dich an der warmen Milch satt saufen." Das taten sie auch.
Sie gingen zum Meierhof und blieben bei der Stalltür stehen. Als nun die Mägde mit der Milch kamen, da hüpfte die Ammer her bei und flog auf ihr Geschrei nicht davon. Das fiel der einen auf, und sie sprach zu den übrigen: "Das Vöglein kann ja nicht fliegen! Fangen wir es und geben es dem Schaffner, er wird damit eine große Freude haben." Und wirklich, sie stellten die Milchtöpfe nieder und jagten dem Vogel nach, der nur immer so weit von ihnen entfernt blieb, um nicht gefangen zu werden. Nachdem der Hund mehrere Töpfe geleert hatte, flog die Ammer in die Höh, und die Mägde hatten sich umsonst geplagt; sie gingen wieder zu ihren Milchtöpfen und fluchten, als sie einige davon leer fanden.
Der gesättigte Hund schleppte sich nun fort, und die Ammer flog über ihm. Beide begaben sich zu dem nahen Wald, bei welchem eine Straße vorüber führte. Der Hund legte sich in den Schatten eines der Straße nahe stehenden Baumes auf die Erde nieder, und die Ammer setzte sich auf den Gipfel des selben Baumes, sang ihr Lied und fragte mitunter in neckischem Ton den Hund, ob er Hunger habe. Der Hund gab ihr aber keine Antwort.
Nach einer Weile führte auf dieser Straße ein schon bejahrter Mann ein Faß Bier auf einem Schubkarren. Dieses Bier gehörte zu dem Hochzeitsmahl. Als der Mann den Hund bemerkte, der, seine Füße ausstreckend, sich unter dem Baum wälzte, schlug er auf ihn los, bis er tot war.
Das schmerzte die Ammer sehr, und um sich an dem Mann zu rächen, setzte sie sich auf sein Faß und hüpfte spottend hin und her. Darüber erzürnt, wollte der Mann mit dem selben Stock auch den Vogel erschlagen. Die Ammer war aber geschwinder, flog davon, und der Mann traf so stark auf sein Bierfaß, daß es sogleich zersprang, und das Bier floß auf den Weg. Das hatte er für seine Grausamkeit.
Damit begnügte sich aber die Ammer nicht; denn sie drohte ihm, daß sie ihm einmal, wenn er ohne Kopfbedeckung aus seiner Stube ins Freie gehe, ein Nest in die Haare flechten wolle. Das erschreckte ihn, und er hütete sich, ohne Mütze die Stube zu verlassen.
Einmal traf es sich aber, daß er seine Mütze nicht finden konnte; und da er doch in seinen Garten gehen mußte, so sagte er zu seinem Weib: "Nimm diesen Stock, geh mit mir, und wenn sich der Vogel auf meinem Kopf nieder setzen will, dann schlage ihn tot!" Sein Weib nahm den Stock und ging mit ihm in den Garten. Und schon saß der Vogel auf dem Dach, einen Strohhalm in seinem Schnabel haltend.
Als ihn der Mann erblickte, rief er aus: "Weib, gib acht, der Vogel ist schon da." Auf sein Geschrei hob sein Weib den Stock in die Höhe, damit sie geschwind los schlagen könne. Im Nu flog die Ammer ihm auf den Kopf. Das Weib schlug wütend auf den Vogel los, traf aber daneben, und der Mann fiel zu Boden. Die Ammer flog auf und davon.
DIE REISE ZUR SONNE ...
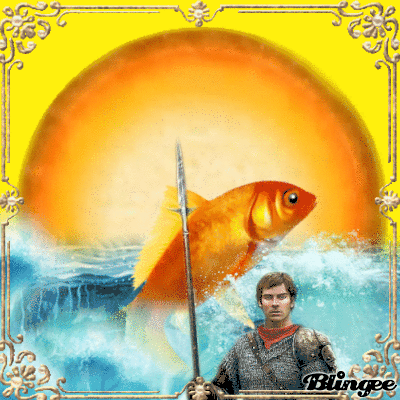
An einem Königshofe war einmal ein Küchenjunge. Aber wenn auch nur ein Küchenjunge, er wäre, hätte man ihm stattliche Kleider angelegt, unstreitig der schönste, beste Junge im ganzen Lande gewesen. Er wurde mit der Tochter des Königs bekannt, die um ein Jahr jünger war als er, und sie befreundeten sich so, daß von dieser Zeit an kein Tag verfloß, wo sich nicht die Prinzessin mit ihm in dem großen königlichen Garten unterhalten hätte.
Den Räten des Königs war dies nicht recht. Eine Prinzessin und ein Küchenjunge! Sie lagen dem alten König an, er solle ihn fort jagen lassen. Der alte König folgte seinen Räten, und befahl, ihn fort zu jagen. Allein die Prinzessin brach in Tränen aus, sobald sie ihn nur anrührten; denn sie hatte ihn sehr lieb, und wußte nicht, wie sie sich ohne ihn unterhalten könnte. »Ei was!« dachte der alte König »sie sind ja noch Kinder, mit der Zeit werden sie schon zu Verstand kommen!« und ließ alles beim Alten.
Es blieb also alles, wie es war; die Kinder spielten miteinander, und niemand durfte sie hindern. Allmählich hörten sie auf, Kinder zu sein; ihre Freundschaft aber dauerte fort, und wurde von Tag zu Tag inniger und fester. Die Prinzessin wuchs heran, sie war bereits heiratsfähig. Von allen Enden der Welt kamen Königssöhne herbei, um sie zu werben. Der königliche Palast erscholl von Musik und Becherklang des Weins und der köstlichen Speisen gab es in Hülle und Fülle. Die Prinzessin konnte zehn Königssöhne für einen haben; allein sie zog sich von ihnen zurück, sobald sie nur konnte, und eilte, sich mit ihrem Küchenjungen zu unterhalten. Und wenn sie der Vater fragte, wer ihr gefalle, wen sie zum Gemahl haben wolle, so antwortete sie immer, daß ihr der Küchenjunge am besten gefalle, daß sie keinen anderen zum Gemahl nehmen wolle.
Der alte König ärgerte sich gewaltig. So viele Königssöhne und ein Küchenjunge! Er berief seine Räte, damit sie ihm sagten, was er tun solle. Sie rieten ihm sogleich, er solle den Küchenjungen umbringen lassen. Allein dem guten König schien es unrecht, den unschuldigen Jungen gewaltsam umbringen zu lassen. »Erlauchter König,« sprach der weiseste der Räte, »scheint Dir das unrecht, so schicken wir ihn auf gute Art irgend wo hin daß er, wenn er auch hundert Jahre reist, nicht wieder kehren kann. Schicken wir ihn zur Sonne, daß er sie frage, warum sie Vormittags immer höher steigt, und alles mehr und mehr erwärmt, und warum sie Nachmittags immer niedriger sinkt, und alles minder und minder erwärmt!«
Dieser weise Rat gefiel dem König. »Wenigstens,« sprach er, »wird ihn meine Tochter vergessen, wenn sie ihn so lange nicht sieht.« Sie riefen sogleich den Küchenjungen, gaben ihm Geld auf den Weg, und schickten ihn zur Sonne, damit er Antwort auf die Frage brächte. Mit Tränen schied die Königstochter von ihrem Freund, mit schwerem Herzen begab er sich auf den Weg. Niemand wußte ihm Rat zu erteilen, niemand wußte ihm zu sagen, welchen Weg er nehmen solle. Allein ihm riet sein eigener Verstand; er ging nicht der Sonne entgegen, sondern der Sonne nach, gerade dorthin, wo sie nieder sinkt.
Er ging und ging durch öde Wälder, auf unwegsamen Pfaden, bis er nach langem Gehen in ein fremdes Land kam, wo ein mächtiger, aber blinder König herrschte. Als der König erfuhr, woher er komme, wohin er gehe, was er beabsichtigte, ließ er ihn sogleich vor seinen goldenen Thron rufen; denn er bedurfte guten Rates, welchen ihm niemand als die Sonne erteilen konnte. Der Gerufene kam. »Du gehst zur Sonne, mein Sohn?« - »So ist es in der Tat.« - »Nun, wenn du hin gehst, so frage die Sonne doch, warum ich, ein so mächtiger König, auf meine alten Tage erblindet bin. Vollführst du es, so gebe ich dir also gleich die Hälfte meines Königreichs.« Der Küchenjunge versprach es, erhielt Geld, und zog der Sonne weiter nach, über Berg und Thal, wo nichts zu hören und nichts zu sehen war, bis er zu einem Meer kam.
Das Meer war breit und tief. Er durfte weder rechts noch links, denn die Sonne sank gerade hinter dem Meere unter. Was sollte er tun? Er ging am Ufer sinnend hin und her. Als er so nach sann, kam ein großer Fisch zu ihm. Halb war er über dem Wasser, halb unter dem Wasser; sein Bauch war wie bei anderen Fischen, sein Rücken aber funkelte wie eine glühende Kohle, und das rührte von dem Glanz der Sonne. »Woher bist du?« fragte ihn der Fisch, »was machst du da? wohin gehst du?« - »Was ich mache? wohin ich gehe? Ich möchte gern auf die andere Seite, denn ich muß zur Sonne, sie zu befragen, und ich kann nicht hinüber.« - »Zur Sonne? Nun, du sollst hin gelangen, ich will dich hinüber tragen, wenn du sie fragst, woher es kommt, daß ich ein so großer Fisch, mich nicht auf den Grund des Wassers nieder lassen kann, wie die anderen Fische. Willst Du sie fragen?« - »Ich will« entgegnete der Küchenjunge, und schon saß er auf dem Rücken des Fisches, der ihn glücklich auf das andere Ufer hinüber trug. »Komm wieder hier her, ich will auf dich warten,« sagte der Fisch zu ihm, und er bejahte mit dem Haupte und verfolgte seinen Weg weiter durch fremde und wüste Gegenden, wo es keinen Vogel, noch weniger einen Menschen gab.
Schon war er nicht mehr weit vom Ende der Welt: da sah er die Sonne nah vor sich zur Erde sinken. Er eilte aus Leibeskräften, soviel er konnte. Als er hin kam, ruhte die Sonne eben im Schoße ihrer Mutter aus. Er verneigte sich und sie dankten ihm. Er begann zu reden und sie horchten auf. Er sagte: »Wie so kommt es, daß die Sonne Vormittags immer höher und höher steigt, und immer mehr wärmt, Nachmittags aber wieder nieder sinkend immer schwächer und schwächer wird?« Die Sonne sprach zu ihm: »Ei mein Lieber, sag doch deinem Herrn, warum er nach der Geburt immer mehr wächst an Leib und Kraft, und warum er sich im Alter zur Erde neigt und schwächer wird. Auch mit mir ist es so. Meine Mutter gebiert mich jedes Morgens neu als einen schönen Knaben, und jedes Abends begräbt sie mich als einen schwachen Greis.« Dann fragte der Küchenjunge weiter: »Warum ist jener mächtige König in seinem Alter erblindet, da er doch früher so gut sah?« - »Ha, warum er erblindet ist? Darum, weil er stolz wurde, darum, weil er sich Gott gleich stellen wollte und sich einen mit Sternen besäten Himmel aus Glas bauen ließ, damit er, so thronend, dem ganzen Lande Befehle gebe. Wenn er sich vor Gott demütigt und den gläsernen Himmel zertrümmern läßt, wird ihm das verlorene Augenlicht zurück kehren.« - »Und warum kann sich jener Fisch nicht, gleich den anderen Fischen, auf den Grund des Wassers nieder lassen?« - »Weil er noch kein Menschenfleisch gegessen. Doch sag ihm dies nicht früher, als bis du über dem Meere, ein gutes Stück vom Ufer bist!« - Hierauf nahm der Küchenjunge dankend Abschied. Aber die Sonne gab ihm außer gutem Rat noch ein Gewand, das bequem in eine Nußschale hinein ging; das war ein Sonnenkleid.
Er begab sich zurück und kam zum Meere. Sogleich begann der Fisch ihn nach der Antwort zu fragen; allein er wollte sie ihm nicht mit teilen, bevor ihn der Fisch nicht über das Meer geschafft hätte. Der Fisch nahm ihn also auf den Rücken und schwamm mit ihm, die Wellen durch schneidend. In der Mitte des Meeres fragte er ihn abermals, und drohte ihn ins Wasser zu werfen, wenn er ihm nicht die Antwort sage. »Drohe, wie du willst, ich sage dir die Antwort nicht früher, als bis wir drüben sind!« Und so sagte er dem Fisch nichts, als bis er am anderen Ufer war. Hier begann er zu laufen, und rief ihm während des Laufens das Geheimniß zu. Der Fisch geriet in Wut, als wäre der Satan in ihn gefahren. Er schlug das Meer mit seinem Schweife, daß das Wasser austrat, und dem Küchenjungen bis an den Gürtel reichte; doch war es schon zu spät, er war schon zu weit, der Fisch konnte in so seichtem Wasser nicht schwimmen, denn er war zu groß.
»Hat mich der Teufel jetzt nicht bekommen, bekommt er mich nimmer!« dachte der Küchenjunge, und zog fröhlich weiter, immer der Sonne entgegen, um den Weg nicht zu verfehlen. Nach langem Wandern gelangte er zu dem blinden König. - »Nun, hast du es vollführt? Weißt du, warum ich erblindet bin?« - »Darum bist du erblindet, weil du stolz wurdest, und dich Gott gleich stellen wolltest. Nur erst wenn du deinen gläsernen Himmel zertrümmerst, und dich vor Gott demütigst im Staube, wird dir dein Augenlicht als bald wieder kehren.!« Der König gehorchte, zertrümmerte seinen Himmel, demütigte sich im Staube, und so gleich sah er hell, als ob er aus dem Grabe an Gottes Sonnenlicht getreten wäre. Er schenkte dem Küchenjungen die Hälfte seines Königreichs.
Der Küchenjunge war nun König, wie ein anderer, doch säumte er keinen Augenblick, sondern eilte nach Hause. Und er tat wohl daran, denn kaum war er dort, so wurden die Glocken geläutet und die Kirchentüren angelweit geöffnet: »Was hat sich da zu getragen, was gibt es Neues?« fragte er die Leute. - »Die Königstochter heiratet, eben werden die Glocken zur Trauung geläutet!« Da überlegte er, was er tun solle. Er zog aus seinem Bündel die Nußschale, aus der Nußschale das Sonnenkleid, legte es an und setzte sich in die erste Bank am Altar. Nach einer Weile kamen im langen Zug die Hochzeitsgäste. Jeder blickt verwundert den reichen Gast in der ersten Bank an. Einer fragt flüsternd den anderen, wer das sei; aber niemand erkennt ihn, keiner weiß es. Es kommt auch die junge Braut. Sie fragt nicht, wer das in der ersten Bank sei, sie fliegt auf ihn zu, und ist nicht mehr von ihm zu trennen, will nichts von Trauung mit einem anderen wissen.
Als der alte König vernommen, was in der Kirche geschehen war, ließ er den Küchenjungen in seinem Sonnenkleid vor den Thron führen. Da erzählte der Küchenjunge vom Anfang bis zum Ende, wie es ihm ergangen ist. Als er zu Ende war, nahm er die junge Prinzessin, die ihn nun noch lieber hatte, als zuvor, bei der Hand, und gesegnet vom alten König, schritten sie zum Altar. Dann lebten sie als Ehepaar, und herrschten nach dem Tode des alten Königs glücklich bis ans Grab.
Slowakei: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
DER VERRÄTERISCHE DIENER ...
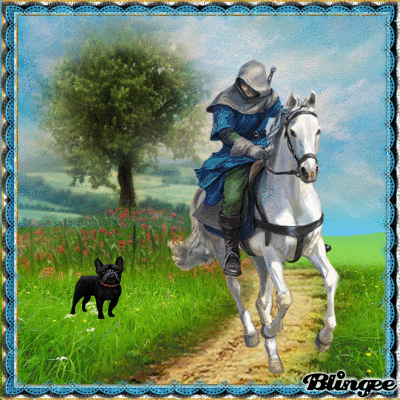
Es war ein sehr reicher und dabei höchst gütiger Herr, ein wahrer Wohltäter der Menschen. Wer bei ihm Hilfe suchte, wurde nie abgewiesen: seine Freude bestand darin, den Notdürftigen und Unglücklichen zu helfen. Er hatte keinen Erben, für den er hätte Reichtümer sammeln können, und so verwendete er all sein Geld zu guten Werken.
Ein solches gutes Werk, und zwar nicht das letzte, war auch dies, daß er über den breiten und reißenden Strom, der unweit von seinem Schlosse dahin floß, und den menschlichen Verkehr hinderte, mit großen Kosten eine feste, schöne Brücke bauen ließ. Er freute sich über den Bau, und ging oft hin, um nach zu sehen und die Arbeiter zum Fleiße zu ermuntern. Als die Brücke fertig war, sandte er einen seiner Diener ab damit er horche, was die Reisenden von ihm urteilen würden, und es ihm berichte.
Der Diener stellte sich auf die Brücke und lauschte auf die Reden der Vorüberziehenden. Einige schalten seinen Herren einen Toren daß er so viel Geld auf eine Sache verwendet habe, die ihm selbst keinen Nutzen bringe; die meisten aber priesen ihn, daß er durch die Erbauung der Brücke der ganzen Umgegend eine so große Wohltat erwiesen. Endlich kamen zwei ehrwürdige Greise daher mit langen weißen Bärten, in Pilgerkleidern. Von diesen sagte der eine: »Was muß das für ein edler Mann sein der einen so bedeutenden Teil seines Vermögens geopfert, um seinen Nebenmenschen einen Dienst zu tun!« - »Fürwahr« sagte der andere, »der Erbauer dieser Brücke verdient eine große Belohnung für sein Werk!« - »Wie könnten wir ihn wohl nach Verdienst belohnen?« fragte der erste. »Seine Gattin möge einen Sohn gebären, dem alle Mächte untergeben sein, und dessen Wünsche alle erfüllt werden sollen!« versetzte der zweite und mit diesen Worten gingen sie vorüber.
Der Diener, der das Zwiegespräch vernommen, wunderte sich nicht wenig und da er ein schlechtes Herz hatte, dachte er sogleich nach, wie er daraus, zum Schaden seines Herrn, einen Vorteil für sich ziehen könnte. Als er nach Hause kam, berichtete er seinem Herren die verschiedenen Urteile der Reisenden; hinsichtlich der Pilger aber erlaubte er sich eine abscheuliche Lüge. Er erzählte nämlich, wie die zwei ehrwürdigen Greise bedauert hätten, daß ein so edler Wohltäter der Menschen ein so unerhörtes Unglück erleben solle; denn seine Gemahlin werde einen Sohn zur Welt bringen, den sie bald nach der Geburt töten und aufessen werde. Darüber betrübte sich der gute Herr außerordentlich, und zeigte gar keine Freude, als ihm seine holde Gemahlin eröffnete sie hoffe zu Gott, ihr beiderseitiger Wunsch werde in Erfüllung gehen, sie würden einen Erben bekommen.
Die holde Frau gebar wirklich ein Söhnlein und obwohl der Vater jubelte, so trübte ihm die unglückliche Prophezeiung doch stets seine Freude, denn wie sich ein Teil der selben, nämlich daß ihm ein Erbe geboren ward, erfüllt hatte so mußte er auch mit Sicherheit die Erfüllung des anderen Teils erwarten. Indessen paßte der verräterische Diener auf Gelegenheit, um seinen elenden Vorsatz auszuführen. Eines Tages, die günstige Zeit ersehend, stahl er sich Abends in das Gemach der Frau in dem er wußte, daß sie bereits fest schlafen werde. Hier nahm er das Kind das neben der Mutter in einer Wiege lag, und trug es zu seinem Weibe, dem er befahl, auf der Straße seiner zu harren. Dann kehrte er zurück, fing im Hofe einen Hahn, schnitt ihm mit dem Küchenmesser den Kopf ab und bestrich mit seinem Blute die leere Wiege und das Bett der Mutter: das Messer legte er in die Wiege. Nachdem er dies vollbracht, eilte er zu seinem Weibe, und beide zogen mit dem gestohlenen Kinde in die weite Welt.
Des Morgens, als der Herr in das Gemach seiner Gemahlin trat, die noch schlief, sah er mit Entsetzen die Wiege leer, und die Blutspuren der vermeintlichen Schreckenstat. Er glaubte, der zweite Teil der unglücklichen Prophezeiung sei in Erfüllung gegangen, ward wütend vor Schmerz, und da er seine Gemahlin für die Schuldige hielt, durchbohrte er die Schlafende mit seinem Schwerte, so daß sie auf der Stelle tot blieb. Kaum jedoch, daß er die Tat vollbracht, da kühlte sein Blut sich ab, er begann alles zu überlegen, und empfand Reue; denn er hatte seine Gattin sehr geliebt, und ohne sie blühte ihm kein Glück auf Erden. Da begann er sein Schicksal zu beweinen; plötzlich aber erfaßte ihn Verzweiflung, er stürzte wie ein Wahnsinniger aus dem Schlosse, und es war nichts weiter von ihm zu hören. Als hierauf die Diener die Herrin tot fanden, und der Herr sich nirgend zeigte rafften sie alles Gut im Schlosse zusammen und zerstreuten sich; das Schloß stand öd und ward allmählich zur Ruine.
Inzwischen hatte der treulose Diener mit seinem Weibe das gestohlene Kind in ferne Lande getragen, und als es heranwuchs und allmählich zu Verstand kam, wußte er als vermeintlicher Vater den Knaben anzuleiten, ja zwang ihn gewaltsam, daß er sich dies und jenes wünschte, was stets erfüllt wurde. So häufte der Verräter große Reichtümer und lebte in Fülle und Pracht; seine Frau jedoch, die von dem Geheimniß nichts wußte, konnte sich nicht genug wundern, woher ihr Mann alles das nehme, und drang oftmals in ihn, es ihr zu entdecken. Lange weigerte er sich, bis er endlich ihren Bitten nicht zu widerstehen vermochte, und ihr alles vertraute
.
Dies hörte zufällig der an der Tür lauschende Knabe, der schon zwölf Jahre zählte, und erfuhr so, welcher Abkunft er sei, und welche Wundergabe er besitze. Groß war sein Vergnügen, daß ein anderer sein Vater sei, als der, der ihn oft so unbarmherzig gequält, und er beschloß, ihn nach Verdienst zu strafen. Mittelst seiner Gabe, vermöge der ein jeder seiner Wünsche zur Wirklichkeit ward, verwandelte er den treulosen Diener in einen schwarzen Hund, und machte sich mit ihm auf den Weg, um sein väterliches Schloß zu suchen.
Lange zog er in der Welt umher, ohne seine Geburtsstätte erfragen zu können. Es fiel ihm nicht bei, daß er ja nur zu wünschen brauche, am Ziele zu sein; denn wo hat ein Knabe in seinem Alter hinreichend Verstand! Doch ersann er dies Mittel, daß er in jeder Herberge, wo er aß oder übernachtete, seinem Hunde anstatt des Essens Spähne zu reichen befahl, und wenn sich die Wirtsleute wunderten, daß der Hund Spähne essen solle, zur Antwort gab:
»Konnte die Mutter ihr Kind aufessen,
Kann der Hund auch Spähne fressen.«
Nach langem hin und her Wandern gelangte er endlich zu einem breiten und reißenden Strome, über den eine herrliche Brücke führte. Am Ende der Brücke stand eine neu erbaute Herberge, worin der Knabe, erschöpft vom Wege, anhielt. Da ließ er sich, ein reiches Mahl bereiten, seinem Hund jedoch befahl er Spähne vorzuwerfen, und als sich der Wirt wunderte, daß der Hund Spähne essen solle, gab er wie gewöhnlich zur Antwort:
»Konnte die Mutter ihr Kind aufessen,
Kann der Hund auch Spähne fressen!«
»Ei,« sagte der Wirt, »das geschah vor zwölf Jahren unweit von hier in einem Schlosse, daß eine Mutter ihr Kind auf aß, worauf ihr Mann sie im Zorne ermordete, und dann verschwand, ohne daß jemand weiß wohin. Ich diente damals in dem Schlosse, und alles war erstaunt über den Vorfall. Die Mutter begrub man ihrer Tat wegen an einem ungeweihten Ort; doch was konnte die Unglückliche dafür, es war ihr vor des Kindes Geburt prophezeit worden!«
Freudig hörte der Knabe diese Worte; denn sie entdeckten ihm, daß hier sein väterlicher Sitz sei. Er ließ sich zu dem Grabe der Mutter führen, kniete dort nieder, und vergoß bittre Tränen. »O wärest du doch am Leben, unglückliche Mutter, die ich nicht kannte, und die so unschuldig litt!« rief er mit überwallendem Gefühl. Und sieh! da öffnete sich die Erde, und aus dem Grabe stieg eine holde Frauengestalt, drückte den Knaben an ihre Brust, und nannte ihn Sohn. Der Knabe hatte, ohne es zu wissen, durch den ausgesprochenen Wunsch seine Mutter zum Leben erweckt, und war jetzt wie von Sinnen, und konnte nicht fassen was sich begebe. Bald aber besann er sich, umschlang die Mütter zärtlich, und versank in seine Glückseligkeit. »Wäre doch auch der Vater hier, und teilte unsere Wonne mit uns!« rief er hierauf und als bald stand ein Mann da von stattlichem Wuchs und freundlichem Aussehen, nur daß Schwermut wie eine Wolke sein Antlitz beschattete. Es war des Knaben Vater, der sein Kind für tot gehalten, und aus Schmerz über den verübten Mord in der Welt umhergeirrt, ohne Ruhe zu finden.
Jetzt klärte sich ihm alles auf, und unaussprechlich war die Lust der Überglücklichem. Sie kehrten in ihr Schloss zurück, das die Wünsche des Sohnes schnell in seinen vorigen Zustand versetzten, und fingen an, ein neues Leben zu leben. Den verräterischen Diener verwandelte der Sohn wieder in einen Menschen, worauf er kraft gerichtlichen Urteils lebendig durch Pferde zerrissen ward.
Der Vater wurde wieder ein Wohltäter seiner Nebenmenschen, bis ihn nach vielen Jahren ein natürlicher Tod abrief; der Sohn aber gebrauchte nach dem Beispiele des edlen Vaters die ihm verliehene Macht nur zum Nutzen Anderer, und hinterließ so ein gesegnetes Andenken.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
VON DER MUTTER UND IHREM SOHNE ...
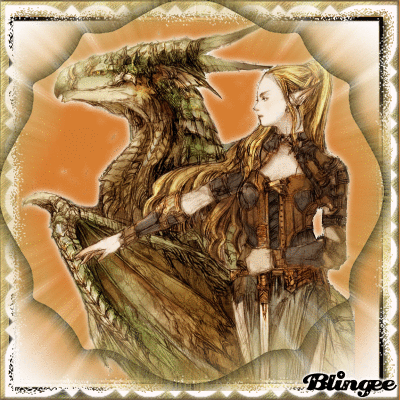
Es war eine Mutter und sie hatte einen Sohn. Diesen Sohn säugte sie zweimal sieben Jahre. Als sie ihn zweimal sieben Jahre gesäugt hatte, nahm sie ihn in den Wald, und befahl ihm, einen Fichtenbaum samt der Wurzel auszureißen. Allein der Knabe konnte den Fichtenbaum nicht ausreißen. »Noch bist du nicht stark genug,« sagte die Mutter und säugte ihn noch sieben Jahre. Als sie ihn dreimal sieben Jahre gesäugt, führte sie ihn wieder in den Wald, und befahl ihm, einen Buchenbaum samt der Wurzel auszureißen.
Der Bursche faßte den Buchenbaum, und riß ihn samt der Wurzel aus. »Jetzt bist du stark genug, jetzt kannst du schon für mich sorgen,« sagte die Mutter. - »Ei versteht sich, daß ich für dich sorgen will, Mutter! Befiehl nur, was ich zuerst für dich tun soll!« - »Zuerst wirst du eine ordentliche Wohnung für mich suchen und dann zu mir kommen,« befahl die Mutter und ging nach Hause. Der Jüngling aber nahm statt eines Stockes den ausgerissenen Buchenbaum in die Hand, samt allen Ästen, so wie ihn der liebe Gott hatte wachsen lassen, und begab sich auf den Weg, um für die Mutter eine Wohnung zu suchen.
Er ging und ging, und kam zu einem Schloß. In dem Schloß hausten Drachen, und als der Jüngling da hin kam, wollten sie ihn nicht einlassen. Der Jüngling aber fragte nicht lange, ob sie ihn einlassen wollten oder nicht, er brach sich ein Tor, ging in das Schloß, als ob er dessen Herr wäre, und erschlug die Drachen. Als er sie erschlagen hatte, schleuderte er die Leiber über die Mauer, und ging, sich das Schloß zu besehen. Überall gefiel es ihm, die Zimmer waren schön, und neun standen offen, das zehnte war verschlossen.
Als er die neun offenen Zimmer durchschritten hatte, öffnete er das zehnte verschlossene, und trat hinein. Er sah dort einen Drachen sitzen, der mit drei eisernen Reifen an die Wand geschmiedet war. »Was machst du da?« fragte der Jüngling. - »Ich sitze da; meine Brüder haben mich angeschmiedet. Mach mich frei, ich will dich reich belohnen!« - »Ei, haben dich deine Brüder angeschmiedet, wird nicht viel Gutes an dir sein. Sitz nur da!« entgegnete der Jüngling, schlug die Türe zu, und ging zu der Mutter, um sie in die neue Wohnung zu führen.
Als er sie gebracht hatte, führte er sie durch alle Zimmer und zeigte ihr alles, nur das zehnte Zimmer öffnete er nicht, und warnte die Mutter, es zu betreten, sonst werde es ihr übel ergehen. Dann nahm er seinen Buchenbaum in die Hand, und begab sich auf die Jagd, um der Mutter irgend einen Braten zu bringen. Kaum war der Jüngling aus dem Schlosse, so ließ es der Mutter keine Ruhe; sie ging so lange bei der Tür des zehnten Zimmers um her, bis sie hinein trat.
Wen sah sie da sitzen? Den Drachen. »Was machst du da, und wer bist du?« - »Ich bin ein Drache, und meine Brüder haben mich aus Zorn hier angeschmiedet. Sie können mich nicht mehr frei machen, weil sie dein Sohn erschlagen hat. Mach mich frei, ich will dich reich belohnen und will dich zum Weibe nehmen,« bat der Drache. - »Was würde mein Sohn dazu sagen!« meinte die Mutter. - »Den schaffen wir aus der Welt und du wirst dann Herrin sein.«
Lange bedachte sich die Mutter, bis sie endlich den Drachen fragte, wie sie ihn frei machen könnte. »Geh in den Keller, und bring mir aus dem hintersten Faß einen Becher Wein!« Die Mutter ging in den Keller, füllte aus dem hintersten Faß einen Becher Wein, und gab ihn dem Drachen zu trinken. Als dieser den ersten Becher ausgetrunken, fiel krachend ein Reif von seinem Leibe. Er bat, sie möchte ihm noch einen Becher bringen.
Die Mutter brachte den zweiten Becher, und als ihn der Drache ausgetrunken, fiel krachend der zweite Reif von seinem Leibe. Er bat um den dritten Becher, und als die Mutter auch den dritten gebracht, fiel auch der dritte Reif von des Drachen Leibe, und er war frei. »Aber was werde ich dem Sohne sagen, wenn er kommt?« fragte die Mutter mit Bangen. - »Ich will dir einen Rat geben,« sprach der Drache. »Stell dich krank, und wenn er dich fragt, was dir helfen könnte, sag ihm: ein Ferkel von der Erdsau. Wenn er darnach geht, wird ihn die Erdsau zerreißen.« - »Gut!«
Der Jüngling kam von der Jagd und brachte der Mutter einen Rehbock. Aber die Mutter stöhnte und seufzte, in dem sie sprach: »Ach, mein lieber Sohn, du hast dich umsonst abgemüht, bringst mir umsonst gute Speise; ich kann nicht essen, ich werde sterben.« - »O Mutter, stirb nicht, sag mir lieber schnell, was dir helfen kann, ich will gern alles tun!« rief besorgt der gute Jüngling, der die Mutter ungemein liebte. »Ich kann nur gesund werden, wenn ich ein Ferkel von der Erdsau habe,« sagte die Mutter. Und der Jüngling säumte nicht, nahm seinen Buchenbaum in die Hand, und ging, die Erdsau zu suchen.
Der Arme ging Kreuz und Quer; denn er wußte nicht, wo die Erdsau zu finden sei. Da sah er eine Hütte, und als er hinein trat, fand er dort die heilige Nedelka. »Wohin gehst du?« fragte ihn die Heilige. »Zur Erdsau, um ein Ferkel zu holen für meine Mutter, die krank ist, und davon gesund werden wird.« - »Mein Sohn,« sprach die Heilige; »du wirst das Ferkel schwerlich bekommen; allein ich will dir behilflich sein. Doch mußt du gehorchen, und tun wie ich dir sage.« Der Jüngling versprach zu gehorchen.
Die Heilige gab ihm einen langen, scharfen Spieß und sagte: »Geh in den Pferdestall und setz dich auf mein Roß Tatoschik; es wird dich dort hin tragen, wo die Erdsau sich aufhält, eingewühlt in die Erde. Kommst du hin, so stich mit dem Spieß ein Ferkel; es wird quieken, und wenn es quiekt, wird die Erdsau wütend auf fahren, und im Flug die Welt umrennen. Dich aber wird sie nicht gewahren, noch wen anderes, und da wird sie zu den Ferkeln sagen, wenn sie noch einmal quiekten, so werde sie sie zerreißen. In diesem Augenblicke mußt du das Ferkel zum zweiten Male stechen, aufspießen und davonreiten. Das Ferkel wird sich fürchten, nicht quieken die Erdsau wird sich nicht rühren, und Tatoschik wird dich davon tragen.«
Der Jüngling versprach zu gehorchen, nahm den Spieß, setzte sich auf Tatoschik, und dieser trug ihn pfeilschnell weit, weit weg, bis dorthin, wo die Erdsau in der Erde eingewühlt war. Der Jüngling stach mit dem Spieß ein Ferkel, daß es furchtbar quiekte. Die Erdsau fuhr auf und umrannte die Welt im Flug. Aber Tatoschik rührte sich nicht von der Stelle, und die Erdsau gewahrte ihn nicht, noch wen anderes, und sagte zu den Ferkeln: »Wenn Ihr noch einmal quiekt, so zerreiße ich Euch.« Dann wühlte sie sich wieder ein.
Da spießte der Jüngling das Ferkel auf, und es schwieg und gab keinen Laut von sich, und Tatoschik begann zu rennen, und sogleich waren sie bei der Heiligen. »Nun, wie war es?« - »So wie du sagtest. Hier ist das Ferkel,« erwiderte der Jüngling. - »Wohl, nimm es und bring es der Mutter!« Der Jüngling übergab den Spieß, führte Tatoschik in den Stall, nahm seinen Buchenbaum in die Hand, hängte das Ferkel daran, dankte der Heiligen und eilte zur Mutter.
Die Mutter tafelte mit dem Drachen. Sie dachten, der Jüngling werde nicht zurück kehren, in dessen war er schon da. Sie erschraken, als sie ihn kommen sahen, und berieten sich, wie sie ihn aus der Welt schaffen könnten. »Wenn er Dir das Ferkel gibt, stell dich noch einmal krank,« sprach der Drache zu ihr, »und wenn er dich fragt, was dir helfen könnte, sag ihm: das Wasser des Lebens und des Todes. Geht er darnach, wird er seinen Untergang finden.«
Der Jüngling kam Freuden voll in das Schloß geeilt, und gab der Mutter das Ferkel. Aber sie stöhnte und seufzte, daß sie sterben müsse, und daß ihr das Ferkel nicht helfen werde. »O stirb nicht, Mutter, und sag mir lieber, was dir helfen kann, ich will es dir bringen!« rief besorgt der Jüngling. »Ach, mein lieber Sohn, wie wär es möglich, daß Du mir es brächtest! Mir hilft nur noch das Wasser des Lebens und des Todes,« klagte die Mutter. Der Jüngling säumte nicht, nahm seinen Buchenbaum in die Hand, und eilte gerade zur heiligen Nedelka.
»Wohin gehst du?« fragte ihn die Heilige. »Zu dir geh ich, mich zu beraten, wo ich das Wasser des Lebens und des Todes fände. Die Mutter ist noch krank und wird davon gesund werden.« - »Du wirst das Wasser schwerlich bekommen, mein Sohn; allein ich will dir behilflich sein. Da hast du zwei Krüge, setzt Dich auf mein Roß Tatoschik und es wird dich zu zwei Bergen tragen. Unter ihnen entspringt das Wasser des Lebens und des Todes. Der rechte Berg öffnet sich Mittags, dort sprudelt das Wasser des Lebens; der linke Berg öffnet sich Mitternachts, dort steht das Wasser des Todes. Wenn sich der Berg öffnet, spring schnell mit dem Krug hinzu, und schöpfe Wasser. Hast Du Wasser von beiden Bergen, so komm zu mir. Gehorche jedoch, und tue genau, wie ich dir sage.« So sprach die Heilige, und gab dem Jüngling die Krüge; dieser setzte sich mit ihnen auf Tatoschik und verschwand. -
Irgendwo in weit entfernter Gegend waren zwei Riesenberge, und zu diesen trug Tatoschik den Jüngling. Es war Mittag, da erhob sich der erste Berg, Wasser des Lebens sprudelte hervor, der Jüngling sprang hinzu, schöpfte in den Krug, und krachend fiel der Berg wieder zu, so daß er dem Jüngling bald die Fersen abgeschlagen hätte. Dieser schwang sich mit dem Krug auf Tatoschik, und jagte zu dem linken Berg. Sie harrten bis Mitternacht; Mitternachts erhob sich der Berg, und unter ihm stand das Wasser des Todes. Der Jüngling schöpfte schnell in den Krug, und krachend fiel der Berg wieder zu, so daß er dem Jüngling bald die Hände abgeschlagen hätte. Dieser schwang sich auf Tatoschik, Tatoschik begann zu rennen, und sogleich waren sie bei der Heiligen. »Nun, wie erging es?« fragte die Heilige, als er zurück war. »Gut, hier hast Du Wasser des Lebens und des Todes,« entgegnete der Jüngling, und gab ihr das Wasser.
Die Heilige bewahrte das Wasser, gab dem Jüngling zwei Krüge gewöhnlichen Wassers, und befahl ihm, diese der Mutter zu bringen. Der Jüngling bedankte sich und ging. Die Mutter tafelte mit dem Drachen. Sie dachten, der Jüngling werde nimmer wieder kehren, in dessen war er schon da. Sie erschraken, als sie ihn kommen sahen, und berieten sich, wie sie ihn aus der Welt schaffen könnten. »Stell dich noch einmal krank,« riet der Drache, »und sag ihm, dir würde nicht besser werden, wenn du nicht den Vogel Pelikan sähest. Geht er, ihn zu holen, so wird es sein Verderben sein.«
Der Jüngling brachte der Mutter mit Freuden das Wasser; aber die Mutter stöhnte und seufzte, es werde ihr auch dies nicht helfen, sie müsse sterben. »O stirb nicht, Mutter, und sag mir, wie ich dir helfen kann, ich will dir alles bringen,« rief besorgt der gute Jüngling. »Mir wird nicht besser werden, wenn ich nicht den Vogel Pelikan sehe. Doch wie könntest du mir diesen schaffen!« sagte die Mutter. Der Jüngling nahm wieder seinen Buchenbaum, und ging geradewegs zur heiligen Nedelka.
»Wohin gehst du?« fragte ihn die Heilige. »Zu dir geh ich, daß du mir rätst. Die Mutter wurde auch von dem Wasser nicht gesund; sie muß den Vogel Pelikan sehen. Wo aber finde ich den Vogel?« - »O mein lieber Sohn,« sprach die Heilige, »du wirst den Vogel schwerlich bekommen, allein ich will dir behilflich sein. Der Pelikan ist ein furchtbarer Vogel; er hat einen ungeheuer langen Hals, und macht mit den Flügeln einen Wind, daß die Bäume umstürzen. Da hast du eine Büchse, setz dich auf mein Roß Tatoschik, und es wird dich dort hin tragen, wo sich der Vogel Pelikan aufhält. Gib Acht, von welcher Seite der Wind auf dich wehen wird! Nach dieser Seite ziele, und hörst du den Hahn klappen, stoß den Ladestock in die Büchse und reite schnell davon, in die Büchse aber sieh nicht hinein!«
Der Jüngling nahm die Büchse, setzte sich auf Tatoschik, und sie flogen pfeilschnell dahin, bis sie auf eine große Heide kamen, wo sich der Vogel Pelikan aufhielt; dort blieb Tatoschik stehen. Der Jüngling fühlte, daß ein starker Wind auf seine rechte Wange wehe. Er zielte nach dieser Seite, der Hahn klappte, schnell stieß der Jüngling den Ladestock in die Büchse und warf sie über die Schulter. Tatoschik begann zu rennen, und sogleich waren sie bei der Heiligen. »Wie steht es?« fragte die Heilige. - »Ich weiß nicht, ob gut, ob schlimm; ich tat blos so, wie du mir befahlst,« erwiderte der Jüngling, und gab ihr die Büchse. - »Gut, da ist er!« sprach die Heilige, als sie in die Büchse geblickt hatte. Dann bewahrte sie den Vogel Pelikan, gab dem Jüngling eine andere Büchse, und zeigte ihm auf einem Baum einen Adler; den solle er schießen, und der Mutter statt des Vogels Pelikan bringen.
Der Jüngling gehorchte der guten Heiligen in allem, und als er den Adler geschossen hatte, hängte er ihn an den Buchenbaum und ging nach Hause. Der Drache tafelte wieder mit der Mutter. Sie dachten, der Jüngling werde nie mehr sichtbar werden, und schon war er nah. Sie erschraken sehr, als sie ihn kommen sahen, und berieten sich, was zu tun sei. »Stell dich noch einmal krank, und sag ihm, dir könnten nur goldene Äpfel aus dem Drachengarten helfen! Gelangt er dort hin, so werden ihn die Drachen zerreißen, denn sie sind erbost über ihn.« Der Jüngling gab der Mutter mit Freuden den Vogel; allein die Mutter stöhnte und seufzte, das nütze ihr alles nichts; ihr könnten nur goldene Äpfel aus dem Drachengarten helfen. »Du sollst sie haben, Mutter!« sagte der Jüngling, und begab sich wieder aus dem Schlosse gerade zur heiligen Nedelka.
»Wohin gehst du denn nochmals?« fragte ihn die Heilige. »Ach, meiner Mutter ist noch nicht geholfen, sie ist noch krank, und nur Äpfel aus dem Drachengarten können sie gesund machen.« - »Nun bleibt nichts übrig, mein Sohn, als daß Du kämpfst. Und wärst Du noch so stark, es würde dir schlimm ergehen; allein ich will dir behilflich sein.« sprach die Heilige. »Da hast du einen Ring, steck ihn an den Finger; sobald du den Ring drehst, und dabei an mich gedenkst, wird dich Kraft von hundert Männern erfüllen. Setz dich nun auf Tatoschik, er wird dich an Ort und Stelle tragen.«
Der Jüngling setzte sich auf Tatoschik, und dieser trug ihn weit weg bis zu einem Garten, um den eine hohe Mauer lief. Nimmer wäre der Jüngling über die Mauer gekommen, wenn nicht Tatoschik gewesen wäre; der flog über sie, wie ein Vogel. Im Garten stieg der Jüngling ab, und ging, sich nach dem Baum mit goldenen Äpfeln um zu sehen. Da begegnete ihm ein schönes Mädchen und fragte ihn, was er suche. Der Jüngling erwiderte, daß er goldene Äpfel suche für seine kranke Mutter, und bat das Mädchen, es möchte ihm sagen, wo der Apfelbaum sei. » Den Apfelbaum hüte ich,« sprach das Mädchen, »und ich darf von ihm niemandem Obst geben, sonst würde mich der Drache töten. Ich bin eine Königstochter, von dem Drachen in diesen Garten getragen, um ihn zu hüten. Kehr um, Jüngling! Der Drache ist furchtbar stark, und wen er hier gewahrt, den tötet er gleich einer Fliege.«
Allein der Jüngling ließ sich nicht abhalten, und eilte weiter in den Garten. Da zog die Prinzessin einen kostbaren Ring vom Finger, und gab ihn dem Jüngling mit den Worten: »Steck den Ring an, und drehst du ihn und gedenkst dabei an mich, wird dich Kraft von hundert Männern erfüllen. Auf andere Weise würdest du den Drachen nicht besiegen.« Der Jüngling nahm den Ring, steckte ihn an einen Finger der linken Hand - an der rechten hatte er den Ring der Heiligen - bedankte sich schön, und schritt mutig weiter. Da erblickte er in der Mitte des Gartens goldene Äpfel auf einem Baume, und unter dem Baume einen furchtbaren Drachen. »Was willst du hier, du Mörder meiner Brüder und Gefährten?« brüllte der Drache ihn an. »Ich komme, um goldene Äpfel von diesem Baume zu holen,« entgegnete der Jüngling unerschrocken. »Du wirst keine goldenen Äpfel pflücken, sondern mit mir ringen.« - »Wohlan, wenn du Lust hast! Komm!« sagte der Jüngling, drehte den Ring an der rechten Hand, gedachte an die Heilige, spreizte die Füße auseinander, und sie begannen zu ringen.
Zuerst brachte der Drache den Jüngling aus seiner Stellung, doch dieser preßte ihn dann bis über die Knöchel in die Erde. Da rauschten plötzlich Flügel über ihnen, und ein schwarzer Rabe flog herbei und krächzte: »Wem soll ich helfen, dir oder dir?« - »Hilf mir,« rief der Drache. - »Und was gibst du mir?« - »So viel Geld, als du begehrst.« - »Mir hilf!« rief der Jüngling. »Ich geb dir alle Pferde, die dort auf der Wiese weiden.« - »Dir will ich helfen,« krächzte der Rabe, »doch wie soll ich dir helfen?« fragte er. - »Kühl mich, weil mir heiß wird!« erwiderte der Jüngling. Es ward ihm heiß, denn der Drache hauchte ihn mit seinem feurigen Atem an. Sie rangen weiter.
Der Drache faßte den Jüngling und preßte ihn bis unter die Knöchel in die Erde. Jetzt rasteten sie. Der Rabe netzte seine Flügel im Brunnen, setzte sich auf des Jünglings Haupt und sprengte ihm Tropfen auf das Antlitz, das von dem Feuer des Drachen glühte. So kühlte er ihn. Der Jüngling drehte den anderen Ring, gedachte des schönen Mädchens, und sie faßten sich wieder. Der Drache preßte den Jüngling bis über die Knöchel in die Erde; doch dieser faßte den Drachen, preßte ihn bis an die Schultern in die Erde, griff zum Schwert, das er gleichfalls von der Heiligen erhaltenhatte, und hieb dem Drachen das Haupt mit einem Hieb ab. Da kam die Prinzessin, pflückte ihm selbst goldene Äpfel, und bedankte sich schön, daß er sie befreit habe; sie sagte ihm auch, sie wolle seine Gemahlin werden, er möchte sich mit ihr zu ihrem Vater begeben. »Ihr gefallt mir gleichfalls,« sagte der Jüngling, »und wenn ich könnte, ginge ich wohl mit Euch. Wollt Ihr ein Jahr meiner harren, komm ich zu Euch.« Die Prinzessin reichte ihm die Hand darauf, daß sie ein Jahr lang seiner harren wolle.
Der Jüngling nahm Abschied von ihr, setzte sich auf Tatoschik, sprang mit ihm über die Mauer, tötete auf der Wiese einen Haufen Pferde für den Raben, und ritt dann zur Heiligen. »Nun, wie erging es dir?« fragte die Heilige. »Gut,« erwiderte der Jüngling. »Allein hätte mir die Prinzessin nicht einen zweiten Ring gegeben, wäre es schlimm gewesen.« Hierauf erzählte er der Heiligen alles. Die Heilige befahl ihm, er solle sich zur Mutter begeben, und Tatoschik mit sich nehmen. Der Jüngling gehorchte. Der Drache und die Mutter tafelten, und erschraken sehr, als sie den Jüngling heran reiten sahen; sie hatten nicht geglaubt, daß er aus dem Drachengarten wieder kehren werde. Die Mutter fragte, was sie tun solle; aber der Drache wußte keinen Rat mehr, und ging, sich in dem zehnten Zimmer zu verbergen.
Der Jüngling gab der Mutter die goldenen Äpfel, und die Mutter stellte sich, als ob ihr Anblick sie gesund gemacht hätte. Sie bewirtete ihn, liebkoste ihn, so zärtlich sie konnte, und der Jüngling hatte große Freude, daß die Mutter wieder gesund sei. Da nahm die Mutter eine lange, dicke Schnur, und sagte dem Jüngling: »Lege dich, ich will die Schnur um dich winden, wie ich es deinem Vater zu tun pflegte, und will sehen, ob Du so stärker bist, als er, und sie zerreißest.« Der Jüngling lachte, legte sich, und die Mutter wand die Schnur um ihn, wie um ein Wickelkind; allein er drehte sich plötzlich und zerriß die Schnur in Stücke. »Du bist stark,« sagte die Mutter, »aber warte, ich will noch eine dünne Schnur um Dich winden, und sehen, ob du sie zerreißest.« Sie brachte eine dünne, seidene Schnur, und wand diese um ihn. Der Jüngling dehnte sich und dehnte sich, doch je mehr er sich dehnte, desto tiefer schnitt die Schnur in sein Fleisch ein.
Als die Mutter dies sah, rief sie den Drachen, und der Drache lief herbei, hieb ihm den Kopf ab, und zerhieb den Leib in Stücke. Hierauf nahm die Mutter das Herz heraus, band den Leib zusammen, und hängte das Bündel Tatoschik um, in dem sie sprach: »Hast Du ihn als Lebenden getragen, trage ihn auch als Toten, wohin es dir beliebt.« Tatoschik säumte nicht, begann zu rennen, und war sogleich zu Hause bei seiner Herrin. Die Heilige harrte bereits auf ihn, denn sie wußte alles voraus, was und wie es geschehen werde. Alsbald fügte sie den Leib zusammen und wusch ihn mit dem Wasser des Todes, dann mit dem Wasser des Lebens; der Jüngling gähnte, streckte sich und stand lebend und gesund auf.
»Ach, wie lange hab' ich geschlafen!« sagte er. - »Du hättest in Ewigkeit geschlafen, wenn ich dich nicht aufgeweckt hätte. Wie ist dir?« fragte ihn die Heilige. - »Gut, aber sonderbar, mein Herz schlägt nicht.« -
»Wie soll es schlagen, da du keines hast!« - »Und wo ist es?« fragte der Jüngling verwundert. - »Es hängt im Schlosse an der Schnur, fest gebunden an der Decke,« erwiderte die Heilige, und erzählte ihm alles Übrige, was mit ihm geschehen war. Der Jüngling geriet nicht in Zorn und weinte nicht, denn er hatte kein Herz. Dann befahl ihm die Heilige, Bettlerkleider anzuziehen, gab ihm eine Sackpfeife, und schickte ihn in das Schloß, daß er dort pfeife, und für die Musik zum Lohne das Herz begehre; mit diesem solle er zu ihr zurückkehren.
Der Jüngling ging, und da er bemerkte, daß die Mutter zum Schlosse heraus sehe, stellte er sich unter das Fenster, und begann gar schön zu pfeifen. Der Mutter gefiel die Musik ungemein, und sie rief den alten Sackpfeifer in das Schloß, daß er ihr da vorspiele. Der Jüngling pfiff und pfiff, und die Mutter tanzte mit dem Drachen den Tag und die Nacht durch, bis sie ganz müde war. Sie gab dem Sackpfeifer zu essen und zu trinken, und als sie sich satt getanzt, gab sie ihm auch goldenes Geld. Allein der Sackpfeifer sagte: »Wozu soll mir das Geld! Ich bin schon alt.« - »Nun, was soll ich Dir geben! Erbitte Dir etwas!« entgegnete die Mutter. - »Was Ihr mir geben sollt?« sagte der Jüngling und blickte in dem Zimmer umher. »Gebt mir das Herz, das dort von der Decke hängt.« - »Ei, das will ich Dir gern geben,« erwiderte die Mutter, nahm das Herz herab, und gab es dem Jüngling. Dieser bedankte sich schön, und ging aus dem Schlosse zu der Heiligen.
»Gut, daß wir es wieder haben!« sagte die Heilige, nahm das Herz, wusch es mit dem Wasser des Todes und des Lebens, gab es dem Vogel Pelikan in den Schnabel, und befahl ihm, es dem Jüngling an der rechten Stelle einzusetzen. Der Vogel Pelikan streckte seinen langen, dünnen Hals aus, setzte dem Jüngling das Herz an der rechten Stelle ein, und der Jüngling fühlte so gleich, daß es ihm fröhlich schlage. Dafür schenkte die Heilige dem Vogel Pelikan die Freiheit. Hierauf verwandelte sie den Jüngling in einen Tauber, und befahl ihm, in das Schloß zu fliegen, und sich zu überzeugen, was die Mutter mache. »Wirst Du wieder ein Mensch sein wollen, gedenke an mich, und als bald wirst du einer sein!« fügte sie hinzu.
Der Jüngling flog also als Tauber in das Schloß, und durch das Fenster in das Zimmer, wo die Mutter wohnte. Da sah er sie mit dem Drachen buhlen. Die Mutter aber gewahrte den Tauber so gleich, und schickte den Drachen, daß er die Büchse nehme und ihn tot schieße. Bevor jedoch der Drache die Büchse nehmen konnte, flog der Tauber herab, verwandelte sich in einen Menschen, griff zum Schwerte und hieb dem Drachen mit einem Hieb das Haupt ab. »Und was soll ich mit dir beginnen, Unwürdige?« wandte er sich zur Mutter. Die Mutter fiel vor ihm auf die Knie, und bat um Erbarmen. »Fürchte dich nicht, ich will dir nichts zu Leide tun! Gott richte selbst!« Er faßte die Mutter bei der Hand, führte sie in den Schloßhof, und dort sprach er zu ihr: »Sieh Mutter, dies Schwert schleudere ich in die Luft: Wer schuldig ist, den wird Gott richten.« Das Schwert pfiff durch die Luft, blitzte, und fuhr um des Jünglings Haupt herum gerade in das Herz der Mutter.
Der Jüngling begrub die Mutter, dann kehrte er zur heiligen Nedelka zurück, bedankte sich schön für alles ihm erwiesene Gute, gürtete sein Schwert um, nahm seinen Buchenbaum in die Hand, und ging zu der holden Prinzessin. Diese war schon bei ihrem Vater, und sollte mehrmals Prinzen und Könige freien, allein sie wollte sich nicht vermählen, bevor nicht ein Jahr verflossen sei. Und noch war das Jahr nicht verflossen, als eines Tages der Jüngling in das königliche Schloß trat. »Das ist mein erkorener Bräutigam!« rief sie, als sie ihn erblickte, und sogleich willigte sie in die Hochzeit ein. Da war ein großes Fest, der Vater gab dem Jüngling das Königreich, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch.
Slowakei: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
KÄTHE UND DER TEUFEL ...
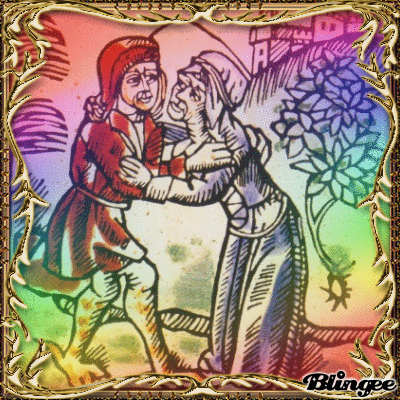
In einem Dorfe war eine Bäuerin, Namens Käthe. Sie besaß eine Hütte, einen Garten und dazu noch einiges Geld; aber hätte sie ganz in Gold gesteckt, würde sie doch kein Bursche gemocht haben, selbst der ärmste nicht, weil sie schlimm war wie der Teufel, und ein böses Maul hatte.
Sie lebte mit einer alten Mutter, und brauchte manchmal Hilfe; aber hätte wen ein Kreuzer retten können, und sie Dukaten gezahlt, wäre ihr dennoch niemand bei gesprungen, weil sie jeder Kleinigkeit wegen gleich zankte und kniff, daß es zehn Meilen weit zu hören war. Zu allem dem war sie garstig, und so blieb sie sitzen, bis sie allmählich Vierzig zählte. Wie es meisten Teils in Dörfern zu sein pflegt, daß jeden Sonntag Nachmittags Musik aufspielt, so war es auch hier; wenn sich beim Richter oder in der Schenke der Dudelsack hören ließ, war die Stube gleich von Burschen voll, in der Hausflur und vor dem Hause standen Mädchen, an den Fenstern Kinder. Aber die erste von allen war Käthe.
Die Bursche winkten den Mädchen, und die traten dann ins Rad: Käthen war solch Glück ihr Lebtag nie widerfahren, obwohl sie den Dudelsackpfeifer vielleicht selbst bezahlt hätte, aber trotz dem ließ sie keinen einzigen Sonntag aus. Eines Tages geht sie wieder, und denkt unterwegs bei sich: »Bin schon so alt, und hab noch nie mit einem Burschen getanzt; ist das nicht zum Ärgern? Fürwahr, heute mochte ich meinethalben mit dem Teufel tanzen.«
Grimmig kommt sie in die Schenke, setzt sich zum Ofen und schaut, wie die Burschen die Mädchen zum Tanze wählen. Auf einmal tritt ein Herr im Jägergewand in die Stube, setzt sich unweit von Käthen zum Tisch und läßt sich einschenken. Die Aufwärterin bringt Bier, und der Herr nimmt es und trägt Käthen zu trinken hin. Käthe wunderte sich ein Weilchen, daß ihr der Herr solche Ehre erweise; ein Weilchen sträubte sie sich, doch endlich trank sie und zwar gern. Der Herr stellt den Krug hin, zieht aus der Tasche einen Dukaten, wirft ihn dem Dudelsackpfeifer zu, und ruft: »Ein Solo!« Die Burschen treten auseinander, und der Herr nimmt sich Käthen zum Tanze.
»Ei, zum Kuckuk, wer ist das doch?« fragen die Alten und stecken die Köpfe zusammen; die Burschen verziehen den Mund, und die Mädchen verkriechen sich, eins hinter dem anderen, und nehmen die Schürze vors Gesicht, daß Käthe nicht sehe, wie sie sie auslachen. Aber Käthe sah niemanden, sie war froh, daß sie tanzte, und hätte sie die ganze Welt ausgelacht, so würde sie sich nichts daraus gemacht haben. Den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend tanzte der Herr nur mit Käthen, kaufte ihr Pfefferkuchen und Rosoglio, und als die Zeit zum nach Hause gehen kam, begleitete er sie durchs Dorf.
»Könnt' ich doch mit euch bis zu meinem Ende tanzen, wie heut!« sagte Käthe, als sie sich trennen sollte. »Das kann sein, komm mit mir!« »Wo wohnt ihr denn?« »Hänge dich mir um den Hals, ich will es dir sagen.« Käthe tat es, allein in dem Augenblicke verwandelte sich der Herr in den Teufel, und flog mit ihr gerade zur Hölle. Beim Tor hielt er an und pochte, die Kameraden kamen, öffneten, und als sie sahen, daß er ganz in Schweiß sei, wollten sie ihm Erleichterung schaffen und Käthen herunter heben. Die aber hielt fest wie eine Zange, und ließ sich auf keine Weise los reißen: der Teufel mochte wollen oder nicht, er mußte sich mit Käthen um den Hals zu Lucifer verfügen.
»Wen bringst du da?« fragte dieser. Und da erzählte der Teufel, wie er auf Erden gewandelt, und von Käthens Wehklage gehört, daß sie keinen Tänzer bekommen könne, und wie er, um sie zu trösten, mit ihr ein Tänzchen versucht, und ihr auf ein Weilchen auch die Hölle habe zeigen wollen. »Ich habe nicht gewußt,« schloß er, »daß sie mich nicht wird los lassen wolle.« »Weil du ein Dummkopf bist, und dir nicht merkst, was ich sage,« bellte der alte Lucifer ihn an. »Bevor du mit jemandem Etwas anfängst, sollst du seine Gesinnung prüfen. Hättest du dran gedacht, als du Käthen begleitetest, würdest du sie nicht mit dir genommen haben. Jetzt pack Dich und sieh, wie du sie los wirst.«
Voll Verdruß trabte der Teufel mit Frau Käthen auf die Erde zurück. Er versprach ihr goldene Berge, wenn sie ihn frei ließe; er verfluchte sie, alles umsonst. Abgemüht, in Wut gebracht, kam er mit seiner Last auf einer Wiese an, wo ein junge Schäfer in einem ungeheuren Pelz die Schafe hütete. Der Teufel verwandelte sich in einen gewöhnlichen Menschen, und drum erkannte ihn der Schäfer nicht. »Freund, wen tragt ihr denn da?« fragte ihn gutmütig der Schäfer. »Ach Freund, ich atme kaum. Stellt euch vor, ich gehe ganz ruhig meines Weges, ohne an Etwas zu denken, da hockt sich das Weib mir auf den Hals, und will mich um keinen Preis los lassen. Ich hab' sie bis ins nächste Dorf tragen wollen, um mich dort frei zu machen; aber ich bin es nicht im Stande, die Knie schlottern mir.«
»Nu, wartet, ich will euch helfen, aber nicht auf lange, weil ich wieder weiden muß; die Hälfte des Weges etwa will ich sie tragen.« »Ei, da werde ich froh sein.« »Hörst du, häng dich um mich!« schrie der Schäfer Käthen zu. Kaum hörte es Käthe, ließ sie den Teufel, und hing sich um den bepelzten Schäfer. Der hatte nun was zu tragen, Käthen und den ungeheuer großen Pelz, den er des Morgens vom Schaffer geliehen hatte. Auch bekam er es bald genug, und sann, wie er sich Käthens entledigen könnte. Er kommt zu einem Teich, und da fällt ihm ein, ob er sie nicht hinein werfen könnte. Aber wie? Könnte er den Pelz nicht mit ihr ausziehen?
Er war ihm ziemlich weit, und so versuchte er allmählich, ob es ginge. Und sieh, er zieht eine Hand heraus, Käthe merkt nichts; er zieht die andere heraus, Käthe merkt noch immer nichts; er macht die erste Schnur vom Knopfloch los, dann die zweite, dann die dritte, und plumps! liegt Käthe im Teich samt dem Pelz. Der Teufel war dem Schäfer nicht nach gegangen, er saß auf der Erde, hütete die Schafe, und guckte, wie bald der Schäfer mit Käthen kommen würde. Er durfte nicht lange warten.
Den nassen Pelz auf der Schulter, eilte der Schäfer zur Wiese, da er dachte, der Fremde werde vielleicht schon beim Dorfe sein, und die Schafe würden allein weiden. Als sie sich erblickten, sah einer den anderen an, der Teufel, daß der Schäfer ohne Käthen komme, und der Schäfer, daß der Herr noch immer da sitze. Nachdem sie sich verständigt hatten, sprach der Teufel zum Schäfer: »Hab' Dank. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen, denn ich hätte mich vielleicht mit Käthen bis zum jüngsten Tage schleppen müssen. Nie will ich es dir vergessen, und es dir einst reichlich lohnen. Damit du aber weißt, wem du aus der Klemme geholfen hast, so sage ich dir, daß ich der Teufel bin.« Er sprach es und verschwand. Der Schäfer blieb eine Weile wie vom Schlag gerührt stehen, dann sagte er zu sich selbst: »Sind alle so dumm als der, so ist es gut!«
Das Land, wo unser Schäfer sich aufhielt, beherrschte ein junger Fürst. Reichtum besaß er in Fülle; da er Herr über alles war, genoß er alles im vollen Maß. Tag für Tag vergnügte er sich nach Herzenslust auf jede mögliche Art, und wenn die Nacht kam, schallte aus den fürstlichen Gemächern der Gesang ausgelassener Zechbrüder. Das Land verwalteten zwei Stellvertreter, die um kein Haar besser waren als ihr Herr. Was nicht der Fürst vertat, behielten die Zwei, und so erging es den armen Untertanen übel. Einst als der Fürst nicht mehr wußte, was er aussinnen solle, rief er seinen Sterngucker, und befahl ihm, er solle ihm und seinen zwei Stellvertretern die Zukunft vorher sagen. Der Sterngucker gehorchte und forschte in den Sternen, welch ein Ende die Drei nehmen würden.
»Verzeih, o Fürst,« sprach er, als er fertig geworden war, »deinem und deiner Stellvertreter Leben droht solche Gefahr, daß ich mir es nicht zu sagen getraue.« »Sag es nur heraus, sei es, was es sei! Du aber bleibst, und erfüllt sich dein Wort nicht, so kostet es Dich den Kopf.« »Gern unterwerfe ich mich deinem Befehl. So höre denn: Bevor der Mond voll wird, kommt zu beiden Stellvertretern der Teufel, und im Vollmond holt er auch dich, o Fürst, und trägt euch alle Drei lebendig in die Hölle.« »Ins Gefängniß mit dem lügnerischen Wicht!« gebot der Fürst, und die Diener taten nach seinem Befehl.
Im Herzen jedoch war dem Fürsten nicht so zu Mute, wie er sich stellte; die Worte des Sternguckers hatten Eindruck auf ihn gemacht. Zum ersten Mal rührte sich das Gewissen in ihm. Die zwei Stellvertreter fuhr man halb tot nach Hause. Keiner von ihnen nahm einen Bissen in den Mund, endlich rafften sie all ihre Habe zusammen, setzten sich auf, machten sich auf ihre Schlösser davon, und ließen diese von allen Seiten verrammeln, daß ihnen der Teufel nicht beikommen konnte. Der Fürst kehrte auf den rechten Pfad zurück, lebte still und eingezogen, und begann das Land selbst zu verwalten, in der Hoffnung, sein Schicksal vielleicht doch von sich abzuwenden.
Von diesen Dingen hatte der Schäfer keine Ahnung; er weidete täglich seine Herde und kümmerte sich nicht um das, was in der Welt vorging. Da stand eines Tages plötzlich der Teufel vor ihm und sprach: »Ich bin gekommen, Schäfer, um dir den Dienst zu vergelten, den du mir erwiesen. Ich soll die gewesenen Stellvertreter eures Fürsten in die Hölle schaffen, weil sie ihm schlimm geraten und die Armen bestohlen haben. Bis der und der Tag erscheint, gehe in das erste Schloß, wo viel Volk versammelt sein wird. Sobald im Schlosse Geschrei entsteht, die Diener, die Tore öffnen, und ich den Herrn fort schleppe, tritt zu mir und sage: 'Entweiche, sonst wird es dir schlimm ergehen!' Ich will dir gehorchen und wandern. Du aber laß dir von dem Herrn zwei Säcke Gold geben, und will er nicht, so drohe ihm, daß du mich rufen wirst. Hierauf gehe in das zweite Schloß, und tue wieder so, und begehre die gleiche Zahlung. Mit dem Geld aber wirtschafte, und verwende es nur zum Guten. Bis Vollmond ist, muß ich den Fürsten selbst holen; doch den befreien zu wollen, rate ich dir nicht, sonst müßtest du mit deiner eignen Haut büßen.« So sprach er und entfernte sich.
Der Schäfer merkte sich jedes Wort. Als das Viertel um war kündigte er seinen Dienst, und ging zu dem Schlosse, wo der eine der zwei Stellvertreter wohnte. Er kam gerade recht, Haufen von Leuten standen da und schauten, bis der Teufel den Herrn fort schleppen würde. Da erhebt sich im Schloß ein verzweifeltes Geschrei, die Tore öffnen sich, und der Teufel schleppt den Herrn, der schon toten bleich, und eine halbe Leiche ist. Der Schäfer tritt her vor, faßte den Herrn bei der Hand und stößt den Teufel mit den Worten weg: »Pack dich, sonst wird es dir schlimm ergehen!« Und auf der Stelle verschwindet der Teufel, und der hoch erfreute Herr küßt dem Schäfer beide Hände, und fragt ihn, was er zum Lohn begehre. Als der Schäfer sagte: Zwei Säcke Gold! befahl der Herr, sie ihm so gleich zu geben.
Zufrieden ging der Schäfer zu dem zweiten Schloß, und war dort so glücklich als im ersten. Es ist begreiflich, daß der Fürst von dem Schäfer bald erfuhr; denn er fragte in Einem fort, wie es mit den Stellvertretern stehe. Als er alles vernommen hatte, schickte er nach dem Schäfer einen Wagen mit Pferden, und als er gefahren kam, bat er ihn dringend, er möchte sich auch über ihn erbarmen, und ihn aus des Teufels Klauen retten. »Mein Herr und Gebieter,« antwortete der Schäfer, »euch kann ich es nicht versprechen, es geht um meine eigne Haut. Ihr seid ein großer Sünder; aber wenn Ihr euch bessern wolltet, rechtschaffen, mild und weise regieren, wie es einem Fürsten geziemt, so versuche' ich es und sollte ich statt euer in die Hölle müssen.« Der Fürst versprach ernstliche Besserung, und der Schäfer ging mit der Zusage, sich am bestimmten Tage ein zu finden.
Mit Furcht und Angst erwartete er den Vollmond. Wie es die Leute dem Fürsten Anfangs gegönnt hatten, so bemitleideten sie ihn jetzt; denn von dem Augenblicke an, wo er anders ward, konnten sie sich keinen bessern Fürsten wünschen. Die Tage verstreichen, ob sie der Mensch in Freuden oder in Leiden zählt! Ehe der Fürst sich dessen versah, war der Tag vor der Türe, wo er sich von allem trennen sollte, was ihm lieb war. Schwarz angekleidet, wie zum Grabesgange, saß der Fürst, und erwartete den Schäfer oder den Teufel. Auf einmal öffnet sich die Pforte, und der Teufel steht vor ihm.
»Mache dich bereit, die Stunde ist abgelaufen, ich komme um dich zu holen!« Ohne ein Wort zu sprechen, erhob sich der Fürst, und schritt hinter dem Teufel auf den Hof, wo es von Leuten wimmelte. Da drängt sich der Schäfer ganz erhitzt durch die Haufen, und gerade auf den Teufel zu und schreit: »Lauf schnell, lauf schnell, sonst wird es dir schlimm ergehen!« »Wie kannst du dich erdreisten, mich aufzuhalten? Weißt du nicht, was ich dir gesagt habe?« raunte der Teufel dem Schäfer zu. »Du Narr, mir handelt es sich nicht um den Fürsten, sondern um dich! Käthe lebt, und fragt nach Dir.« Sobald der Teufel von Käthen hörte, war er gleich fort, wie weg geblasen, und ließ den Fürsten in Ruhe. Der Schäfer lachte ihn im Stillen aus und war froh, daß er den Fürsten durch diese List befreit hatte. Dafür machte ihn der Fürst zu seinem ersten Hofkavalier und liebte ihn, wie seinen eignen Bruder. Und er tat wohl daran; denn der Schäfer war sein treuer Ratgeber und redlicher Diener.
Von den vier Säcken Gold behielt er keinen Pfennig für sich; er half damit jenen, von denen es die Stellvertreter erpreßt hatten.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
DER LUSTUGE SCHWANDA ...

Schwanda, der Dudelsackpfeifer, war ein lustiger Geselle, und wie jeder ordentliche Musikant, immer durstig, dabei ein großer Liebhaber des Kartenspiels, besonders des sogenannten Straschak. Hatte er den Zuhörern nach ihrem Gefallen vorgedudelt, machte er sich gern einen guten Tag, und sprach gewöhnlich solange dem Kruge zu, und setzte im Spiel, bis ihm alles, was er verdient hatte, wieder aus der Tasche flog, und er so leer weg ging, als er gekommen war. Dabei ergötzte er auch ohne Dudelsack die Gesellschaft mit seinen Späßen und witzigen Einfällen, so daß kaum jemand die Schenke verließ, solange Schwanda dort war, und noch heut zu Tage pflegt man im Böhmischen zu sagen: »Das ist ein Juks,« oder: »Das ist eine Schwande.«
Es geschah eines Tages, daß Schwanda, nach dem er in Mokran am Kirchenweihfest von Mittag bis Mitternacht auf dem Dudelsack gepfiffen und manchen Silbergroschen erworben, den Dudelsack weg legte, trotz allem Drängen und Zureden des jungen Volks, das ihn bat, bis zum Morgen auszuhalten, und ihm reichen Lohn dafür verhieß. Schwanda verdroß es schon, nur fremder Fröhlichkeit zu dienen; er wollte auch sein Vergnügen haben. Er setzte sich daher unter die Nachbarn und begann auf eigne Rechnung zu trinken, und die Gesellschaft mit mancher Schnake und manch scherzhaftem Wort zum Lachen zu reizen.
Endlich bekam er Lust, Karten zu spielen, und forderte die Nachbarn zum Straschak auf; doch fand sich wider Erwarten niemand, der mit ihm gespielt hätte. Schwanda war nicht gewohnt, aus dem Wirtshaus zu gehen, solange er noch einen nicht vertanen Groschen in der Tasche hatte, und heute hatte er sich hübsch viel Geld verdient, war also ungewöhnlich Spiel lustig. Dazu hatte er ein wenig zu tief in den Krug geguckt, und in seinem oberen Stockwerk war es sichtbar nicht richtig. Er gab keine Ruhe, er wollte spielen, und als er sah, daß ihm die Nachbarn durchaus nicht willfahrten, erhob er sich ärgerlich, bezahlte seine Schuld und verließ die Schenke.
»In Drazic,« sprach er unterwegs zu sich, indem er mit unsicherem Fuß dahin schritt, »dort ist Wallfahrt, und der Schulmeister und der Richter sind gern lustig und verachten ein Spielchen nicht. Ja, in Drazic will ich fest sitzen, juchuchu!« Und dabei sprang er in die Höhe und schnalzte mit dem Daumen, daß er noch zehn Schritte fort taumelte, ehe er seinen Leib, da der Kopf allerdings etwas schwer war, ins Gleichgewicht brachte.
Die Nacht war hell, der Mond glänzte wie ein Fischauge. Da kam Schwanda an einen Scheideweg, und erschrak und blieb stehen, als er zufällig die Augen erhob. Eine Schaar Geier und Raben flog in die Luft, und vor ihm stand ein kleines Gebäude aus vier Säulen, oben mit Querbalken, und von jedem Querbalken hing ein halb verwester Leichnam herunter. Schwanda merkte, er sei unter einem Galgen, wie deren damals eine Menge auf Feldern und Straßen aufgerichtet war, den häufigen Räuberhorden zum Schrecken.
Da zeigte sich plötzlich ein Herr, nicht hochgewachsen, mit bleichen Wangen, in schwarzem Gewand, und fragte ihn, heran tretend mit leiser Stimme: »Wohin so spät, Freund Dudelsackpfeifer?« »Nach Drazic, schwarzer Herr!« »Willst du dir mit deinem Dudelsack nicht etwas verdienen?« »Ei was, ich bin des Dudelns schon satt. Habe mir einige Silbergroschen erpfiffen und will jetzt fröhlich sein.« »Was Silbergroschen! Wir wollen dich mit Gold bezahlen!« sagte der schwarze Herr, und in dem er eine Handvoll blinkender Dukaten hervor langte, hielt er sie Schwanda vor die Augen hin.
Der Dudelsackpfeifer war ganz überrascht; der Straschack war freilich eine große Lockspeise, allein das blinkende Metall hatte größere Macht über ihn und als ihn der schwarze Herr bei der Hand faßte, folgte er wie berückt. Schwanda drehte es sich im Kopfe, und er wußte gar nicht, wo, wohin und wie lange ihn der Unbekannte führte; nur daran erinnerte er sich, daß er ihn öfters ermahnte, wenn ihm etwas angeboten würde, Geld oder zu trinken, so sollte er nicht mit anderen Worten danken als: »Viel Glück, Bruder!« -
Auf einmal befand er sich in einer hell erleuchteten Stube, wo drei Herren beisammen saßen, die auf ähnliche Art gekleidet waren, wie sein Führer, und die große Haufen Goldes vor sich hatten, Straschak spielten, und tüchtig setzten. Dabei ging eine Kanne Wein in die Runde, woraus die Spieler einander zu tranken. »Brüder, ich bringe euch Schwager Schwanda,« sprach eintretend der Führer des Dudelsackpfeifers, »der im ganzen Lande so bekannt ist, und den zu hören wir schon lange begierig waren. Ich hoffe euch einen Gefallen zu erweisen; wir wollen ja heute lustig sein, wie es sich gehört, und die Musik wird uns aufs Beste stimmen!« »Wohl getan!« rief einer der Spieler, und in dem er sich zu Schwanda kehrte, sprach er: »Setz dich, Dudler, und trink zu!« und reichte ihm die Kanne mit Wein.
Schwanda nahm die Kanne, trank, stellte sie wieder auf den Tisch und sagte, in dem er die Mütze abzog: »Viel Glück, Bruder!« so wie ihn sein Führer gelehrt. »Und jetzt pfeif eins!« rief ein anderer der Spieler, und Schwanda setzte sich abseits auf eine Bank und blies seinen Dudelsack auf, während sich sein Führer zu den Spielern gesellte, einen mit Dukaten voll gepfropften Beutel aus der Tasche zog und ihn vor sich auf dem Tische ausleerte.
Da fing Schwandas Dudelsack an zu pfeifen, und wunderbar war die Wirkung, welche die Musik auf die vier schwarzen Herren ausübte. Als ob sie gedoppeltes Leben durchströmte, gerieten sie auf einmal in lärmende Fröhlichkeit. Sie setzten rascher, die Dukaten flogen, und die Spieler jauchzten und rückten auf den Stühlen umher; ihr ganzer Leib bewegte sich, und es schien als ob jede ihrer Adern frohlockte. Die Kanne ging in die Runde, und auch Schwanda unterließ nicht, ihr häufig zu zusprechen.
Das Wundersamste war jedoch, daß die Kanne niemals leer wurde und niemand einschenkte. So oft Schwanda ein Stück beendigt hatte, erscholl ihm lautes Lob, und in seine Mütze regnete Gold, wofür er mit oft wiederholtem: »Viel Glück, Bruder!« nach Gebühr dankte. So währte es viele Stunden, bis Schwanda endlich einen Hüpfer zu dudeln begann, der den schwarzen Herren so in die Füße fuhr, daß sie vom Straschak ließen, sich plötzlich erhoben und sich mit wilden Sprüngen in der Stube herum trieben, was sonderbar zu ihrem gesetzten Äußeren und den hohlen Gesichtern stand.
Schwanda hörte auf zu musizieren, der Dudelsack quiekte zum Schluss und die Tänzer machten zuletzt noch einige Purzelbäume. Da trat einer von ihnen zum Tische, und in dem er des Dudelsackpfeifers Mütze nahm, schüttete er alles Gold, was da war, in sie und sprach, sie Schwanda reichend: »Da hast du weil du uns so köstlich erheiterst!« Schwanda traute seinen Augen kaum; geblendet von dem Anblick solchen Reichtums, wußte er vor Freude nicht, was anzufangen; er vergaß in seiner Verwirrung, wie er sich zu bedanken habe, und rief: »Vergelts Euch Gott tausendmal!« Noch hatte er nicht ausgeredet, so bedeckte ein Nebel seine Augen, und alles, Stube, Karten und Herren, war verschwunden. -
Am folgenden Morgen fuhr ein Bauer Mist auf das Feld, und als er zu dem Scheidewege kam, wo der erwähnte Galgen stand, hörte er von ferne Töne. Er horchte, und je näher er kommt, um so gewisser wird er, das seien Dudelsacktöne; er horcht weiter, zweifelt wieder, bis er endlich das Stück erkennt und ruft: »Ei das ist Schwanda!« Als er unter den Galgen selbst kommt, vernimmt er, daß die Töne aus der Höhe schallen; er blickt empor, und sieh! auf einem Eck des Galgens sitzt Schwanda und pfeift eifrig auf dem Dudelsack, während der Morgenwind die Leichen der Gehängten hin und her bewegt.
»Ei, zum Kuckuk, Schwager Schwanda,« ruft der Bauer, »was macht Ihr da oben?« Schwanda fährt zusammen, läßt den Dudelsack fallen, reibt sich die Augen, und in dem er um sich schaut, gewahrt er mit Entsetzen, wo er sich befindet. Nicht ohne Mühe hilft ihm der Bauer herab und Schwanda, der in deß nüchtern geworden, erzählt ihm, was ihm begegnet. Er erinnert sich an die Dukaten, durchsucht die Mütze, kehrt die Taschen um, findet aber keinen Heller. Der Bauer bekreuzt sich und sprach: »Euch hat der liebe Gott gestraft, und hat böse Geister über Euch gesandt, weil Ihr so gierig nach den Karten wart!« »Ihr habt Recht,« erwidert Schwanda, an allen Gliedern zitternd, »ich entsag' für immer dem Kartenspiel.«
Er hielt Wort, und zum Dank, daß er ohne Schaden so großer Gefahr entronnen, hing er den Dudelsack, auf dem er den Teufeln zum Tanz gespielt, in seiner Geburtsstadt Strakonic als Opfergeschenk in der Kirche auf, wo er zum Andenken bis auf unsere Zeit blieb und Veranlassung gab, daß der Strakonicer Dudelsack sprichwörtlich wurde. An einem Tag im Jahre, wo Schwanda auf dem Galgen den Teufel aufgespielt, soll er von selbst gebrummt haben.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
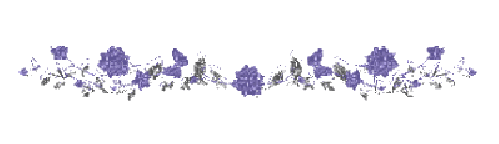
RARASCH UND SCHOTEK ... (Drei Geschichten)

GESCHICHTE I
In Bechar war ein Bauer. Als er einst in die nahe Stadt zu Markte ging, sah er auf dem Felde unter einem wilden Birnbaum ein Huhn; es war schwarz und ganz durchnäßt, zitterte vor Kälte und schrie, als ob es den Pips hätte. Der Bauer nahm es unter den Mantel, trug es nach Hause und setzte es hinter den Ofen, damit es trocken würde; dann ließ er es auf den Hof unter die übrigen Hühner.
Des Nachts als schon alles schlief, hörte der Bauer in der Kammer ein Gepolter und gleich darauf eine durchdringende Stimme, halb wie eines Menschen, halb wie eines Huhnes Stimme: »Gevatter, ich habe euch Kartoffeln gebracht!« Der Bauer sprang aus dem Bette und lief ganz verwundert in die Kammer, um zu sehen, was das sei. Er öffnet die Tür und sieht ein feuriges Huhn, das auf einigen Kartoffelhaufen umher fliegt, von einem auf den anderen. Ehe er jedoch von seinem Schrecken zu sich kam, war es verschwunden.
In der folgenden Nacht hörte er wieder ein Gepolter und den Ruf: »Gevatter, ich habe euch Weizen gebracht, Korn und Gerste!« Der Bauer stand nicht mehr auf, er fürchtete sich; aber bei Tage fand er wirklich in der Kammer drei Getreidehaufen, einen Haufen Weizen, einen Haufen Korn und einen Haufen Gerste. »Das könnt' ich brauchen - den Teufel im Haus! O daß ich die Bestie nicht dort gelassen!« sprach der Bauer bei sich.
Er nahm Schaufel und Besen, und warf und kehrte alles Getreide auf den Mist samt den Kartoffeln. Er war ein ehrlicher Mann und achtete auf einen guten Leumund, und darum hatte er Angst, die Nachbarn könnten etwas davon erfahren; doch wußte er sich keinen Rat. Allein die Nachbarn erfuhren es dennoch; sie bemerkten, wie des Nachts ein Feuerbüschel in des Bauers Haus flog, ohne es anzuzünden, und bei Tage sahen sie das schwarze Huhn unter den übrigen Hühnern auf dem Hofe umher laufen.
Da ging gleich im ganzen Dorfe das Gerede, der Bauer halte es mit dem Teufel. Einigen schien das sonderbar, weil sie ihn von jeher als einen ehrlichen Mann kannten; sie beschlossen daher, ihn vor solchem Unglück zu warnen. Sie gingen zu ihm, und er entdeckte ihnen aufrichtig alles, was und wie es geschehen war, und bat, sie möchten ihm raten, auf welche Art er des Übels los werden könnte.
»Wie, raten? Schlagt die Bestie tot!« sagte ein junger Bauer, und ergriff selbst ein Scheit Holz und schleuderte es nach dem Huhn. Aber in dem selben Augenblick sprang ihm das Huhn auf den Rücken, und puffte auf ihn los, wie mit einem Scheit Holz, daß ihm grün und gelb vor den Augen wurde, und bei jedem Schlage rief es: »Ich bin Rarasch - Rarasch - Rarasch!«
Hierauf rieten einige dem Bauer, er möchte sein Haus verkaufen und fortziehen, Rarasch werde dann zurück bleiben. Der Bauer griff das sogleich auf und suchte einen Käufer; allein niemand wollte das Haus mit dem Rarasch kaufen. Der Bauer nahm sich vor, sich um jeden Preis von Rarasch zu befreien. Er verkaufte sein Getreide, sein Vieh und alles, was er entbehren konnte, kaufte sich ein anderes Haus in einem anderen Dorfe und zog fort.
Und als er schon zum letzten Mal mit seinem Wagen gekommen, um Bottiche, Mulden, Eggen und anderes derartiges Gerät aufzuladen, ging er, und zündete selbst sein strohgedecktes Haus an zwei Enden an. Es stand für sich, und niemand konnte Schaden leiden. »Verbrenne dort, Teufel!« sprach der Bauer bei sich, und schnalzte mit der Peitsche; »für den Platz werde ich wohl noch etwas erhalten.«
»He, he, he!« meldete sich was hinten im Wagen. Der Bauer schaute hin - auf der Sensenstange saß das schwarze Huhn, schlug mit Flügeln, und begann zu singen:
»Wir wandern fort, wir ziehen aus,
Wir ziehen in ein anderes Haus,
Wir ziehen aus, wir wandern fort,
Und stehlen an einem anderen Ort.«
Dem Bauer war, als ob ihn der Schlag getroffen; er wußte nicht, was anzufangen. Da fiel ihm ein, ob sich Rarasch nicht bewegen ließe, selbst fort zu gehen, wenn er ihn füttern würde. Sogleich befahl er seinem Weibe, ihm täglich einen Teller guter Milch zu geben und drei Stück Kuchen dazu. Rarasch befand sich wohl; doch schien es nicht daß er Lust fühle, sich fort zu packen.
Eines Abends kommt der Knecht vom Felde nach Hause, und sieht auf der Stiege die drei Stück Kuchen, welche die Bäuerin für Rarasch hin gelegt. Er schleicht hin zu, nimmt eins nach dem anderen und ißt sie auf. »Besser, ich esse sie, als die Bestie,« denkt er bei sich; »wer wird auch etwas davon erfahren!« Aber in dem Augenblick saß ihm Rarasch schon auf dem Rücken und schrie: »Ein Stück, zwei Stück, drei Stück Kuchen hat der Knecht gegessen!« Und dabei versetzte er ihm jedesmal einen Puff, daß der Knecht später noch lange daran dachte.
Des nächsten Morgens, als der Bauer aufstand und den Knecht zur Arbeit wecken ging, fand er ihn ganz zerschlagen, daß er sich kaum rühren konnte. Und als er von ihm gehört, was geschehen, ging er zu Rarasch, und bat ihn, er möchte ihn verlassen, sonst würde kein Knecht bei ihm dienen wollen.
»He, he, he!« kicherte Rarasch und sprach: »Bringst Du mich wieder dort hin, wo Du mich genommen, komme ich nicht mehr zu Dir.« Der Bauer nahm auf der Stelle seinen Mantel, und trug das Huhn wieder unter den Birnbaum, wo er es gefunden, und nachher hatte er vor Rarasch Ruhe bis an sein Ende.
Geschichte II
In Libenic in der Schäferei hielt sich Rarasch gleichfalls auf, dort aber hießen sie ihn Schotek. Er sah wie ein kleiner Knabe aus, nur hatte er an Händen und Füßen Klauen, und die Leute erzählten sich viele lustige Streiche von ihm.
Gern hetzte er die Hunde, Katzen, Truthühner. Den Knechten und Mägden tat er nichts Gutes, und wenn sie etwas Geheimes zusammen hatten, verriet er es gleich; darum war auch das Gesinde übel auf ihn zu sprechen. Aber der Schafmeister ließ nichts auf ihn kommen; denn die ganze Zeit hin durch, wo Schotek da war, erkrankte kein einziges Schaf.
Im Winter des Abends saß Schotek gewöhnlich hinter dem Ofen und wärmte sich, und wenn die Magd Spreu brühen kam, sprang er immer vom Ofen in den Bottich und rief: »Hops in die Spreu!« Einst jedoch richtete er sich übel zu. Die Magd brachte wie gewöhnlich den Spreubottich, hatte aber früher kochendes Wasser hinein gegossen und nur oben Spreu darauf getan.
»Hops in die Spreu!« rief Schotek, war aber in dem selben Augenblick schon wieder aus dem Bottich, und schrie und heulte vor Schmerz. Das Gesinde lachte, daß alles zitterte. Allein Schotek rächte sich dafür an der Magd. Als sie einst die Leiter hinan auf den Boden stieg, verwickelte er sie so in die Sprossen, daß man ihr zu Hilfe kommen mußte und Mühe hatte, sie wieder los zu machen.
Im Sommer schliefen die Leute des Schafmeisters auf dem Boden. Einst des Nachts kam Schotek auch dahin, kroch zur Hälfte auf die Leiter, und hetzte die Hunde, die unten im Hofe lagen. Er streckte ihnen einen Fuß nach dem anderen entgegen und rief beständig: »Hier ein Fuß, da ein Fuß, bei welchem fangt ihr mich früher?« Die Hunde bellten wie besessen.
Die Knechte verdroß es bereits, daß er ihnen keine Ruhe lasse, und einer stand auf, nahm ein Bündel Heu, und schleuderte den lieben Schotek mit dem Bündel von der Leiter hinab. Die Hunde fuhren als bald auf ihn los, und begrüßten ihn schlecht; kaum entkam er ihren Zähnen. Der Knecht wußte, daß Rache seiner harre, und darum nahm er sich vor Schotek in Acht, und wich ihm schon von Weitem aus; allein es half ihm nichts.
Einst weidete er auf den Gemeindegründen bei der Wiese, und setzte sich auf der Wiese neben einem Heuschober hin. Plötzlich entsteht ein Geräusch über seinem Kopfe, und ehe er sich versieht, ist er mit Heu überschüttet, das ihm zwischen den Haaren kleben bleibt. Der Knecht erhebt ein Geschrei, die Mäher laufen herzu; doch welche Mühe sie auch anwenden, sie können das Heu nicht aus seinen Haaren schaffen, so fest ist es mit den Haaren verschlungen. Der arme Knecht mußte sich den Kopf kahl scheeren lassen.
Und als er dann wieder die Heerde auf die Weide trieb, und auf den Gemeindegründen unter einen wilden Birnbaum kam, saß Schotek oben, und schabte ihm Rübchen, in dem er ihm zurief: »Kahlkopf! Kahlkopf! Kahlkopf! He, he, he!«
Geschichte III
Einen armen Bauer traf ein großes Unglück: der Hagel richtete sein Feld so arg zu, daß kein einziger Halm ganz blieb. Der Bauer ging traurig bei seinem Felde um her, sein Zustand grenzte an Verzweiflung. Da begegnet ihm ein Bursche, der ihn anhält und fragt: »Wollt Ihr mich nicht als Knecht in euren Dienst nehmen?«
Der Bauer blickt ihn an und spricht: »Werde selbst nichts zu essen haben. Da sieh meine heurige Ernte!« und dabei zeigt er auf das vom Hagel heimgesuchte Feld. »Nehmt mich nur auf,« redet ihm der Bursche zu, »Ihr werdet es nicht bereuen.« Es war Rarasch. Der Bauer ließ sich endlich bereden und nahm ihn auf.
Als sie nach Hause kamen, sagte der Knecht: »Herr, ich will in die Mühle fahren!« - »Was willst Du denn mahlen? Habe ja kein Körnchen Getreide,« entgegnete der Bauer. - »Ihr habt auf der Emporscheune oben Stroh. Gebt mir nur zwölf Säcke.« - »Nun, wenn Du aus dem Stroh etwas heraus zu dreschen meinst, in Gottes Namen!«
Der Knecht ging, schnitt das Stroh zu Häckerling, füllte den Häckerling in die Säcke, lud diese auf den Wagen und fuhr. Es war schon spät Abends und hübsch dunkel, als er in die Mühle kam. Der Müller hatte auf dem Schüttboden zwölf in Säcke gefüllte Scheffel Getreide, das er den Mahlgästen weg gestohlen: er wollte damit Morgens auf den Markt. Rarasch schüttete das Getreide in seine Säcke, und in des Müllers Säcke schüttete er den Häckerling. Dann mahlte er, bezahlte das Mahlgeld und fuhr nach Hause.
Der Bauer hatte zwei Pferde; sie waren jedoch so schlecht, daß sie kaum die Füße schleppten. »Herr,« sagte eines Tages der Knecht zu ihm, »wollt Ihr für die Mähren nicht bessere Pferde kaufen?« - »Ei warum nicht!« entgegnete der Bauer, »aber wie?« - »Dafür laßt mich sorgen!« Der Bauer willigte ein.
Der Knecht ging, schlug die beiden alten Pferde tot und zog ihnen die Haut ab. Dann nahm er die Häute auf die Schulter und begab sich geraden Weges in das Wirtshaus. Es war schon Abend, als er hin kam. Im Wirtshaus gab es Lärm und Rauch genug, auf dem langen Tische brannte ein Licht, und dabei standen viele Gläser, volle und leere; bei dem einen saß der Lohgerber des Ortes.
»Kauft die Häute da!« sagte der Knecht zu dem Lohgerber. »Das möchte ich wohl, habe aber kein Geld bei mir.« - »Ich will mit Euch nach Hause gehen, wir wollen des Handels schon einig werden,« erwiderte der Knecht. Der Lohgerber erhob sich und ging.
Der Lohgerber hatte eine hübsche Frau, und wenn er des Abends nicht zu Hause war, pflegte sie der Herr Amtmann zu besuchen; die Lohgerberin briet ihm Hühner, ohne das ihr Mann davon wußte. Eben heute saß der Amtmann wieder bei ihr, als der Lohgerber außen an das Thor klopfte. »Wer ist es?« - »Ich bin es, mach auf!« Die Lohgerberin erschrak. »Um des Himmels willen, mein Mann!«
Der Amtmann sprang in den alten, leeren Schrank, die Lohgerberin versperrte ihn, zog den Schlüssel ab, steckte das Huhn in die Röhre und ging dann öffnen. Der Lohgerber trat ein, und musterte die Häute: »Nun, was ist der Preis?« - »Gebt mir da den alten Schrank dafür!« - »Wenn er euch recht ist, meinethalben!« - »Um des Himmels willen, Mann,« schrie die Lohgerberin, »gib nicht den alten Schrank her! Er ist ein Andenken der seligen Großmutter, der Segen kommt aus unserem Hause!« - »Wirst du schweigen?« donnerte der Lohgerber. »So viel Wesen mit dem alten Rumpelkasten!« Und der Bursche trug den Schrank davon.
Er trug ihn vor das Dorf bis auf die Brücke bei der Mühle. Die Mühlräder klapperten und das Wasser unter dem Wehr rauschte. Der Bursche stellte den Schrank auf die Brustlehne und sprach: »Du stehst nicht dafür, daß ich dich weiter trage.« Dann klopfte er an den Schrank: »He, Brüderchen, kannst du schwimmen?« Der Amtmann im Schrank begann zu bitten, er solle ihn hinaus lassen, er wolle ihm hundert Stück Dukaten geben.
»Her damit!« sagte der Bursche, öffnete den Schrank, und der Amtmann zählte ihm die Dukaten auf den Hut. »Danke Gott, daß du so wohlfeil weg gekommen,« sagte der Bursche, und strich das Geld zusammen. »Ein andermal krieche nicht in fremde Schränke, daß dir nichts Ärgeres widerfahre!« Der Herr Amtmann verschwor sich, das Haus des Lohgerbers in seinem ganzen Leben nie mehr zu betreten.
Hierauf nahm Rarasch den Schrank und trug ihn wieder zu dem Lohgerber. »Damit eurer Frau nicht das Herz weh tue,« sprach er, »so bringe ich den Schrank wieder. Ich hab' mich anders besonnen. Gebt mir lieber Geld, oder stellt mir die Häute zurück!« Der Lohgerber ward mit ihm Handels einig und ging in die Kammer, um das Geld zu holen.
»Die Schale ist rein, der Teufel hat den Kern geholt!« raunte der Bursche der Lohgerberin zu. - »Um des Himmels willen, Ihr habt ihm doch nichts angetan?« - »Nein, doch soll es geschehen,« sprach der Bursche, »wenn ihr den Schrank noch einmal vor eurem Manne versperrt.« Indessen kam der Lohgerber und zählte das Geld auf den Tisch.
»Fürwahr, ihr habt eine wackere Frau,« sagte der Bursche zu ihm. »Ich soll euch zu reden, ihr möchtet hübsch zu Hause bleiben und nicht ins Wirtshaus gehen; sie würde manchmal gern ein Hühnchen für euch braten. Heute hat sie eins für euch gebraten, fürchtet sich aber, ihr möchtet böse sein.« - »Hm, was sollte ich böse sein!« meinte der Lohgerber. - »Nun, so geht Frau, geht, und bringt ihm das Huhn aus der Röhre!« Die Lohgerberin mußte gehen und das Huhn bringen, das sie für den Amtmann gebraten.
Der Lohgerber war froh, daß seine Frau ihn so lieb habe, und nahm sich vor, nicht mehr ins Wirtshaus zu gehen; und die Lohgerberin war froh, daß sie so gut weg gekommen, und verschwor sich, niemals wieder für wen Hühner zu braten, ohne daß ihr Mann davon wüßte.
So verschaffte Rarasch dem Bauer Geld. Der Bauer kaufte sich junge Pferde, richtete seine Wirtschaft gehörig ein, und solang er den Burschen bei sich hatte, gebrach es ihm an nichts. Aber der Bursche war auch nicht wählerisch, er aß alles gern, was er bekam; nur Erbsen wollte er nicht essen, und zwar deshalb, weil auf jedem Erbsenkorn ein Kelch ist.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
PRINZ BAJAJA ...

Es war einmal ein König, dessen Frau ihm Zwillingssöhne gebar. Beide waren gesunde und muntere Burschen. Doch der eine fand sich besser als der andere in der Welt zurecht, und so blieb es auch, als sie heranwuchsen. Der Knabe der um einige Minuten älter war, hielt sich gern in der frischen Luft auf, rannte und sprang umher und ritt auf einem kleinen Pferd, das so alt war wie er. Der zweite Sohn liebte es, auf weichen Teppichen zu spielen. Wo die Mutter war, da war auch er. Er ging mit ihr im Garten spazieren, wagte sich aber niemals allein vor das Tor. Und so kam es mit der Zeit, daß die Mutter ihn seinem Bruder vorzog.
Auch als sie größer wurden, änderte sich nichts daran. Als der ältere Bruder siebzehn wurde, fühlte er sich wenig glücklich im Haus. Immer stärker erfüllte ihn der Wunsch, in die Welt zu gehen. Eines Tages vertraute er seinem Pferd an, daß er sein Vaterhaus verlassen wollte. "Zieh in die Welt, wenn du zu Haus nicht glücklich bist", sagte das Pferd mit menschlicher Stimme. "Brich allein auf und reite niemals ein anderes Pferd als mich. Das wird dir Glück bringen."
Der Prinz traute seinen Ohren kaum, als er sein Pferd mit menschlicher Stimme sprechen hörte, und er wollte wissen, wie dies möglich war. "Du tust besser daran, nicht solche Fragen zu stellen", sagte das Pferd. "Doch ich will dich beschützen und dir helfen, wenn du tust, was ich dir sage." Der Prinz versprach es und begab sich in das Schloß, um seinen Vater um Erlaubnis zu bitten. Zunächst wollte der Vater nichts davon hören, doch der junge Mann bestand auf seinem Plan, und schließlich gab der Vater nach. Er bestimmte ein großes Gefolge, das den Prinzen begleiten sollte, gab Befehle, die Pferde zu satteln.
"Ich brauche kein Gefolge", sagte der Prinz. "Ich will allein in die Welt ziehen, nur mein gutes Pferd soll mit." Dieser Wunsch gefiel dem König ganz und gar nicht, aber schließlich stimmte er zu. Es dauerte nicht lange, und der Prinz war reisefertig. Das Pferd wartete gesattelt am Tor, während der Prinz von seinen Eltern und dem Bruder Abschied nahm. Bald danach galoppierte der Prinz über ein weites Feld, weit von der Hauptstadt des Vaters entfernt. Es war kaum zu glauben, daß ein siebzehnjähriges Pferd so schnell laufen konnte. Aber dieses Pferd alterte nicht, denn es war kein gewöhnliches Pferd.
Sie legten Meile um Meile zurück. Der Prinz wußte nicht, wohin das Pferd ihn trug. Plötzlich sah er vor sich die Türme einer schönen Stadt aufragen. Das Pferd änderte seine Richtung, trabte über ein Feld und hielt vor einem Felsen an, der sich in der Nähe eines schönen Waldes befand. Als sie vor dem Felsen standen, schlug das Pferd mit seinen Hufen daran. Der Felsen öffnete sich, und das Pferd ritt mit dem Prinzen hinein. Es stellte sich heraus, daß der Raum ein bequemer Stall war.
"Ich werde hier bleiben", sagte das Pferd zu dem Prinzen. "Du mußt aber in die Stadt gehen und dich um einen Dienst am Hofe bemühen. Eins vor allem mußt du dabei beachten: Stell dich stumm, und vergiß das nicht. Wenn du mich brauchst, dann komm zu dem Felsen und klopfe dreimal an, Er wird sich öffnen, und ich werde immer hier sein, um dir zu helfen." Der Prinz dachte: Mein Pferd ist klug. Es muß am besten wissen, was zu tun ist. So nahm er seine Kleider und ging hinaus.
Bald kam er in die Stadt, ging zum Schloß und richtete es ein, daß ihn der König sah. Als er vor dem König stand, machte er sich durch Zeichen verständlich. Der König glaubte, einen Stummen vor sich zu haben, hatte Mitleid mit ihm und nahm ihn in seinen Dienst. Es dauerte nicht lange, und der König stellte fest, daß der neue Diener sich auf verschiedene Weise nützlich machte. Den ganzen Tag hatte er irgendwo im Schloß zu tun. Jeder liebte ihn. Da "Bajaja" das einzige Wort zu sein schien, das er als Antwort auf alle Fragen sprechen konnte, nannte man ihn"Bajaja".
Nun hatte der König drei anmutige Töchter. Die älteste hieß Zdobena, die zweite Budinka und die jüngste Slavena. Bajaja liebte es, seine Zeit in ihrer Gesellschaft zu verbringen. Der König hatte nichts dagegen. Bajaja war nicht nut taub, er hatte auch ein blasses Gesicht und trug eine Augenklappe. Er sah nicht gerade ansehnlich aus. Der König fürchtete nicht, daß sich eine seiner Töchter in ihn verlieben könnte. Doch die Prinzessinnen konnten ihn gut leiden, und wohin sie gingen, da ging auch er. Er machte Blumengebinde für sie, zog goldene Fäden in ihre Nadeln, er zeichnete sogar Vögel und Blumen zum Sticken. Am liebsten weilte er bei Slavena, der jüngsten Prinzessin. Ihre Schwestern bemerkten es, und sie neckten oft ihre Schwester damit. Da sie gutmütig war, nahm sie es ihnen nicht übel.
Bajaja war noch nicht lange im Schloß, als er eines Morgens das Frühstückszimmer betrat, wo der König gerade frühstückte. Bajaja bemerkte, daß der König betrübt war. Mit Hilfe von Zeichen erfuhr der junge Mann auch den Grund. Der König blickte ihn traurig an. "Mein lieber Junge", sagte er. "Hast du nicht von dem Unglück gehört, was uns bedroht?" Bajaja schüttelte seinen Kopf. "Du kannst uns zwar nicht helfen", fuhr der König fort, "trotzdem will ich dir erzählen."
"Vor vielen Jahren", begann der König seine traurige Geschichte, "wurde mein Land von drei furchtbaren Drachen verwüstet: Einer von ihnen hatte neun Köpfe, der zweite achtzehn und der dritte vierundzwanzig. Die Lage in meiner Stadt war hoffnungslos. Die Leute zitterten um ihr Leben. Nicht ein einziger Rinderkopf war weit und breit, denn alles Vieh war bereits den Ungeheuern gegeben worden in der Hoffnung, daß sie die Stadt und ihre Bewohner verschonen würden. Die Drachen kümmerte das wenig, sie töteten und verschlangen viele meiner guten Untertanen.
Als ich die Leute nicht mehr länger leiden sehen konnte, rief ich eine Hexe um Hilfe. Ich fragte sie, was zu tun sei, um die Drachen aus meinem Land zu vertreiben. Sie sagte, daß sie uns helfen könnte, doch ich hätte dafür einen furchtbaren Preis zu zahlen. Ich mußte ihr versprechen, meine drei kleinen Töchter zu opfern, wenn sie junge Mädchen wären. Mit schwerem Herzen stimmte ich zu, in der Hoffnung, daß es niemals dazu kommen würde. Die Königin starb vor Erschütterung, als sie davon hörte, doch meine Töchter wußten noch bis heute nichts davon.
Die Hexe hielt ihr Versprechen. Die Drachen verschwanden, und viele Jahre hörte man nichts von ihnen. Doch gestern brachten mir einige Schäfer eine Nachricht von der Hexe. Die Ungeheuer sind in ihre Höhle zurück gekehrt, wo sie fürchterlich brüllen. Ich unglücklicher Vater muß, um mein Leben zu retten, morgen mein erstgeborenes Kind in den Tod schicken. Ein Drache wird sie verschlingen. Am nächsten Tag wird dann meine zweite Tochter in den Tod gehen, und am dritten Tag wird die Jüngste sterben müssen."
Dies war die Geschichte, die der alte König Bajaja erzählte, während er sich seine Haare raufte. Betrübt begab sich Bajaja zu den Prinzessinnen. Sie waren ganz in Schwarz gekleidet, ihre Wangen waren bleich wie weißer Marmor. Unaufhörlich rannen Tränen aus ihren Augen, weil sie so einen grausamen Tod sterben sollten. Bajaja versuchte sie zu trösten. Er versuchte ihnen zu sagen, daß sicherlich ein Retter ihnen zu Hilfe kommen würden. Sie beachteten ihn kaum und weinten nur noch heftiger. Alle Leute in der Stadt waren betrübt, denn sie liebten ihre königliche Familie. Die Häuser und das Schloß waren schwarz behangen.
Heimlich eilte Bajaja über die Felder zu dem Felsen, wo er sein Pferd hatte. Dreimal klopfte er. Der Felsen öffnete sich, und Bajaja trat ein. Er streichelte die Mähne des Pferdes. "Ich bin gekommen, um dich um Hilfe zu bitten", sagte er zu dem Pferd. "Wenn du mir jetzt nicht helfen kannst, werde ich immer unglücklich sein." Dann erzählte er ihm die ganze traurige Geschichte. "Ich weiß all das bereits", sagte das Pferd. "Um in Wahrheit zu sagen, ich habe dich hier her gebracht, damit du den Prinzessinnen helfen kannst. Geh nun und komm morgen wieder zurück. Dann will ich dir alles sagen, was du wissen mußt."
Überglücklich lief Bajaja in das Schloß zurück. Leute hätten es ihm übel nehmen können, wenn sie ihn so glücklich gesehen hätten. Doch glücklicherweise bemerkte ihn niemand. Er verbrachte den ganzen Tag mit den Prinzessinnen in ihrem Zimmer und bemühte sich nach Kräften, ihnen Trost zu spenden; doch alles vergeblich. Am nächsten Morgen war er schon bei Sonnenaufgang am Felsen. Das Pferd begrüßte ihn und sagte: "Heb den Stein unter meiner Krippe auf. Nimm heraus, was du dort findest."
Aus der Höhlung unter dem Stein holte Bajaja eine große Nuß hervor. Das Pferd hieß ihn, sie zu öffnen, und Bajaja machte sie auf. In der Nuß fand er drei herrliche Rüstungen, ein Schwert und Zaumzeug. Eine Rüstung war scharlachrot, mit Diamanten und Silber ausgelegt. Sie war aus bestem Stahl gearbeitet. Dazu gehörte ein rot weißer Helmbusch. Die zweite Rüstung war vollkommen weiß und mit Gold geschmückt. Der Helm war golden und der Federbusch weiß. Die dritte war blau wie der Himmel und reich mit Silber, Diamanten und Perlen verziert. Dazu gehörte ein weiß blauer Federbusch. Ein mächtiges, mit kostbaren Edelsteinen ausgelegtes Schwert mußte getragen werden, egal welche Rüstung angelegt wurde.
"Diese drei Rüstungen sind für dich", sagte das Pferd. "Am ersten Tag mußt du die scharlachrote Rüstung tragen." Bajaja legte die scharlachrote Rüstung an, gürtete sein Schwert und legte seinem Pferd das Zaumzeug an. "Fürchte dich nicht", sagte das Pferd, als sie aus dem Felsen ritten. "Was auch immer geschieht, laß dich nicht aus dem Sattel werfen! Verlaß dich auf dein Schwert und schlage drauf los."
In der Zwischenzeit hatte man sich auf dem Schloß viele Male Lebewohl gesagt. Viele Leute begleiteten die unglückliche Zdobena aus der Stadt. Als die Prinzessin zu dem schrecklichen Platz kam, wurde ihr klar, daß sie in den Tod ging, sie stürzte ohnmächtig zu Boden. In diesem Augenblick sah man ein kleines Pferd herbei galoppieren. Darauf saß ein Reiter in einer scharlachroten Rüstung, mit einem rot weißen Helmbusch. Er befahl, die Prinzessin weg zu führen. Auch die Leute sollten sich entfernen, denn er wünschte, dem Drachen allein zu begegnen. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie gern jeder dem Befehl nachkam, außer Prinzessin Zdobena, die sehen wollte, wie die Sache auslief.
Die Leute rannten von dem Platz und stiegen auf einen nahe gelegenen Hügel. Sie hatten kaum den Gipfel erreicht, als sich der Felsen auf tat, indem die Drachenhöhle war. Das neun Köpfige Ungeheuer stampfte auf den Platz und spähte nach seinem Opfer. Im Nu hatte Bajaja sein Schwert gezogen und schlug mit einem Hieb die Köpfe des Drachens ab. Das Ungeheuer krümmte sich, spie Feuer und warf sich hin und her, so daß sein Gift über den ganzen Platz spritzte. Aber der Prinz achtete nicht darauf. Er schlug weiter zu, bis er die neun Köpfe vom Körper des Ungeheuers abgetrennt hatte. Die Pferdehufe taten ihr übriges dazu.
Als der Drache tot da lag, wendete der Prinz sein Pferd und ritt zurück. Bewundernd blickte Zdobena hinter ihm her, doch dann fiel ihr ein, daß ihr Vater auf sie warten würde. Und so eilte sie zum Schloß. Die Leute, die den Kampf vom nahen Hügel beobachtet hatte, folgten ihr. Wer beschreibt die Freude ihres Vaters, als er seine Tochter wieder sah, und die Freude ihrer Geschwister, die nun hofften, daß auch sie gerettet werden könnten. Bajaja gesellte sich wieder zu den Prinzessinnen. Mittels Zeichen bedeutete er ihnen, daß sie auf Gott vertrauen sollten, der ihnen wieder ein Retter schicken würde. Obwohl sie noch voller Sorge waren, was die nächsten Tage für sie bringen würden, wurden sie ein wenig aufgeheitert.
Am folgenden Morgen wurde Budinka zu dem Felsen gebracht. Alles war so, wie am vergangenen Tag. Kaum hatte die Prinzessin, die von einer großen Menschenmenge begleitet wurde, den Felsen erreicht, als wieder der Ritter erschien. Dieses Mal hatte er eine weiße Rüstung angelegt, und trug einen weißen Helmbusch. Im Nu hatte er den achtzehn Köpfigen Drachen getötet. Dann ritt er davon wie am ersten Tag. Als Budinka zu dem Schloß zurückkehrte, bedauerte sie, dem Ritter nicht gedankt zu haben.
"Schwestern", sagte da Slavena, als die drei Prinzessinnen sich unterhielten, "ich weiß, warum der Ritter immer verschwindet. Ihr habt ihn noch niemals gebeten, mit euch nach Haus zu kommen. Doch ich werde vor ihm nieder knien und so lange flehen, mit mir heimzukommen, bis er meinen Wunsch erfüllt." "Warum lachst du, Bajaja?" fragte Zdobena, als sie den stummen Diener lachen sah. Bajaja gab ihr zu verstehen, daß er darauf wartete, dem Ritter zu begegnen. "Du Narr", schrie Zdobena, "er ist noch nicht gekommen."
Am dritten Tag wurde Slavena zu dem Felsen geführt, um ihrem Schicksal zu begegnen. Diesmal begleitete der König selber seine Tochter. Ihr Herz schlug schnell bei dem Gedanken, daß sie dem Drachen geopfert werden könnte, wenn kein Retter erschiene. In diesem Augenblick jedoch ertönte ein Freudenschrei. Der Ritter sprengte herbei. Wie an den zwei vergangenen Tagen, tötete Bajaja den Drachen. Danach kam der König und Slavena zu dem Ritter und bedrängten ihn, mit ihnen zum Schloß zurück zu kehren. Slavena kniete sogar vor ihm nieder. Des Prinzen Herz schlug schneller, als sie seine Rüstung berührte. Aber das Pferd galoppierte davon, und der Ritter war bald aus ihren Augen verschwunden. Slavena kehrte mit ihrem Vater nach Haus zurück. Sie war von Herzen traurig, weil sie ihrem Retter nicht danken konnte. Jeder im Schloß bedauerte es, den Ritter nicht begrüßen zu können.
Nun, da die Drachen tot waren, war jedermann wieder glücklich. Aber es blieb nicht lange so. Bald kam ein anderes Unglück über das Land. Eines Tages erfuhr der König, daß ein benachbarter Herrscher ihm den Krieg erklärt hätte. Der König war in großen Sorgen, denn er wußte, daß die feindliche Armee der seinen überlegen war. Deshalb schickte er Sendboten aus, die seine Ritter zu einer Versammlung zusammenrufen sollten.
Der König erklärte ihnen die schwierige Lage, in der er sich befand. Er bat sie um ihre Hilfe und versprach dafür, ihnen seine Töchter zur Ehe. Wer konnte da zaudern bei solch einer Belohnung? Alle versprachen, dem König zu helfen. Jeder brachte so viele Soldaten mit, wie er nur konnte, und der König stellte sich an die Spitze seiner Armee. Am Tage vor der Schlacht wurde im Schloß ein Essen gegeben. Alle Edelleute waren versammelt. Danach nahm der König von seinen weinenden Töchtern Abschied und befahl Bajaja, auf sie aufzupassen.
Unter den Klängen von Pfeifen und Trompeten ritt der König auf das Schlachtfeld. Bajaja tat, wie ihn der König geheißen hatte. Er sorgte sich um alles und ließ auch die Prinzessinnen nicht aus seinen Augen. Aber plötzlich teilte er ihnen mit, daß er krank sei. Die Hilfe eines Arztes lehnte er jedoch ab, meinte vielmehr, daß er sich nach einigen Heilkräutern um Wald umsehen würde. Die waren besser als des Arztes Medizin. Die Prinzessinnen befanden sein Benehmen ziemlich seltsam.
Aber Bajaja dachte keineswegs daran, nach Kräutern zu suchen. Stattdessen begab er sch zu seinem Pferd, um es um Hilfe zu bitten, denn er wollte dem König in diesem Krieg Beistand leisten. Das Pferd befahl ihm, die weiße Rüstung anzuziehen und das Schwert zu gürten, damit sie in den Kampf reiten konnten. Der Krieg hatte schon mehrere Tage gedauert, und das Heer des Königs kam ins Wanken, denn es konnte den überlegenen Kräften des Feindes nicht widerstehen. Am folgenden Tag sollte die entscheidende Schlacht stattfinden.
Die ganze Nacht hindurch erteilte der König Befehle, und er sandte auch Boten an seine Töchter, die ihnen Anweisungen für den Fall der Niederlage überbrachten. Am Morgen befahlen die Männer ihre Seelen Gott und reihten sich in die Schlachtordnung ein. Trompeten erklangen, Waffen klirrten, Pfeile flogen. Geschrei und Lärm hallten durch das weite Tal. Plötzlich erschien ein Ritter in weißer Rüstung in den Reihen, der einen Goldhelm mit einem weißen Federbusch trug. Er ritt ein kleines Pferd und hielt ein mächtiges Schwert in der Hand, mit dem er eine kleine Gasse in die Reihen des Feindes schlug, so daß diese dachten, der Teufel sei in ihrer Mitte erschienen.
Als die Soldaten des Königs ihn erblickten, sammelten sie sich um ihn herum und fochten Seite an Seite mit dem tapferen Ritter. Es dauerte nicht lange, da schlugen sie die feindlichen Soldaten in die Flucht. Nachdem der weiße Ritter ihren Anführer getötet hatte, zerstreuten sich die Feinde wie eine Herde ohne Hirten. Aber der Reiter in der weißen Rüstung wurde leicht an seinem Fuß verwundet, so daß sein Blut zu Boden tropfte. Sobald der König es bemerkte, sprang er vom Pferd und riß ein Stück von seinem Kleid ab, um die blutende Wunde mit eigener Hand zu verbinden. Er bat den Ritter, ihm in sein Zelt zu folgen. Doch der Ritter wandte sein Pferd und war blitzschnell verschwunden. Der König war sehr bekümmert, weil der Ritter, dem er soviel schuldig war, das vierte Mal davon geritten war.
Der siegreiche König kehrte mit reicher Beute heim. In seiner Hauptstadt wurde er mit großem Jubel empfangen. Vielerlei Feierlichkeiten fanden statt. "Haushofmeister", wandte sich der König an Bajaja, "hast du dich während meiner Abwesenheit um meine Angelegenheiten gekümmert?" Bajaja nickte, um zu sagen, daß er dem Befehl entsprochen habe, aber die Prinzessinnen begannen laut zu lachen. "Ich muß mich über deinen Haushofmeister beklagen, mein Vater", sagte Slavena. "Er wurde krank, und der Arzt wollte ihm eine Arznei verordnen, doch er ging aus dem Haus und sah sich nach irgendwelchen Kräutern um. Und als er nach zwei Tagen zurück kam, humpelte er und sah sehr erschöpft aus."
Der König wandte sich an Bajaja, der lächelte und sich auf seinen Hacken drehte, als ob er sagen wollte, daß die Sache nicht so schlimm sei. Die Prinzessinnen erfuhren dann, daß ihr Retter ihrem Vater geholfen hatte, die Schlacht zu gewinnen. Sie wollten deshalb auch nicht einen Ritter ihres Vaters zum Mann nehmen, da es möglich war, daß der Unbekannte erscheine und eine von ihnen auswählen könnte. Natürlich wußten sie nicht, ob er häßlich oder schön war, denn sein Gesicht war immer behelmt. Doch sie stellten sich vor, daß er schmuck sei.
Der König wußte nicht, wem er die Belohnung geben sollte, die er seinen Edelleuten versprochen hatte. Sie hatten ihm alle nach besten Kräften geholfen. Alle hatten tapfer gekämpft, Welchen sollte er nun seine Töchter geben. Da kam ihm ein Gedanke, und er wandte sich an seine Ritter: "Freunde", sagte er zu ihnen, "ich habe versprochen, meine Töchter denen zu geben, die am tapfersten kämpften. Nun ist es schwer zu entscheiden, wer diese Belohnung verdient. Ich will deshalb sagen, wie ich in dieser Angelegenheit verfahren will. Stellt Euch in einer Reihe auf dem Schloßhof vor dem Balkon auf, hinter dem sich die Räume meiner Töchter befinden. Jede wird einen goldenen Apfel vom Balkon werfen. Jede wird den Mann heiraten, vor dessen Füße der Apfel rollt. Seid Ihr einverstanden mit dieser Lösung?"
Alle stimmten zu. Der König unterrichtete die Prinzessinnen über seine Entscheidung. Sie fügten sich, denn es fiel ihnen nichts ein, wie sie ihren Vater veranlassen könnten, sein Wort zurück zu nehmen. Sie kleideten sich in ihre schönsten Gewänder, nahmen die goldenen Äpfel und begaben sich auf den Balkon, unter dem die Bewerber warteten. Unter den Zuschauern und Begleitern stand auch Bajaja in seinen abgetragenen alten Kleidern, und mit der Klappe über dem Auge. Als erste war Zdobena an der Reihe. Der Apfel rollte bis dicht vor die Füße Bajaja, doch er stieß ihn an, so daß der Apfel weiter kullerte und vor den Füßen eines schmucken Ritters liegen blieb.
Dann warf Budinka ihren Apfel, der erneut bei Bajaja zu Boden fiel. Doch wieder brachte er den Apfel, geschickt in Bewegung, er rollte und hielt bei einem Edelmann. Der hob ihn auf und sah mit einem Lächeln seine hübsche Braut an. Dann war Slavena an der Reihe, den Apfel zu werfen. Dieses Mal aber stieß Bajaja den Apfel nicht an. Im Gegenteil! Er hob ihn auf, lief zu dem Balkon hinauf, kniete vor der Prinzessin nieder, und küßte ihre Hand. Doch sie floh in ihr Zimmer und weinte bitterlich, denn sie wollte den stummen Jüngling nicht zum Gemahl.
Der König war ärgerlich, und die Ritter lachten, doch was geschehen war, war nun mal geschehen. Ein Festessen wurde veranstaltet, und als es vorbei war, sollte ein Turnier statt finden. Eine von den Prinzessinnen würde die Preise überreichen. Während des Essens sprach Slavena kaum ein Wort. Ihr Bräutigam Bajaja war verschwunden, und der König nahm an, er wäre fort gelaufen, weil er gekränkt worden war. Jeder fühlte mit dem unglücklichen Mädchen; um sie zu trösten, bat man sie, die Preise zu überreichen. Slavena war danach nicht zumute, doch am Ende willigte sie ein.
Das Turnier hatte bereits begonnen, als bekannt wurde, daß der Ritter auf dem kleinen Pferd am Schloßtor wartete und um Teilnahm an dem Turnier bat. Der König gab seine Zustimmung. Der Ritter sprengte auf seinem kleinen Pferd auf den Kampfplatz. Er trug seine blaue, mit Silber verzierte Rüstung mit dem weiß blauen Federbusch auf dem silbernen Helm. Die Prinzessinnen erkannten sogleich den Ritter wieder, der sie von den Drachen befreit hatte.
Er focht mit den Rittern, die sich auf der Kampfbahn befanden, und einen nach dem anderen fegte er in den Sand, so daß er zum Sieger erklärt wurde. Slavena schritt ihm entgegen und überreichte ihm eine goldene Schärpe, die sie selbst gestickt hatte. Der Ritter beugte seine Knie vor ihr, so daß sie ihm die Schärpe um den Nacken legen konnte. Ihre Hände zitterten dabei, und ihre Wangen glühten. Sie schlug ihre Augen nieder, als sie die süßen Worte hörte: "Meine liebe Braut, noch heute komme ich zu dir." Der König und seine zwei anderen Töchter kamen herbei, um ebenfalls dem Ritter zu danken, aber er war bereits aufgesessen und davon geritten. Slavena kehrte in ihr Zimmer zurück, um über die Worte nach zu denken, die der Ritter ihr ins Ohr geflüstert hatte.
Als der Mond am Himmel stand, trug ihn das Pferd zu dem Schloß. Bajaja sprang ab und küßte Nacken und Zaum des Pferdes, und dann war es verschwunden. Der Prinz war traurig, sich von seinem Pferd zu trennen, doch andere, wunderbare Dinge warteten auf ihn. Tief in Gedanken versunken, saß Slavena in ihrem Zimmer und fragte sich, ob der Ritter zurück kehren würde, wie er es versprochen hatte. Bald klopfte es an der Tür. Es war das Mädchen, das kam, um ihr zu sagen, daß Bajaja die Prinzessin zu sehen wünschte. Slavena barg das Gesicht in ihren Händen. Doch als sie ihren Kopf hob, sah sie den stattlichen Ritter, ihren Retter.
"Ärgert Ihr Euch über Euren Bräutigam?" fragte Bajaja zärtlich. "Warum fragt Ihr mich das?" flüsterte sie. "Ihr seid nicht mein Bräutigam." "Doch, das bin ich", erwiderte Bajaja. "Ich bin der stumme Bajaja, der Blumen für Euch band. Ich war es, der Euch vor dem Drachen rettete und Eurem Vater in der Schlacht half. Ich bin es, der Euer Bräutigam ist." Ihr könnt euch selber vorstellen, wie Slavena zumute war. Nach einer Weile kehrte sie in den Festsaal zurück, wo die Gäste zusammen saßen und zechten. Sie war in Begleitung des Ritters, der eine weiße Rüstung und den goldenen Helmbusch trug. Sie stellte ihrem Vater und allen Gästen ihren Bräutigam vor - Bajaja. Der Vater war überglücklich, die Gäste staunten, und die Festlichkeiten begannen noch einmal.
Bald heirateten Slavena und Bajaja. Nach ihrer Hochzeit reiste das Paar in Bajajas Heimatland. Seine Eltern freuten sich, ihn wieder zu sehen, und auch seine junge Frau herzlich willkommen. Nach seines Vaters Tod wurde Bajaja König. Er lebte glücklich mit seiner Frau, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch.
Quelle: Bozena Nemcova, Tscheslowakei
DER HEILAND UNTERWEGS (Vier Geschichten) ...
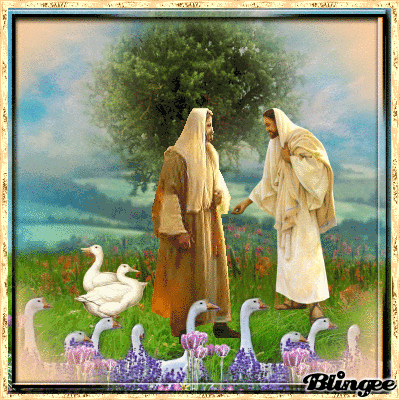
Geschichte I
Zu jener Zeit als der Herr mit den heiligen Petrus auf Erden wandelte, begegnete ihnen allerlei auf ihren Wegen. Einst zu später Stunde kamen sie in ein Dorf, wo ihnen lange niemand ein Nachtlager geben wollte, bis sie einen Bauer trafen, der sie aufnahm.
Er befahl, Stroh für sie in der Scheuer zurecht zu machen, und ehe sie schlafen gingen ließ er ihnen ein gutes Nachtmahl auftragen. Das gefiel Petrus, der sich ärgerte, daß sie niemand hatte aufnehmen wollen, und er fand kein Ende, den Bauer zu preisen. »Wenn Du lobst, lob nicht zu sehr!« sprach der Herr -
Kaum daß es dämmerte, kamen die Drescher in die Scheuer. Petrus erwachte aus dem süßen Schlaf und es verdroß ihn, daß ihn der Bauer so zeitig störe. »He, ihr beiden,« rief der Bauer, »auf, kommt uns helfen! Wer essen will, muß auch arbeiten.« Aber Petrus rührte sich nicht, um so weniger, als ihm schien, daß der Herr noch fest schlafe.
Die Drescher machten sich an die Arbeit. Als sie dreimal in die Runde gedroschen, sagte der Bauer: »Sollen wir die Faulenzer schlafen lassen? Haben sie sich satt gegessen, sollen sie uns auch arbeiten helfen. He, streich einer den vorn mit dem Dreschflegel!« Petrus lag am Rande, und bekam eins auf den Rücken. Aber er muckste nicht, um so weniger, da ihm der Herr noch fest zu schlafen schien.
»Nun, Die haben einen festen Schlaf!« meinte der Bauer, und drosch weiter. Da flüsterte der Herr zu Petrus: »Petrus, rücke still an meine Stelle herüber, sonst könntest du zum zweiten Mal eins bekommen.« Petrus tat es sehr gern, denn ihn schmerzte noch der Rücken von dem Schlage. »Ei das sind ja Stöcke!« schrie der Bauer. »Wenn der Donner neben ihnen in die Erde führe, würden sie noch nicht hören. Wartet, ich will mit meinem Dreschflegel den hinten dort streichen!« Wie gesagt, so getan.
Da Petrus an des Herrn Stelle lag, bekam er wieder eins, und zwar ein Derbes. Er sagte nichts, aber er dachte bei sich: »Es wäre doch eine schöne Sache, wenn der Mensch alles voraus wüßte; er könnte manches vermeiden.« Hierauf erhob sich der Herr vom Lager, und Petrus mit ihm, und der Herr segnete den Bauer, daß dieser doppelt so viel Körner drosch.
Unterwegs tadelte Petrus den Herrn, daß er ihn gesegnet, und schalt heftig auf den Bauer der zwei Schläge wegen. Da sprach der Herr: »Petrus, du hast Schläge wohl verdient; einen um den Wirt, weil Du undienstfertig warst, und den anderen um mich, weil Du selbstsüchtig warst. Wenn Du schiltst, schilt nicht zu sehr!«
Geschichte II
Als sie in ein andres Dorf kamen, hungerte sie, und der Herr sprach: »Petrus, gehe und kaufe Milch!« - »Keine Milch, Herr, lieber Käslein,« bat Petrus, der die Käslein gern aß. - »Es geschehe nach deinem Willen. Hier hast Du Geld, kaufe drei Käslein!«
Petrus ging in ein Haus, und kaufte drei Käslein. Eins verzehrte er sogleich, kehrte dann nach einer Weile zurück und brachte nur zwei. »Wo ist das dritte Käslein?« fragte der Herr. Petrus tat, als ob er es nicht hörte, und sie gingen weiter.
Sie kamen in einen Wald, wo sie ausruhten. Da sprach der Herr zu Petrus: »Petrus, ich habe kein Geld mehr, und wir werden dessen bedürfen. Hier unter dem Baum, auf dem wir sitzen, liegt ein Schatz. Nimm eine Stange, schaffe den Baumstock heraus, und hebe den Schatz.«
Petrus war so gleich an der Arbeit, und als er den Baumstock heraus geschafft, fand er in der Tat einen Schatz von lauter Goldmünzen. Er nahm die Goldmünzen und legte sie auf einen Haufen vor den Herrn. Der Herr zählte die Goldmünzen, und machte drei gleich große Häuflein; eins gab er Petrus, eins behielt er für sich, und eins ließ er liegen.
»Wem gehört denn das dritte Häuflein, Herr?« fragte Petrus. - »Das gehört dem, der das dritte Käslein gegessen.« Schnell war Petrus mit dem Geständniß heraus: »Herr, das dritte Käslein hab ich gegessen.« Aber der Herr sah ihn mit ernstem Blicke an und sprach: »Petrus, du bekennst dich nicht zu dem Käslein, sondern zu dem Gelde. Im Gelde steckt der Satan. Gehe, nimm all das Geld und vertheile es unter die Armen!«
Petrus errötete über und über; er nahm das Geld, und tat, wie ihm der Herr befohlen.
Geschichte III
Einst ging Petrus, ganz in Gedanken vertieft, neben dem Herrn einher, bis er plötzlich zu ihm sagte: »Es muß doch eine schöne Sache sein, Herrgott zu sein! Wenn ich nur einen halben Tag Herrgott wäre, dann wollte ich wieder Petrus sein!« - Der Herr lächelte und sprach: »Es geschehe nach deinem Willen. Sei Herrgott von jetzt an bis zum Abend!«
Eben näherten sie sich einem Dorfe, aus welchem ein Bauernmädchen eine Herde Gänse trieb. Als es sie auf die Wiese getrieben, ließ es sie dort, und eilte in das Dorf zurück. »He, willst Du die Gänse allein lassen?« fragte Petrus das Mädchen. »Was, ich soll heut die Gänse hüten? Wir haben heut Kirchweihe,« versetzte das Mädchen.
»Und wer soll denn die Gänse hüten?« fragte Petrus weiter. »I, heut muß sie der liebe Herrgott hüten!« entgegnete das Mädchen, und eilte fort. »Petrus« sprach der Herr: »Du hast es vernommen, Gern wäre ich mit dir in das Dorf zur Kirchweihe gegangen; allein die Gänse könnten verunglücken, und du bist Herrgott bis zum Abend, du mußt sie hüten.« Was blieb Petrus übrig? Er machte zwar ein verdrießliches Gesicht, gleich wohl mußte er die Gänse hüten; aber er schwor sich, niemals wieder Herrgott sein zu wollen.
Geschichte IV
Einst kamen sie spät Abends in ein Dorf. Der Herr wollte in einer armseligen Hütte nur ein Nachtlager ersuchen; allein Petrus bat, sie möchten doch in eines der stattlichen Häuser gehen, wo Überfluß wäre. Der Herr hielt ihn nicht ab und ließ ihn gehen; er selbst blieb vor der armseligen Hütte sitzen.
Petrus ging in das Haus das von allen das stattlichste war. »Hier ist Überfluß, hier werden wir ein gutes Nachtmahl und ein gutes Nachtlager bekommen!« dachte Petrus; allein er irrte sich. Die Bäuerin fertigte ihn barsch ab: sie koche nicht für Landstreicher und habe für solche kein Nachtlager!
Petrus ärgerte sich, doch ließ er sich nicht abschrecken, er ging in das zweite Haus, wurde aber dort gleichfalls weg gewiesen, und ebenso im dritten. Voll Verdruß kehrte er endlich zu dem Herrn zurück. »Komm, versuchen wir es in dieser Hütte« sprach der Herr und beide traten ein.
Sie fanden ein Weib mit ihren Kindern eben beim Essen. Überall war die Armut sichtbar. »Da werden wir gut ankommen, das Weib hat ja selbst nichts!« dachte Petrus, allein er irrte sich. Als der Herr um Nachtmahl und Nachtlager bat, erwiderte das Weib, eine Witwe: »Wenn Ihr mit dem vorlieb nehmt, was ich habe will ich Euch gerne bewirten.«
Der Herr war mit allem zufrieden, und die Witwe stand auf und ging hinaus, und es währte nicht lange, so brachte sie ihnen in einer Schüssel Suppe. Sie entschuldigte sich, daß die Suppe nicht fett genug sei, sie würde sie gern fetter gemacht haben, allein sie habe kein Öl. »Petrus, zähle die Augen, die auf der Suppe schwimmen!« sprach der Herr.
Petrus zählte die Augen; es waren ihrer mehr als sechzig, nur oberflächlich gezählt. Als sie gegessen hatten und sich auf den Boden begeben sollten, wo ihnen die Witwe ein Lager zurechtgemacht, zählte der Herr so viel Goldmünzen auf den Tisch, als Augen auf der Suppe geschwommen, und schenkte sie der Witwe. Die Witwe wußte nicht, was vor Freuden anzufangen.
Zeitig Morgens ging sie in das benachbarte stattliche Haus, um Milch zu holen, damit sie den Reisenden ein gutes Frühstück bereiten konnte, und erzählte da der Bäuerin, wie reich sie die Reisenden für eine schlechte Suppe belohnt hätten; daß sie ihr so viel Goldmünzen gegeben, als Augen auf der Suppe geschwommen.
Die Bäuerin war geldgierig. Sie sagte da her der Witwe, sie möchte für die Reisenden nichts kochen; sie selbst wolle die Reisenden laden, sie habe alles im Überfluß, und könne ihnen eine bessere Suppe bereiten. Als dies die Witwe Petrus und dem Herrn es sagte, sprach der Herr: »Petrus, komm!«
Sie gingen in das Haus der Bäuerin von den Danksagungen der Witwe begleitet. Die reiche Bäuerin bereitete ihnen eine recht fette Suppe. »Haben sie die schlechte Suppe so gut bezahlt wie werden sie erst die gute Suppe bezahlen!« dachte sie. -
»Petrus, zähl die Augen, die auf der Suppe schwimmen!« sprach der Herr. - »O Herr« rief Petrus, dem die Suppe überaus schmeckte, »die Suppe ist so gut, daß all das Fett auf ihr in ein einziges Auge zusammen fließt. Die Bäuerin verdient, daß du sie doppelt so reich belohnst.« Als sie gingen, schenkte der Herr der Bäuerin nur eine Goldmünze. Die Bäuerin war unzufrieden, allein der Herr gab ihr nicht mehr. »Wie viel Augen, so viel Goldmünzen.«
Unterwegs tadelte Petrus den Herrn, aber der Herr sprach: »Petrus, nicht die Größe der Gabe macht ihren Wert, sondern die Absicht, die der Geber hat. Wahrlich, die schlechte Suppe der armen Witwe war sechzig Mal mehr Wert, als die gute Suppe der reichen Bäuerin.«
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
WER HAT DIE TAUBEN GEGESSEN? ...

Ein Schusterweib briet zwei junge Tauben, eine für sich und eine für ihren Mann, briet sie fein goldgelb, stellte sie auf den Ofen, und ging hinaus. Der Schuster schusterte indeßen. Zeitweilig erhob er seinen Schmecker, und sog den lieblichen Duft in sich, der sich rings im Zimmer verbreitete.
Endlich übte der Duft eine solche Gewalt auf ihn, daß er sich nicht länger auf seinem Stuhle halten konnte. Kaum hatte sein Weib den Fuß vor die Türe gesetzt, so war er von seinem Stuhle auf, und bei der Pfanne. Bevor er jedoch nach einem Täublein griff, lauschte er, ob sein Weib nicht in der Nähe sei, und dies aus dem Grunde, weil er sich vor seinem Weibe fürchtete. Er leugnete es zwar, doch war es so.
Draußen war alles still, und der Schuster zog in aller Geschwindigkeit ein Täublein aus der Pfanne, und verspeiste es. Der Naschhafte hat genug am Lecken, der Hungrige am Satt essen, ist ein altes Sprichwort. Aber der Schuster war naschhaft und hungrig zugleich, darum begnügte er sich nicht mit einem Täublein, sondern machte sich ohne weiteres Bedenken auch über das zweite her, und aß es auf.
Hierauf setzte er sich auf seinen Dreifuß und schusterte fort. Sein Weib kam in die Stube, und weil es eben Mittag war, stellte es die Teller auf den Tisch, und trug das Essen auf. Alles ging in der Ordnung; als es jedoch zum Braten kam, entstand ein Sturm. »Wer hat die Tauben gegessen?« hallte der erste Donnerschlag. »Mich frage nicht, ich nicht, habe ja gar nicht gewußt, daß Du welche brätst,« ertönte es zur Antwort, und so ging es in einem fort, Frage auf Frage, Antwort auf Antwort.
Der Schuster bekannte nichts, bis er zuletzt sagte, sein Weib müsse die Tauben selbst gegessen haben. »Nun gut, lassen wir das Streiten! Aber von jetzt an reden wir keiner mit dem anderen. Wer zuerst den Mund auf tut, der ist schuldig, der hat die Tauben gegessen!« So entschied des Schusters Weib, und bei dem Ausspruch mußte es bleiben.
Von dem Augenblicke an, war es in des Schusters Hause still. Es verdroß beide genug; das Weib des Schusters konnte nicht zanken und klatschen, dem Schuster war schwer ums Herz, daß er nicht antworten und singen konnte, und lieber hätte er sein Weib zanken hören, als daß er diese Todesstille ertragen mußte. Doch zu reden anfangen wollte trotzdem keiner von beiden.
Schon wars der dritte Tag, seit sie zum letzten Male mit einander geredet, als ein Wagen bei ihrem Häuschen hielt, der Bediente herab sprang, und nach dem Wege zur Stadt fragte. Bereits hatte des Schusters Weib den Mund geöffnet, um zu antworten, aber plötzlich setzte sie sich wieder, und zeigte nur mit der Hand, nach welcher Seite sie fahren sollten, und der Schuster tat dasselbe.
Als der Bediente zurück kam, berichtete er seinem Herrn, in dem Häuschen seien zwei Stumme. Zugleich lief des Schusters Weib, das etwas ausgesonnen, aus dem Häuschen, und kroch zu dem Herrn in den Wagen, indem es ihm zu verstehen gab, daß es ihm den Weg zeigen wolle. Der Herr machte Platz, der Kutscher schnalzte, und sie fuhren fort.
Da schrie der Schuster aus dem Fenster: »Weib, mein liebes Weib, fahre mir nicht weg, und verzeih mir! Die Tauben habe ich gegessen.« Das Weib brach in ein Gelächter aus, und erzählte nun dem Herrn die ganze Geschichte. Der Herr lachte herzlich, und gab dem Schustersweib einen Dukaten, damit es andere Tauben zum Braten kaufe. Von diesen jedoch bekam der naschhafte Herr Ehegemahl nicht den kleinsten Bissen.
Tschechien: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz

BESTRAFTER STOLZ ...
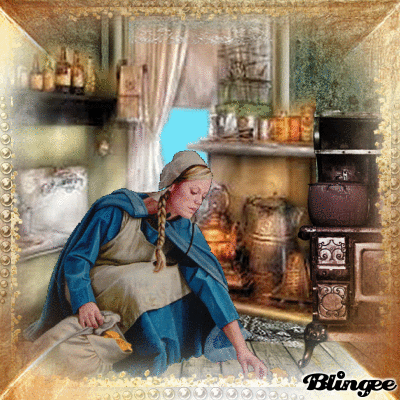
Es war einmal ein König, der hieß Miroslaw und wollte gern heiraten. Unter den vielen Bildern, die er von Prinzessinnen und Fürstinnen erhalten hatte, befand sich eines von solcher Schönheit, daß er auf den ersten Blick für diese Prinzessin in Liebe entbrannte und keine andere zur Königin haben wollte. Deshalb ließ er alle Maler seines Reiches in sein Schloß rufen, denn er wollte ihr sein Bild senden und sie zugleich um ihre Hand bitten.
Eifrig machten sich die Künstler an die Arbeit. Bald waren mehrere Bilder des Königs in einem schönen Saal aufgestellt, und Miroslaw ging mit seinen Ratgebern dorthin, um festzustellen, welches wohl am besten zur Absendung geeignet wäre. "Ich glaube, gnädigster König", sagte einer der Höflinge, "keines dieser Bilder kann einem Vergleich mit dem Gesicht Eurer Majestät stand halten." - "Ich glaube, die Prinzessin, ist nicht böse, wenn ich in Wirklichkeit ein wenig hübscher bin als mein Bild."
Der König wählte nun jenes Bild aus, das ihm am wenigsten gefiel, ließ es in einen goldenen Rahmen setzen, der mit kostbaren Steinen verziert war, und schickte die angesehensten Edelleute mit großer Gefolgschaft und wertvollen Geschenken zum Vater der schönen Prinzessin, um deren Hand zu erbitten. Voll Sehnsucht erwartete er ihre Rückkehr. Doch als die Abgesandten nach einer Woche wieder eintrafen, waren sie traurig und verdrossen.
"O Herr und König", sagten sie, als sie vor Miroslav traten, - "unerhört ist die Beleidigung die uns widerfahren ist, und wir scheuen uns, Eurer Majestät alles aufzudecken." "Sprecht frei und ohne Furcht!" gebot Miroslav. "Von dem König wurden wir gastlich aufgenommen. Der ganze Hof war erfreut, daß Eure königliche Majestät die Prinzessin Krasomila zur Frau begehrt. Am nächsten Tag wurden wir zur Prinzessin geführt, um ihr unsere Reverenz zu erweisen.
Niemand ist es gestattet, ihre Hand zu berühren, und deshalb durften auch wir nur den Saum ihres Kleides küssen. Auf das Bild Eurer Majestät warf sie nur einen verächtlichen Blick und sagte: "Der hier aufgestellte König ist nicht würdig, mir die Schuhriemen zu binden." Unser Blut wallte vor Zorn und Scham, aber der alte König bat uns, die wahre Ursache zu verschweigen, und gestand, daß auch er selbst von seiner Tochter viel zu erdulden habe; trotzdem könnte vielleicht noch alles gut werden, und die Prinzessin müßte doch ihre Zustimmung geben. Aber eine solche Königin schien uns nicht die richtige Mutter unserer Landeskinder zu sein, und deshalb verließen wir lieber das Schloß."
"Daß war das Klügste, was ihr tun konntet, und ich bin mit eurer Handlungsweise sehr zufrieden. Um das übrige will ich mich selbst kümmern", erwiderte der König; doch seine Wangen brannten vor Zorn über die stolze Prinzessin. Schließlich fand sein scharfer Verstand einen Weg, den zu beschreiten ihm am besten schien. Er rief seinen alten Ratgeber und Verwalter und vertraute ihm allein seine Pläne an.
Am nächsten Tag herrschte im Schloß lebhaftes Treiben, denn der König rüstete zur Reise. Er übergab die Regierung des Landes seinem Ratgeber und die Burg dem alten Verwalter. Am dritten Tag machte er sich auf den Weg. An der Grenze seines Königreiches schickte er sein Gefolge zurück, behielt nur etwas Kleidung und ein wenig Geld bei sich und schritt allein weiter.
Es war ein schöner Frühlingstag, und Prinzessin Krasomila ging im Park des väterlichen Schlosses spazieren. Sie war schön wie eine Göttin, aber ihr Gesicht glich einer Rose ohne Duft, einem Garten, der nicht von den strahlen der Sonne erwärmt wird. Und doch lebte in ihrer Seele ein zartes Gefühl, denn oftmals weinte sie über das Unglück eines Armen und gab reichlich Almosen. In ihre Nähe aber durfte kein Bettler treten, damit er sie nicht mit seiner schmutzigen Hand berühre.
Viele Herrscher hatten bereits um die Hand der Prinzessin angehalten, doch sie hatte jeden zurück gewiesen. Ihre Gedanken hatten Adlerschwingen und hätten sich gern bis zur Sonne erhoben. Der alte König machte ihr oft Vorwürfe und drohte ihr, zu großem Stolz folge die Strafe auf dem Fuße. Sie aber erwiderte ihm: "Mein Bräutigam muß sich durch Schönheit, Erhabenheit, Kunstsinn und Edelmut vor allen anderen Männern auszeichnen, sonst wird er nie mein Gatte."
Als sie nun so im Garten spazieren ging, trat ihr Vater zu ihr und sagte: "Meine Tochter, ich habe einen jungen Mann in meinen Diensten aufgenommen und ihn zum Obergärtner gemacht. Aber er erscheint mir für dieses Amt fast zu schade, denn er kennt sich in der Gärtnerei so gut aus wie in der Literatur und in dieser wieder so in der Musik, so daß ich erstaunte und ihn voller Freude an meinen Hof gezogen habe. Einen so gelehrten Mann hatten wir bei uns bisher nicht. Was meinst du dazu?" -
"Ich kann nichts dazu sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich glaube, du hast gut daran getan, denn ein solcher Mann ist bei Hofe wie ein Kleinod. Ist er in der Musik wirklich so erfahren, wie du sagst, und sonst ein Mensch von edlen Sitten, so könnte er mir Unterricht auf der Harfe erteilen. Nur ungern vermisse ich meinen verstorbenen Lehrer. Schick mir den Fremden her!" Der König war damit einverstanden, und die Prinzessin ging in den Sommersaal, in den kurz darauf Miroslav trat.
„Meine tiefste Verehrung lege ich zu Euren Füßen, und erwarte Eure Befehle“, sagte Miroslav, neigte sein Haupt zu ihren Füßen und küsste den Saum ihres kostbaren Gewandes, wobei er die Prinzessin mit einem Blick bedachte, wie sie ihn bisher nicht gekannt hatte. Das stolze Fräulein errötete und heftete ihren Blick auf eine Rose, die sie kurz zuvor im Garten gepflückt hatte. Sie ahnte nicht, welches Mißgeschick ihr aus der eben entfalteten Blüte erwachsen würde.
In diesem süßen Kelch saß wie auf rosafarbenen Kissen ein kleiner Gott mit gespanntem Bogen, auf dem ein in Gift getauchter Pfeil lag, und wie Prinzessin Krasomila auf die schicksalhafte Rose blickte, ließ der Gott, den Pfeil schnellen und sie fühlte einen Schmerz im Herzen, gegen den kein Kraut gewachsen war.
"Wie ist Euer Name?", fragte sie den Fremden mit freundlicher Stimme. "Miroslav", erwiderte er. "Mein Vater hat mir gesagt, daß Ihr Euch in der Musik auskennt, und ich habe schon seit langem einen Lehrer gewünscht, der mich weiter im Harfenspiel unterrichtet. Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr die Stelle meines verstorbenen Lehrers einnehmen wolltet." "Falls meine bescheidene Kunst imstande ist, diesen Dienst zu verrichten, werde ich mich glücklich schätzen. "Daß übrige wird Euch der König sagen", schloß die Prinzessin das Gespräch und gab ihm mit der Hand ein Zeichen, daß er entlassen sei.
Lange stand sie regungslos da und wußte nicht, was mit ihr geschehen war. In ihrem Kopf flüsterte und summte es wie lockende Stimmen, wie süßes Spiel der Musik, im Herzen aber brannte es, und ihr war zumute wie einem Gefangenen, dem nach langer dunkler Nacht der erste Sonnenstrahl lacht und die Tore seines Herzens weit öffnet, damit sich jeder winkel mit Licht fülle.
Da ertönten Schritte, und die Prinzessin erwachte aus ihren Träumereien. Es war der König. "Nun", fragte er "hast du Miroslav als Lehrer angenommen?" - "Ja, aber ich denke noch darüber nach, wann ich anfangen soll?" "Tu nur, was du willst! Ich muß freilich bei seinem Namen immer an König Miroslav denken. Ich fürchte, daß er den Schimpf nicht erträgt und mir den Krieg erklärt. Tochter, Tochter, damals hast du einen großen Fehler gemacht!" "Quäle mich nicht Vater! Ich wäre unglücklich gewesen, wenn ich diesen König hätte nehmen müssen. Deshalb bleibe ich bei meiner Meinung." Der König verfiel wieder ins Sinnen und ging verdrossen fort.
Am nächsten Tag aber schien alles vergessen, und der Unterricht begann. Miroslav war ein eifriger Lehrer und Prinzessin Krasomila eine aufmerksame Schülerin. Die Eiskruste, mit der der Stolz ihr Herz umgeben hatte, schmolz von Tag zu Tag mehr. Oft flüsterten ihre Gespielinnen einander zu: "Was mag nur mit unserer Prinzessin geschehen sein? Niemals durfte jemand es wagen, ihre Hand zu berühren, und jetzt macht sie sich nichts daraus, wenn ihr Miroslav beim Abschied die Hand küßt." Die Liebe hatte das stolze Mädchen überwunden.
Schon war Miroslav geraume Zeit am Hofe. Alle hatten ihn gern, vor allem aber Prinzessin Krasomila, obwohl sie es sich nicht eingestehen wollte. Kam sie in den Park, so bedachte sie den Oberaufseher der Gärten nur mit einem stolzen Blick, ließ sich dann aber nirgendwo anders nieder als auf der Bank oder in der duftenden Laube, die Miroslav ihr zuliebe über Nacht hat aufstellen lassen. Sie konnte auch nicht so unliebenswürdig sein und nicht mit einem freundlichen Wort für diesen Beweis seiner Verehrung danken.
Aus den wenigen Worten entspann sich ein Gespräch, weil die Prinzessin viel zu fragen und zu befehlen hatte. Mit dem Unterricht war es ebenso. Wenn sie schlechte Laune hatte, mußte der Kammerdiener dem Lehrer sagen, die Prinzessin habe heute keine Lust zum Lernen. Bald aber besann sie sich eines anderen, und der Kammerdiener mußte sich nochmals bequemen und den Lehrer holen. Um sein düsteres Gesicht auf zu hellen, reichte sie ihm oft selbst die Hand zum Kuß, eine Ehre, die selbst den höchsten Edelleuten nicht zuteil wurde.
Eines abends saß die Prinzessin am offenen Fenster, spielte auf der Harfe und sang dazu. Neben ihr stand Miroslav und wandte kein Auge von ihrem Antlitz, das vom goldenen Schein der untergehenden Sonne bestrahlt war. Plötzlich hielt sie inne und reichte die Harfe ihrem Lehrer. "Wenn Eure Hoheit gestatten, singe ich jetzt ein eigenes Lied", sagte Miroslav und die Prinzessin Krasomila nickte. -
Es begann - aber was war das für ein Gesang! Bald schien es Krasomila, als höre sie den Klang silberner Glocken, die sie in das Haus des Herrn zu frommem Gebet riefen. Bald kam es ihr so vor, als locke die Stimme einer Nachtigall in eine schattige Laube und in die Arme des Geliebten. Die Sonne versank hinter den hohen Bergen. Ihr letzter Schein brachte die Eiskruste, die das Herz der stolzen Prinzessin noch hauch dünn umgab, völlig zum Schmelzen. Sie neigte ihr Haupt Miroslav zu, und eine Träne fiel auf seine Hand.
Dieser aber sagte, als hätte er nichts bemerkt: "Das war das Abschiedslied, gnädigste Herrin. Morgen muß ich fort von hier." "Was sagst du da, Miroslav? Du darfst nicht fort, nein, so nicht!" rief Krasomila mit zitternder Stimme und ergriff Miroslavs Hand. Da öffnete sich die Tür, und Krasomilas Vater trat über die Schwelle. "Das also ist der Mann, den du liebst?" fragte er kalt die erschrockene Tochter. "Ja Vater, ich liebe ihn!" erwiderte Krasomila und richtete sich stolz auf. "Und weißt du auch, daß ihm eine jener Tugenden fehlt, die du von deinem zukünftigen Gatten verlangt hast?"
"Ich weiß, daß Miroslav nicht aus edlem Geschlecht ist, aber ich liebe ihn trotzdem, und ich würde ihn lieben, wäre er auch von noch niedrigerem Stande." "So soll er noch in dieser Stunde dein Mann sein. Aber länger bleibst du nicht in meinem Schloß, damit du nicht noch größeren Schaden auf mein Haupt lädst." - "O gnädigster König!" rief Miroslav und beugte seine Knie. "Ich kann nicht zu lassen, daß die Prinzessin durch mich unglücklich wird, ich verlasse das Schloß!" Der König achtete nicht auf diese Worte. Er ließ den Beichtvater rufen, und bald darauf war Krasomila, die stolze Prinzessin, die Frau des armen Miroslav und stand in ihrem einfachsten Kleid vor der Burg.
Schweren Herzens nahm sie im Geiste Abschied von ihrem Vater, der sie so unfreundlich behandelte und sie wie eine arme Magd aus dem Hause gejagt hatte. Dann aber faßte sie guten Mut, reichte ihrem Manne die Hand und sprang mit ihm in die Kutsche, die sie aus dem Reich ihres Vaters bringen sollte. Als sie an die Grenze jenes Landes kamen, wo Krasomila einstmals Herrscherin werden sollte, verließen sie den Wagen und gingen zu Fuß weiter.
"Liebe Frau", sagte Miroslav zu Krasomila, "Was sollen wir jetzt beginnen? Ich habe zwar in der Hauptstadt einen Bruder, der bei Hofe ist und mir zu einem Dienst verhelfen kann, aber bis dahin werden wir wohl Not leiden." - "Etwas Geld haben wir ja noch! Inzwischen will ich für die Leute arbeiten und mich bemühen, deine Sorgen zu erleichtern.", tröstete Krasomila ihren betrübten Mann, obwohl ihr selbst nicht leicht ums Herz war.
Als sie in die Hauptstadt des Königreiches kamen, mietete Miroslav eine kleine Stube. Sie vereinbarten alle kostbaren Kleider zu verkaufen. Ja, Krasomila opferte selbst, den Ring, den sie am Finger trug, damit sie etwas Geld hatten. "Ich gehe jetzt", sagte Miroslav am nächsten Tage, "um für dich Arbeit und für mich einen Dienst zu beschaffen, zu dem mir mein Bruder verhelfen wird." Zu Mittag kehrte er mit einem kleinen Bündel zurück.
Er schnürte es auf und nahm weiche Leinwand und etwas Obst heraus. "Schau her, meine Liebe, hier bringe ich dir Arbeit, die, wenn du sie gut machst, auch gut bezahlt wird. Das Obst habe ich von meinem Bruder erhalten. Ach, meine liebe Frau, wie konnte ich nur dich, eine Königstochter, in ein solches Leben hinein ziehen? Du, die du an jeden Luxus gewöhnt warst, sollst nun für fremde Leute arbeiten und mußt Not ertragen. Oh, ich Unglücklicher!" So klagte Miroslav und küßte die Hände seiner Frau, der er erst nach der Hochzeit gesagt hatte, wie sehr er sie liebte.
"Was jammerst du", antwortete sie und lachte ihren Mann an, "Ich habe es ja so gewollt. Deine Liebe entschädigt mich für alles." Voll Freude nahm sie die feine Leinwand und machte sich an die Arbeit. Sie nähte fleißig und gönnte sich selbst in der Nacht keine Ruhe. Eigentlich legte sie die Arbeit nur weg, um ihrem Mann das Essen zu richten. Als sie fertig war, setzte sie eine einfache weiße Haube auf und ging, die Arbeit abzuliefern.
Es war ein schönes Haus, in das sie Miroslav gehen ließ, und der Diener führte sie durch prächtige Zimmer zur Kammerzofe. Ihr war doch ängstlich zumute, als die Kammerzofe, die Arbeit genau betrachtete, einiges aussetzte und dafür den Lohn schmälern wollte. Das Blut schoß ihr in die Wangen, und Tränen stiegen ihr in die Augen. Da öffnete sich die Tür, und eine ernste Dame trat ein. sie fragte die Kammerzofe, worum es gehe, und als sie die Arbeit betrachtet hatte, befahl sie, der Schneiderin den vollen Lohn zu zahlen.
Krasomila verneigte sich zum Dank und verließ eilends das Haus. Miroslav aber sagte sie nichts von dem, was ihr widerfahren war. Immer mußte sie daran denken, daß wohl auch ihre eigenen Kammerzofen mit den armen Schneiderinnen und anderen Handwerkern auf gleiche Weise verfahren waren. Nach zwei Tagen kam Miroslav wieder und bot ihr einen Dienst bei einer vornehmen Dame an, wo sie es sehr gut haben sollte. Krasomila war zufrieden, verhüllte ihr Gesicht und trat bei jener Dame den Dienst an. Diese musterte sie erst von Kopf bis Fuß, fragte, was sie alles könne, und sagte dann, Krasomila solle zwei Tage probeweise da bleiben.
Das waren zwei bittere Tage! Nun sah sie, was so ein Dienstmädchen unter den Launen der vornehmen Dame zu leiden hat, wie verächtlich man es behandelt. War das ein Putzen, Laufen, Tragen, Schreien und Schelten, wenn eine Locke nicht ganz so ausfiel wie die andere, oder wenn sich das Leibchen nicht genug wölbte. Und doch ist ein solches Geschöpf nicht schlechter als ein anderes. Das konnte Krasomila nicht ertragen, und nach zwei Tagen verließ sie den Dienst.
"Weißt du schon das Neueste, liebe Frau?" sagte Miroslav wenige Tage danach, als er mit heiterem Gesicht ins Zimmer trat. "Unser König hat eine Braut Heim geführt,und morgen findet im Schloß ein großes Festmahl statt, bei dem er sie seinen Edelleuten vorstellen will. Wie ich höre, sucht man viele Köche und Küchenhilfen. Und jeder bekommt für diesen Tag mehrere Dukaten. Du kannst doch kochen, und zu viel zu tun wirst du wohl auch nicht haben. Willst du nicht ins Schloß gehen und in der Küche helfen?" -
"Warum nicht, ich gehe gern. Soviel Geld verdient man nicht leicht an einem Tag", erwiderte Krasomila. Frühmorgens machte sie sich zurecht, band ein Kopftuch auf ländliche Art und ging mit ihrem Mann ins Königsschloß. "Ich werde mir auch einen Verdienst suchen, und am Abend hole ich dich ab", sagte Miroslav, als er die Küche verließ, in die er seine Frau geführt hatte.
Krasomila machte sich hurtig an die Arbeit, die ihr der Oberkoch für den ganzen Tag anwies, und hatte infolge ihrer Niedergeschlagenheit kein Auge für das, was im Schloß vorfiel. Alles ging gut, schon kamen die Gäste angefahren, und die Wagenreihe nahm kein Ende. Als Krasomila einmal über den Gang lief, vertrat ihr ein Herr den Weg, mit eitel Gold und Silber geschmückt, so daß er vor lauter Glanz nicht zu erkennen war. "Bitte", sagt er mit tiefer Stimme zu Krasomila, "ruft doch jemanden, der mir den Schuhriemen bindet!" Krasomila blickte scheu zu ihm hinauf, und als sie an der Kleidung sah, daß es der König war, bückte sie sich und band ihm selbst den Schuhriemen. Der König dankte ihr und ging weiter.
Kurz darauf kam der Kammerdiener und fragte, wo das Küchenmädchen sei, das dem König den Schuhriemen gebunden habe; es solle in die oberen Gemächer zu der Kammerzofe kommen. Krasomila tat, wie ihr geheißen war. Als sie zur Kammerzofe kam, verneigte sich diese und bat sie weiter zu gehen. Verwundert blickte sich Krasomila in den kostbaren Gemächern um, wo sie alles an ihr väterliches Schloß erinnerte. Es waren die Zimmer der Schloßherrin, und Krasomila dachte, sie werde endlich die junge Königin zu Gesicht bekommen.
Was sie selbst hier zu tun hätte, wußte sie nicht. So gelangte sie in den Ankleideraum, wo mehrere Tische voll kostbarer Kleider und andere voll Schmuck lagen. "Hier sollt Ihr Euch ein Kleid und passenden Schmuck auswählen, ich werde Euch beim Ankleiden helfen. Unser König will Euch für den erwiesenen Dienst einmal zum Tanze holen." "Um Gottes willen", rief die erschrockene Krasomila, "was würde mein Mann dazu sagen? Ich soll mit dem König tanzen und diese Kleider anziehen? Nein, das tue ich nicht!" - "Auch nicht, wenn ich dich darum bitte?" vernahm sie eine wohlbekannte Stimme hinter sich, und sie sah den König da stehen und sie erkannte in ihm ihren Miroslav. Krasomila erschrak und fragte mit schmerzlicher Stimme: "Warum hast du das getan und mich so behandelt?"
"Du erinnerst dich vielleicht, mit welch stolzer Antwort du meine Edelleute abgefertigt hast, die dir mein Bild überbrachten? Damals habe ich geschworen, deinen Stolz zu brechen. Dein Vater hat mich in diesem Vorhaben bestärkt, und deine Liebe war mir dabei eine große Hilfe. Aber ich hätte dich nicht so lange geprüft, wenn es dein Vater nicht befohlen hätte. Ich habe mit dir gelitten." Da öffnete sich die Tür und der alte König trat ein. Alle drei umarmten einander herzlich. "Meine Tochter, die Prüfung war zwar hart, aber glaube mir, sie wird sich für dich und deine Kinder wohltuend auswirken", sagte der Vater.
Da kamen die Gäste, und als sie die junge Königin in ihrem kostbaren, goldgewirkten Gewand und mit dem königlichen Diadem erblickten, waren sie alle von ihrer Schönheit bezaubert, denn bei aller Lieblichkeit vertraten jetzt die Stelle von Stolz und Hochmut, Freundlichkeit und Güte.
Hocherhobenen Hauptes führte Miroslav seine geliebte Frau in den Saal, wo die Hofgesellschaft bereits versammelt war und die junge Königin jauchzend begrüßte.
Quelle: Bozena Nemcova, Tschechisches Märchen
WIE DER WAGNER KÖNIG WURDE ...
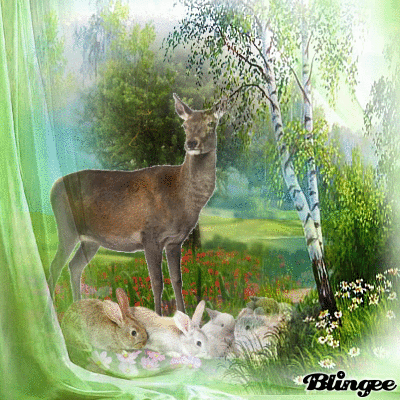
Es war ein Wagner, der hatte drei Söhne. Als diese nach des Vaters Tode heraus wuchsen, meinte der älteste zu dem jüngsten, es dürfe wohl an der Zeit sein, daß er, der älteste, in die Welt ginge. Der jüngere stimmt ihm bei. Sie backten ihm Kuchen auf den Weg, damit er nicht Hunger leide.
Als er bereit war, ging er, kam in einen Wald und dachte, er sei ein Wagner, er habe nicht nötig, zu Fuße zu gehen, er könne sich einen Wagen machen, der von selbst fahre. Als er den Wagen zu machen anfing, kam ein Greis zu ihm und sagte: „Was machst du da?“ Der Jüngling versetzte: „Ich bin ein Wagner, ich habe nicht nötig, zu Fuße zu gehen, ich kann mir einen Wagen bauen, der von selbst fährt.“ Der Greis sprach zu ihm: „Dein Wagen wird nicht fahren!“ Er achtete nicht darauf und arbeitete weiter. Der Greis entfernte sich.
Der Jüngling stellte nun den Wagen zusammen, allein der Wagen wollte nicht fahren. Da der Wagen nicht fahren wollte, warf er die Stücke auseinander, aß seinen Kuchen auf, und als er nichts mehr übrig hatte, kehrte er heim. Nun sagte der jüngere Bruder: „Du warst schon in der Fremde, jetzt will ich in die Welt gehen.“ Was der älteste auf den Weg mitbekommen hatte, bekam der jüngere auch, und er ging.
Als er an die Stelle kam, wo sein Bruder gewesen, fand er die Stücke vom Wagen. Er dachte, daß er ein Wagner sei, und daß er den Wagen zusammen stellen könne, der von selbst fahre. Es kam wieder jener Greis und sagte zu ihm: „Gottes Segen, junger Mann!“ Er aber sah nicht einmal auf und arbeitete. Der Greis fragte ihn: „Was machst du da?“ Der Jüngling versetzte: „Ich bin ein Wagner, ich habe nicht nötig, zu Fuße zu gehen, ich kann mir einen Wagen zusammenstellen, der von selbst fährt.“ Der Greis sprach zu ihm: „Dein Wagen wird nicht fahren.“ Er achtete nicht darauf und arbeitete fort. Der Greis entfernte sich.
Der Jüngling stellte nun den Wagen zusammen, allein der Wagen wollte nicht fahren. Da ward er böse, warf die Stücke auseinander, aß auf, was er mit hatte, und kehrte heim. Nun sagte der jüngste Bruder: „Ihr ward beide schon in der Fremde, jetzt will ich in die Welt gehen.“ Sie backten ihm gleichfalls Kuchen und er ging und kam an die Stelle, wo die zwei ersten die Stücke des Wagens auseinander geworfen, und dachte gleichfalls, daß er ein Wagner sei, daß er es nicht nötig habe, zu Fuße zu gehen und sich einen Wagen bauen könne, der von selbst fahre.
Als er mit der Arbeit beschäftigt war, kam der Greis wieder und sagte zu ihm: „Gottes Segen, junger Mann!“ Und er sprach darauf: „Gott vergelt’s! Seid mir gegrüßt!“ Der Greis fragte ihn: „was machst du da?“ Der Jüngling erwiderte: „Ich mache mir einen Wagen, lieber Alter, der von selbst fährt. Ich bin ein ausgelernter Wagner, und darum denk ich, daß ich es nicht nötig habe, zu Fuße zu gehen, sondern in einem Wagen fahren kann.“ Der Greis sprach zu ihm: „Du hast recht, junger Mann; allein er wird nicht von selbst fahren.“
Der Jüngling bat ihn, er möchte so gut sein, ihm den Wagen zusammen stellen zu helfen; er wolle ihm von dem geben, was er zum Essen mit habe. Als der Greis mit ihm den Wagen zusammen gestellt, aßen sie; dann setzte sich der Jüngling in den Wagen, und der Greis gab ihm eine Gerte und sprach: „So schnell als du die Gerte schwingen wirst, so schnell wird der Wagen fahren; nur mußt du alle in den Wagen aufnehmen, die dir im Walde begegnen!“ Der Jüngling schwang die Gerte und fuhr.
Es begegnete ihm ein Mann, der hatte lange Beine. Sogleich nahm er ihn auf und fuhr weiter. Dann begegnete ihm ein zweiter, der hatte zwei goldene Kugeln. Er nahm auch diesen auf und fuhr weiter. Endlich begegnete ihm ein dritter, der hatte ein weit aufgesperrtes Maul, und den nahm er gleichfalls mit. So fuhren sie alle vier, kamen des Abends in ein Wirtshaus und nachtmahlten.
Während ,sie nachtmahlten, beschaute sich die Hausmagd durchs Fenster den Wagen und sah die zwei goldenen Kugeln darin hängen. Sie lief hinaus und wollte die Kugeln stehlen; wie sie aber nach ihnen griff, blieb sie mit den Händen an der Kugel kleben und konnte sich nicht los reißen. Die vier fuhren, nachdem sie genachtmahlt, die ganze Nacht, und die Magd lief hinter ihnen.
Des Morgens kamen sie in ein anderes Wirtshaus zum Frühstück. Während sie frühstückten, lief die dortige Hausmagd zufällig mit dem Besen hinaus und sah die erste Magd bei den Kugeln stehen. Sie glaubte, sie wolle stehlen und schlug sie mit dem Besen auf den Rücken, indem sie rief: „Was machst du da bei dem Wagen?“ Allein sie blieb mit dem Besen am Rücken der Magd kleben und konnte sich nicht mehr los reißen. Die vier hatten in des gefrühstückt, setzten sich in den Wagen und fuhren weiter, und die zwei Mägde liefen hinter ihnen.
Des Mittags kamen sie in ein drittes Wirtshaus. Dort war die Hausmagd beschäftigt, Mist aus dem Stall zu schaffen, und als sie die zwei anderen Mägde bei dem Wagen stehen sah, lief sie mit der Mistgabel auf sie los und rief: „Ihr nichtsnutzigen Dinger, was macht ihr da? Die eine stiehlt goldene Kugeln, die andere hält ihr müßig den Besen auf den Rücken!“ Sie stieß die zweite mit der Mistgabel in die Lende, blieb aber mit der Mistgabel kleben und konnte sich ebenfalls nicht los reißen.
Die vier hatten in des gemittagmahlt, setzten sich in den Wagen und fuhren in die Stadt. Dort war eine Prinzessin, die seit ihrer Geburt über nichts gelacht hatte, und der prophezeit worden, sie werde dessen Gemahlin, über den sie zu erst lache. Es fuhren dort hohe Herren mit großem Geschick herum, die froh gewesen wären. wenn sie über sie gelacht hätte, und auch Prinzen kamen gefahren; allein sie lachte über niemanden, bis der Wagner, in der Stadt erschien mit seiner Begleitung.
Als er durch die Stadt fuhr, sah die Prinzessin eben aus dem Fenster; da lachte sie auf, daß es gellte. Der König und die Königin hörten das Gelächter der Prinzessin, eilten in ihr Gemach und fragten sie, worüber sie so lachte. Sie zeigte ihnen den Aufzug in der Stadt, und der König und die Königin mußten gleichfalls lachen, denn solch einen Spaß hatten sie noch nie gesehen.
Der König der sehr stolz war, sandte nun nach dem Wagner und verhieß ihm spöttisch, er solle sein Schwiegersohn werden, er solle das Königreich samt der Prinzessin erhalten, aber nur, wenn er ein Stück ausführe. Der Wagner fragte, welches. Der stolze König sprach lächelnd: „Wenn du jemanden stellst, der drei Laib Brot auf einmal auf ißt und vier Humpen Bier dazu austrinkt, dann will ich dir die Prinzessin geben.“ Der Wagner ging zu dem, der das Maul weit aufgerissen hatte, und fragte ihn, ob er sich getraue, die Aufgabe zu lösen.
Ich eß und trink noch mehr“, antwortete dieser. „Nur her damit!“ Sogleich backten die Bäcker drei Laib Brot und die Bauern brauten vier Humpen Bier. Als alles fertig war, brachten sie es dem Wagner. Der stellte den, mit dem weit aufgerissenen Maul vor sich, nahm Laib für Laib, dann schüttete er Bier in die Kanne und aus der Kanne ihm in das Maul, bis er alles Bier ausgetrunken hatte. Herauf ließ dem König melden, daß er sein Stück ausgeführt.
Der König wunderte sich nicht wenig, sagte jedoch dem Wagner, die Prinzessin sei noch nicht sein, er müsse noch ein Stück aufführen. „Dreihundert Meilen von hier“, sprach er, „ist eine Quelle, und aus dieser Quelle will ich noch in dieser Stunde frisches Wasser haben.“ Der Wagner ging zu dem, der die langen Beine hatte, und fragte ihn, ob er sich getraue, die Aufgabe zu lösen.
„Will das Wasser noch früher bringen!“ antwortete dieser. Er ging um elf Uhr aus und kam sehr bequem um halb zwölf zur Quelle, da meinte er, es sei noch Zeit genug und legte sich hin und schlief ein. Bereits war es fast drei Viertel auf zwölf, er kam mit dem Wasser noch immer nicht. Da ging der Wagner zu dem, der zwei goldene Kugeln hatte und fragte ihn, ob er sich getraue, mit einer von ihnen den, der das Wasser bringen sollte, zu treffen, und ihm ein Zeichen zu geben.
Er antwortete: „Freilich!“ Er warf die erste Kugel und traf den anderen nicht; er warf die zweite, mit der traf er ihn. Dieser erwachte, klaubte die Kugeln schnell auf, beschleunigte seine Schritte und war am Mittag mit den Kugeln und mit dem Wasser da. Allein der König, der sehr stolz war, sagte nun dem Wagner, er müsse noch ein Stück ausführen, wenn er die Prinzessin erhalten wolle.
„Ich habe“, sprach er, „zwölf Hasen und eine Rehziege. Vermagst du sie zu weiden, so will ich dir die Prinzessin geben.“ Der Wagner war zufrieden und trieb seine Herde auf die Weide; doch kaum hatte er sie auf den Weideplatz getrieben, so liefen sie auseinander. Da begann er missmutig zu klagen, bis ihm jener Greis erschien, der ihm geholfen hatte den Wagen zusammen zu stellen, und er fragte ihn: „Junger Mann, warum klagst du?“ Der Wagner vertraute ihm sein Leid, daß er habe König werden können, und daß er jetzt nichts mehr werde; daß ihm der König zwölf Hasen und eine Rehziege zu weiden gegeben hatte und daß die Herde auseinander gelaufen sei.
Der Greis gab ihm eine Pfeife, er solle auf ihr pfeifen, die Herde werde wieder gelaufen kommen. Als er zu pfeifen begann, kamen die Tiere wirklich alle gelaufen. Nun weidete er fröhlich und pfiff und sang; des Abends trieb er die Herde nach Hause. Der stolze König, befahl ihm, die Herde bis übermorgen zu weiden.
Über Nacht berieten sich der König und die Königin, wie sie ihm um einen Hasen prellen könnten; sie wollten des Morgens zu ihm auf die Weide schicken, um ihm einen abzukaufen, und ließen einen eisernen Kasten machen, damit der Hase nicht heraus springen könnte, wenn er hinein gesteckt wäre.
Die Prinzessin verkleidete sich als Lumpensammlerin und ging, den Hasen zu kaufen. Der Wagner wollte ihr um keinen Preis einen verkaufen; als sie aber inständig bat, versprach er ihr einen zu schenken, wofern sie eine Viertelstunde lang tanze, wie er ihr pfeife. Die Prinzessin meinte, der Wagner habe sie nicht erkannt und willigte ein.
Der Wagner pfiff bald langsam, bald geschwind, die Prinzessin drehte sich und sprang, daß es zum Lachen war. Als sie sich abgemüdet, steckte er ihr einen Hasen in den Kasten. Sobald die Prinzessin den Hasen hatte, lief sie freuden voll nach Hause. Als sie sich jedoch dem Schlosse näherte, begann der Wagner zu pfeifen, und der Hase zersprengte den eisernen Kasten und lief zurück.
Da weinte die Prinzessin vor Zorn und beschwerte sich bei dem Könige bitter über das, was ihr geschehen. Des Nachmittags nahm die Königin einen stählernen Kasten und verkleidete sich als Bettlerin, ging zu dem Wagner auf die Weide und bat ihn, er möchte ihr einen Hasen verkaufen; in der Stadt werde ein Festmahl sein und sie müsse dazu einen Hasen haben, möge sie ihn nehmen, woher immer. Er wollte ihr keinen verkaufen; nach vielen Bitten versprach er ihr einen umsonst, wofern sie nach dem Ton seiner Pfeife eine ganze Viertelstunde auf einem Fuß um die Hasen herum tanze und sich dabei Schnippchen schlage.
Die Königin meinte gleichfalls, der Wagner habe sie nicht erkannt und willigte ein. Sie sprang nach dem Ton der Pfeife auf einem Fuße und schlug sich Schnippchen; schon war sie fast außer Atem und sprang noch immer, bis der Wagner laut zu lachen anfing. Dann steckte er ihr den Hasen in den stählernen Kasten. Freuden voll eilte sie mit dem Hasen nach dem Schlosse. Als sie jedoch zum Schlosse kam, begann der Wagner auf dem Weideplatz zu pfeifen, und der Hase schlug den Kasten durch und rannte zurück.
Da beschwerte und beklagte sich die Königin bitter, daß ihre Freude zu Ende sei, allein es half ihr nichts. Des anderen Tages früh ging der König selbst. Er verkleidete sich als Bettler, nahm einen kupfernen Kasten, kam zu dem Wagner auf die Weide und bat ihn, er möchte ihm einen Hasen verkaufen. Der wollte anfangs nicht, dann aber sprach er: „Wenn du hier eine ganze Viertelstunde Purzelbäume machst, so schenke ich dir einen Hasen.“
Der König, in der Meinung, der Wagner kenne ihn nicht, begann, um ihm den Hasen zu entlocken und seine Tochter nicht geben zu müssen, Purzelbäume zu machen, an die er natürlich nicht gewöhnt war. Er überpurzelte sich häufig, und in einer Viertelstunde war er ganz hin. Der Wagner steckte, als er sich satt gelacht, ihm einen Hasen in den kupfernen Kasten. Freuden voll eilte der König nach Hause und dachte, der Hase werde ihm nicht aus dem kupfernen Kessel entspringen können.
Als er sich aber nach dem Schlosse näherte, begann der Wagner zu pfeifen, und der Hase sprang mit Gewalt aus dem kupfernen Kasten und lief zurück. Die Prinzessin, die Königin und der König trösteten sich wenigstens damit, daß sie der Wagner auf der Weide nicht erkannt habe, da sie verkleidet waren.
Als nun der Wagner mit seiner Herde glücklich nach Hause kam, sprach der stolze König zu ihm: „Du hast alle Aufgaben wohl gelöst, ein Stück aber mußt du noch ausführen. Du mußt drei Scheffel Wahrheit messen; dann misst du die, dann erhälst du meine Tochter zur Gemahlin.“ Der Wagner willigte mit Freuden ein und bat den König, er möchte öffentlich austrommeln lassen, daß er auf dem Marktplatz Wahrheit messen werde.
Das Volk strömte zusammen, und der König, die Königin und die Prinzessin kamen auch und setzten sich auf hohe Sitze. Der Wagner ließ drei Scheffel und ein Streichholz bringen. Als alle versammelt waren, tat er, als ob er aus einem Sacke etwas in den einen Scheffel schüttete, und sprach dabei: „Ich weidete Hasen und eine Rehziege. Da kam eine Lumpensammlerin zu mir und bot mir viel Geld für einen Hasen; allein ich verkaufte ihr keinen, sondern sagte ihr, ich wolle ihr einen schenken, wenn sie tanze, wie ich pfeifen würde. Die Lumpensammlerin willigte ein und sprang so, wie ihr gleich sehen werdet.“
Da trat derjenige vor, der die langen Beine hatte, als Lumpensammlerin verkleidet, und sprang wie ihm der Wagner pfiff, bald langsam, bald geschwind, und dabei machte er possierliche Gebärden, als ob er sehr erschöpft wäre, so daß alle vor Lachen beinah barsten und selbst der Wagner zuletzt nicht mehr pfeifen konnte; nur die Prinzessin lachte nicht, sondern verbarg ihr Gesicht in ihr Tuch. Hierauf hieß er die falsche Lumpensammlerin abtreten.
Als die Versammlung ruhig geworden, nahm er einen zweiten Sack und ging zu einem anderen Scheffel. Er tat wieder, als ob er aus dem Sacke etwas in ihn schüttete und sprach dabei: „Mit dem zweiten Scheffel mess ich folgende Wahrheit: Ich weidete Hasen und eine Rehziege. Da kam eine Bettlerin zu mir und bot mir viel Geld für einen Hasen; allein ich verkaufte ihr keinen, sondern sagte ihr, ich wolle ihr einen umsonst geben, wenn sie nach dem Ton meiner Pfeife auf einem Fuße um die Herde herum tanze und sich dabei Schnippchen schlage. Die Bettlerin willigte ein und sprang auf einem Fuße und schlug sich Schnippchen, und dabei warf er die goldenen Kugeln in die Höhe und fing sie wieder so possierlich gewandt, daß alle laut und gewaltig lachten; nur die Königin war still und schämte sich sehr.
Als sie sich satt gelacht, hieß der Wagner die falsche Bettlerin abtreten, ging zu dem dritten Scheffel und tat, als ob er aus dem dritten Sacke etwas hineinschüttete. Dabei sprach er: „Ich weidete Hasen und eine Rehziege. Da kam ein Bettler zu mir und bat mir viel Geld für einen Hasen; allein ich verkaufte ihm keinen, sondern sagte ihm, ich wolle ihm einen schenken, wenn er auf dem Weideplatz eine ganze Viertelstunde Purzelbäume mache. Der Bettler willigte ein und machte Purzelbäume, wie ihr gleich sehen werdet.“ Nun trat derjenige vor, der das Maul weit aufgesperrt hatte, verkleidet als Bettler, und begann Purzelbäume zu machen, dabei schnitt er solche Gesichter mit seinem ungeheuren Maul und wälzte die Augen so heraus, daß vor unbändigem Lachen niemand unter den Zuschauern bestehen konnte; nur der König sah verdrießlich darein.
Als alle ausgelacht hatten, ließ er auch den dritten abtreten. Nun stellte er alle drei, die Lumpensammlerin, die Bettlerin und den Bettler zu den drei Scheffeln und rief: „Damit ihr wisst, daß ich in die drei Scheffel Wahrheit gemessen, so will ich euch sagen, daß ich der Lumpensammlerin, als sie vom Springen müde war, einen Hasen in einen eisernen Kasten steckte, und der Bettlerin, als sie sich außer Atem getanzt, einen in einen stählernen Kasten, und dem Bettler, als er sich mit Purzelbäumen wund und lahm gepurzelt, einen Hasen in den kupfernen Kasten; allein dafür konnte ich nicht, daß alle drei Hasen wieder davon – und zu mir zurück liefen, als ich auf meiner Pfeife zu pfeifen anfing.
Aber ich will noch das Streichholz nehmen, um die Scheffel glatt zu streichen, und euch sagen, wer die Lumpensammlerin, wer die Bettlerin und wer der Bettler gewesen ist.“ Und dabei blickte er nach dem König, der Königin und der Prinzessin, daß diese nur zu gut merkten, er habe sie erkannt.
Sie wollten um keinen Preis verraten sein, und so sprach der König seinen Stolz endlich bezähmend: Jüngling, geistreicher wirst du durch die drei Scheffel nicht, denn ich befahl dir bloß, in drei Scheffel Wahrheit zu messen. Das hast du getan, und ich geb dir die Prinzessin zur Gemahlin.“ Die Leute hätten gern gewusst, wer die Lumpensammlerin, die Bettlerin und der Bettlerin gewesen: allein der Wagner sagte es ihnen wohl weislich nicht. Er wollte lieber Hochzeit machen und König werden, besonders da er wußte, daß er im Besitz einer Pfeife sei, nach der alles tanzen müsse.
Quelle: Märchen aus Mähren
DER KUCKUCK ...
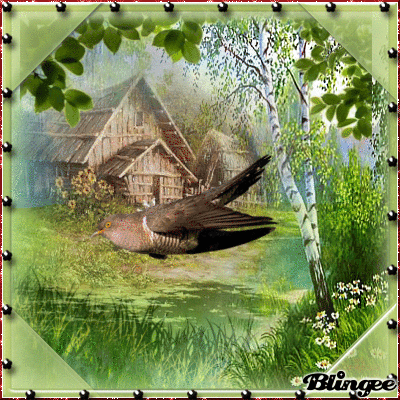
Als der Herr Jesus mit Petrus durch Böhmen zog, trat er in einen Hof ein, um sich eine Gabe zu erbitten. Die Bäuerin aber versteckte sich. Da die Wanderer niemand zu Hause fanden, kehrten sie um und gingen weiter.
Die Bäuerin aber höhnte ihnen aus dem Fenster nach und rief: 'Kuckuck, kuckuck!' Da sprach Petrus: 'Herr, laß sie werden, was sie schreit!' 'Es geschehe!' sagte Jesus, und die Bäuerin flog als Kuckuck davon und muß nun Kuckuck rufen bis auf den jüngsten Tag.
Tschechien: Oskar Dähnhardt: Naturgeschichtliche Märchen aus Böhmen
DAS FEURIGE HAUS ...
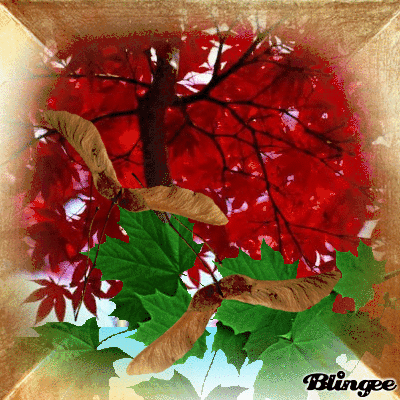
Etwa zwei Stunden von Duschnik liegt unweit eines großen Waldes das Dorf Pitschin. In der Mitte des Dorfes steht ein Ahornbaum. Ehemals soll an der Stelle dieses Dorfes nur ein einziges Haus gestanden haben und zwar gerade neben jenem Ahornbaum. Der Hausherr aber soll der schwarzen Kunst ergeben gewesen sein und die Leute behaupteten, sogar den Teufel mit eigenen Augen durch den Schornstein in das Haus fahren gesehen zu haben.
Eines Tages nun hörten die Arbeiter des nahen Waldes einen Schmerzensschrei und als sie herbei eilten, war das ganze Haus verschwunden und an dessen Stelle sah man einen schwarzen runden Fleck, der unaufhaltsam glühte, ohne daß man etwas brennen sah. Man mochte Wasser darüber gießen, so viel man wollte, nichts half.
Endlich holte man den Priester, der den Fleck mit Weihwasser besprengte, worauf er unter schrecklichem Gezische verschwand. Sonntagskinder, die in der zwölften Stunde in der Nacht geboren sind, können an Walpurgis ein feuriges Haus sehen, das um Mitternacht aus der Erde hervor steigt und mit dem ersten Hahnenschrei wieder verschwindet.
Quelle: Sagen-Buch von Böhmen und Mähren
VON DEN ZWÖLF MONATEN
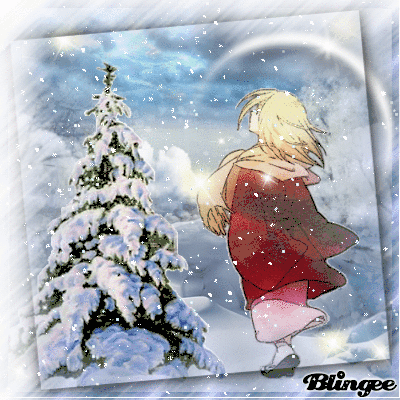
Es war eine Mutter, und die hatte zwei Töchter; die eine war ihre eigne, die andere ihre Stieftochter. Die eigene Tochter hatte sie sehr lieb, die Stieftochter konnte sie nicht einmal ansehen, bloss darum, weil Maruschka schöner war, als Holena. Die gute Maruschka wußte von ihrer Schönheit nichts; sie konnte sich gar nicht erklären, warum die Mutter so böse sei, so oft sie sie ansehe. Alle Arbeit mußte sie selbst verrichten: die Stube aufräumen, kochen, waschen, nähen, spinnen, weben, Gras zutragen und die Kuh allein besorgen. Holena putzte sich nur und ging müßig. Aber Maruschka arbeitete gern, war geduldig, und ertrug das Schelten, das Fluchen der Schwester und Mutter wie ein Lamm. Allein dies half nichts, sie wurden von Tag zu Tag schlimmer, und zwar bloss darum, weil Maruschka je länger, desto schöner, Holena desto garstiger ward. Die Mutter dachte: »Wozu sollt' ich die schöne Stieftochter im Hause leiden, wenn meine eigne Tochter nicht auch so ist? Die Bursche werden auf Brautschau kommen und Maruschka wird ihnen gefallen, Holena werden sie nicht haben wollen!« Von diesem Augenblicke an suchten sie die arme Maruschka loszuwerden; sie quälten sie mit Hunger, sie schlugen sie, doch sie ertrug's geduldig und ward von Tag zu Tag schöner. Sie ersannen Qualen, wie sie braven Menschen gar nicht in den Sinn gekommen wären.
Eines Tages - es war in der Mitte des Eismonats - wollte Holena Veilchen haben. »Geh', Maruschka, bring' mir aus dem Walde einen Veilchenstrauß! Ich will ihn hinter den Gürtel stecken und an ihn riechen!« befahl sie der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, was fällt Dir bei! Hab' nie gehört daß unter dem Schnee Veilchen wachsen,« versetzte das arme Mädchen. »Du nichtsnutziges Ding, Du Kröte, Du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich wirst Du in den Wald gehen, und bringst Du keine Veilchen, so schlag' ich Dich tot!« drohte Holena. Die Stiefmutter faßte Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus, und schloß diese hinter ihr.
Das Mädchen ging bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war eine Fußstapfen. Die Arme irrte, irrte lange. Hunger plagte sie. Kälte schüttelte sie; sie bat Gott, er möchte sie lieber aus der Welt nehmen. Da gewahrt sie in der Ferne ein Licht. Sie geht dem Glanze nach und kommt auf den Gipfel eines Berges. Auf dem Gipfel brannte ein großes Feuer, um das Feuer lagen zwölf Steine, auf den Steinen saßen zwölf Männer. Drei waren graubärtig, drei waren jünger, drei waren noch jünger, und die drei jüngsten waren die schönsten. Sie redeten nichts, sie blickten still in das Feuer.
Die zwölf Männer waren die zwölf Monate. Der Eismonat saß obenan; der hatte Haare und Bart weiß wie Schnee. In der Hand hielt er einen Stab, Maruschka erschrak, und blieb eine Weile verwundert stehen; dann aber faßte sie Mut, trat näher und bat: »Liebe Leute, erlaubt mir, daß ich mich am Feuer wärme, Kälte schüttelt mich!« Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte sie: »Weshalb bist Du hergekommen, Mädchen? Was suchst Du hier?« - »Ich suche Veilchen,« antwortete Maruschka. - »Es ist nicht an der Zeit, Veilchen zu suchen, wenn Schnee liegt,« sagte der Eismonat. - »Ich weiß wohl,« entgegnete Maruschka traurig, »allein Schwester Holena und die Stiefmutter haben mir befohlen Veilchen aus dem Walde zu bringen; bring' ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, Ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde?« Da erhob sich der Eismonat, schritt zu dem jüngsten Monat, gab ihm den Stab in die Hand, und sprach: »Bruder März, setz' Dich obenan!« Der Monat März setzte sich obenan und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblicke loderte das Feuer höher, der Schnee begann zu tauen, Bäume trieben Knospen, unter den Buchen grünte Gras, in dem Grase keimten bunte Blumen und es war Frühling. Unter Gesträuch verborgen blühten Veilchen, und eh' sich Maruschka dessen versah, gab es ihrer so viele, als ob wer ein blaues Tuch ausgebreitet hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke!« gebot der März. Maruschka pflückte freudig, bis sie einen großen Strauß beisammen hatte. Dann dankte sie den Monaten und eilte froh nach Hause.
Es wunderte sich Holena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie Maruschka sahen, wie sie einen Veilchenstrauß trug; sie gingen, ihr die Tür zu öffnen, und der Duft der Veilchen ergoß sich durch die ganze Hütte. »Wo hast Du sie gepflückt?« fragte Holena störrig. »Hoch auf dem Berge, dort wuchsen ihrer unter Gesträuch in Mengen,« erwiederte Maruschka. Holena nahm die Veilchen, steckte sie hinter den Gürtel, roch an ihnen, und ließ die Mutter riechen; zur Schwester sagte sie nicht einmal: »Riech auch!«
Des andern Tages saß Holena müßig beim Ofen, und es gelüstete sie nach Erdbeeren. »Geh', Maruschka, bring' mir Erdbeeren aus dem Walde!« befahl Holena der Schwester. »Ach Gott, liebe Schwester, wo werd' ich Erdbeeren finden! Hab' nie gehört, daß unter dem Schnee Erdbeeren wachsen,« versetzte Maruschka. »Du nichtsnutziges Ding, Du Kröte, Du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich geh' in den Wald, und bringst Du keine Erdbeeren, wahrlich, so schlag' ich Dich tot!« drohte die böse Holena. Die Stiefmutter faßte Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus, und schloß diese fest hinter ihr. Das Mädchen ging bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war eine Fußstapfen. Die Arme irrte, irrte lange: Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie.
Da gewahrt sie in der Ferne dasselbe Feuer, das sie den Tag zuvor gesehen. Mit Freuden eilte sie darauf zu. Sie kam wieder zu dem großen Feuer, um welches die zwölf Monate saßen. Der Eismonat saß obenan. »Liebe Leute, erlaubt mir, daß ich mich am Feuer wärme, Kälte schüttelt mich,« bat Maruschka. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte: »Warum bist Du wieder gekommen, was suchst Du?« - »Ich suche Erdbeeren,« entgegnete Maruschka. - »Es ist nicht an der Zeit, Erdbeeren zu suchen, wenn Schnee liegt,« sagte der Eismonat. »Ich weiß wohl,« antwortete Maruschka traurig, »allein Schwester Holena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, Erdbeeren zu bringen; bring' ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, Ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde!«
Der Eismonat erhob sich, schritt zum Monat, der ihm gegenüber saß, gab ihm den Stab in die Hand und sprach: »Bruder Juni, setz' Dich obenan!« Der schöne Monat Juni setzte sich obenan, und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblicke schlug die Flamme hoch empor, der Schnee zerschmolz als bald, die Erde grünte, Bäume umhüllten sich mit Laub, Vögel begannen zu singen, mannigfaltige Blumen blühten im Walde und es war Sommer. Weiße Sternlein gab es, als ob sie wer dahin gesä't hätte. Sichtbar aber verwandelten sich die weißen Sternlein in Erdbeeren. Die Erdbeeren reiften schnell, und eh' sich Maruschka dessen versah, gab es ihrer in dem grünen Rasen, als ob wer Blut ausgegossen hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke!« gebot der Juni. Maruschka pflückte freudig, bis sie die Schürze voll hatte. Dann dankte sie den Monaten schön, und eilte froh nach Hause.
Es wunderte sich Holena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, daß Maruschka in der Tat Erdbeeren bringe, die ganze Schürze voll. Sie liefen, ihr die Tür zu öffnen, und der Duft der Erdbeeren ergoß sich durch die ganze Hütte. »Wo hast Du sie gepflückt?« fragte Holena störrig. - »Hoch auf dem Berge, dort wachsen ihrer in Fülle unter den Buchen,« erwiederte Maruschka. Holena nahm die Erdbeeren, aß sich satt, und gab auch der Mutter zu essen; zu Maruschka sagten sie nicht einmal: »Kost' auch!« Holena hatten die Erdbeeren geschmeckt, und es gelüstete sie des dritten Tages nach roten Äpfeln. »Geh' in den Wald, Maruschka, und bring' mir rote Äpfel!« befahl sie der Schwester. - »Ach Gott, liebe Schwester, woher sollten im Winter Äpfel kommen?« versetzte die arme Maruschka. - »Du nichtsnutziges Ding, Du Kröte, Du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich geh' in den Wald, und bringst Du keine roten Äpfel, wahrlich, so schlag' ich Dich tot!« drohte die böse Holena. Die Stiefmutter faßte Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus, und schloß diese fest hinter ihr.
Das Mädchen eilte bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war eine Fußstapfen. Allein das Mädchen irrte nicht umher, es ging gerade auf den Gipfel des Berges, wo das große Feuer brannte, wo die zwölf Monate saßen. Sie saßen dort, der Eismonat saß obenan. »Liebe Leute, erlaubt mir, daß ich mich am Feuer wärme, Kälte schüttelt mich,« bat Maruschka, und trat zum Feuer. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte: »Weshalb bist Du wieder gekommen, was suchst Du da?« - »Ich suche rote Äpfel,« antwortete Maruschka. - »Es ist nicht an der Zeit,« sagte der Eismonat. - »Ich weiß wohl,« entgegnete Maruschka traurig, »allein Schwester Holena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, rote Äpfel aus dem Wald zu bringen; bring' ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, Ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde!« Da erhob sich der Eismonat, schritt zu einem der älteren Monate, gab ihm den Stab in die Hand, und sprach: »Bruder September, setz' Dich obenan!« Der Monat September setzte sich obenan und schwang den Stab über dem Feuer. Das Feuer glühte rot, der Schnee verlor sich, aber die Bäume umhüllten sich nicht mit Laub, ein Blatt nach dem andern fiel ab, und der kühle Wind verstreute sie auf dem falben Rasen, eins dahin, das andere dorthin. Maruschka sah nicht so viele bunte Blumen. Am Talhang blühte Altmannskraut, blühten rote Nelken, im Tale standen gelbliche Eschen, unter den Buchen wuchs hohes Farnkraut und dichtes Immergrün.
Maruschka blickte nur nach roten Äpfeln umher, und sie gewahrte in der Tat einen Apfelbaum und hoch auf ihm zwischen den Zweigen rote Äpfel. »Schnell, Maruschka, schüttle!« gebot der September. Maruschka schüttelte freudig den Apfelbaum; es fiel ein Apfel herab. Maruschka schüttelte noch einmal; es fiel ein zweiter herab. »Schnell, Maruschka, eile nach Hause!« gebot der Monat. Maruschka gehorchte, nahm die zwei Äpfel, dankte den Monaten schön, und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Holena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, daß Maruschka Äpfel bringe. Sie gingen ihr öffnen. Maruschka gab ihnen die zwei Äpfel. »Wo hast Du sie gepflückt?« - »Hoch auf dem Berge; sie wachsen dort, und noch giebt's ihrer dort genug,« erwiederte Maruschka. »Warum hast Du nicht mehr gebracht? Oder hast Du sie unterwegs gegessen?« fuhr Holena zornig gegen sie los. »Ach liebe Schwester, ich habe keinen Bissen gegessen. Ich schüttelte einmal, da fiel ein Apfel herab; ich schüttelte zum zweiten Mal, da fiel noch einer herab; länger zu schütteln erlaubten sie mir nicht. Sie hießen mich nach Hause gehen,« sagte Maruschka. »Daß der Donner in Dich fahre!« fluchte Holena, und wollte Maruschka schlagen. Maruschka brach in Tränen aus, und bat Gott, er solle sie lieber zu sich nehmen, und sie nicht von der bösen Schwester und Stiefmutter erschlagen lassen. Sie floh in die Küche.
Die genäschige Holena ließ das Fluchen und begann einen Apfel zu essen. Der Apfel schmeckte ihr so, daß sie versicherte, noch niemals in ihrem Leben so was Köstliches gegessen zu haben. Auch die Stiefmutter ließ sich's schmecken. Sie aßen die Äpfel auf, und es gelüstete sie nach mehr. »Mutter, gieb mir meinen Pelz! ich will selbst in den Wald gehen,« sagte Holena. »Das nichtsnutzige Ding würde sie wieder unterwegs essen. Ich will schon den Ort finden, und sie alle herabschütteln, ob es wer erlaubt oder nicht!« Vergebens riet die Mutter ab. Holena zog den Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf, und eilte in den Wald. Die Mutter stand auf der Schwelle, und sah Holena nach, wie es ihr gehe.
Alles lag voll Schnee, nirgend war eine Fußstapfen zu schauen. Holena irrte, irrte lange; ihre Genäschigkeit trieb sie immer weiter. Da gewahrt sie in der Ferne ein Licht. Sie eilt darauf zu. Sie gelangt auf den Gipfel, wo das Feuer brennt, um das auf zwölf Steinen die zwölf Monate sitzen. Holena erschrickt; doch bald faßt sie sich, tritt näher zu dem Feuer, und streckt die Hände aus, um sich zu wärmen. Sie fragt die Monate nicht: »Darf ich mich wärmen?« und spricht kein Wort zu ihnen. »Was suchst Du hier, warum bist Du hergekommen!« fragt verdrießlich der Eismonat. - »Wozu fragst Du, Du alter Thor? Du brauchst nicht zu wissen, wohin ich gehe!« fertigt ihn Holena störrig ab, und wendet sich vom Feuer in den Wald. Der Eismonat runzelt die Stirn, und schwingt seinen Stab über dem Haupte.
In dem Augenblicke verfinstert sich der Himmel, das Feuer brennt niedrig, es beginnt Schnee zu fallen, als ob wer ein Federbett ausschüttelte, eisiger Wind weht durch den Wald. Holena sieht nicht einen Schritt vor sich; sie irrt und irrt, und stürzt in eine Schneewehe, und ihre Glieder ermatten, erstarren. Unaufhörlich fällt Schnee, eisiger Wind weht, Holena flucht der Schwester, flucht dem lieben Gott. Ihre Glieder erfrieren in dem warmen Pelz.
Die Mutter harrte auf Holena, blickte zum Fenster hinaus, blickte zur Tür hinaus, konnte aber die Tochter nicht erharren. Stunde auf Stunde verstrich, Holena kam nicht. »Vielleicht schmecken ihr die Äpfel so gut, daß sie sich nicht von ihnen trennen kann,« dachte die Mutter, »ich muß nach ihr sehen!« Sie zog ihren Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf, und ging, Holena zu finden. Alles lag voll Schnee, nirgend war eine Fußstapfen zu schauen. Sie rief Holena; niemand meldete sich. Sie irrte, irrte lange; Schnee fiel dicht, eisiger Wind wehte, Maruschka kochte das Essen, besorgte die Kuh; doch weder Holena, noch die Stiefmutter kam. »Wo bleiben sie so lange!« sprach Maruschka zu sich, und setzte sich zum Spinnrocken.
Schon war die Spindel voll, schon dämmerte es in der Stube, und es kam weder Holena, noch die Stiefmutter. »Ach Gott, was ist ihnen zugestoßen?« klagte das gute Mädchen, und sah zum Fenster hinaus. Der Himmel strahlte von Sternen, die Erde glänzte von Schnee, es ließ sich niemand sehen; traurig schloß Maruschka das Fenster, machte das Kreuz, und betete ein Vaterunser für die Schwester und Mutter. Des andern Tages harrte sie mit dem Frühstück, harrte sie mit dem Mittagsmahl; doch sie erharrte weder Holena, noch die Stiefmutter. Beide waren im Wald erfroren. Der guten Maruschka blieb die Hütte, die Kuh und ein Stückchen Feld; es fand sich auch ein Hauswirt dazu, und Beide lebten in Frieden glücklich mit einander.
Slowakei: Joseph Wenzig, Westslawischer Märchenschatz
