MÄRCHEN AUS GROSSBRITANIEN, IRRLAND, SCHOTLAND II ...
VERZEICHNIS
"Füchslein Rotrock"
"Jack Hannaford"
"Deidre von den Schmerzen"
"Die verheiratete Meermaid"
"Wo König Arthur schläft"
"Einion und die Dame vom Grünen Wald"
"Pwyll, Prinz von Dyved"
"Die drei Witwen"
"Tom der Reimer"
"Der Königssohn und der Tod"
"Die blaue Mütze"
"Magdalenchen und Kati"
"Binnorie"
"Der Robbenfänger und die Meerleute"
"Dermot mit dem Liebesfleck"
"Goldlöckchen und die drei Bären"
"Orange und Zitrone"
"Die Nachtigall und die Rose"
"Der selbstsüchtige Riese"
"Kati Knack-die-Nuss"
"Das Sternenkind"
"Der Ernteschmaus in der Eierschaale"
"Ewenn Congar"
"Der junge König"
"Der opferwillige Freund"
"Der Geburtstag der Infantin"
"Der goldne Ball"
Der goldne Ball

Vor vielen hundert Jahren lebte ein Priester, Namens Elidurus, welchem folgende Geschichte begegnet ist. Als er noch ein Knabe und ungefähr 12 Jahre alt war, da ward es ihm einst zu lästig von seinen Lehrern immer zum Lernen angehalten zu werden. Denn wenn auch der weise Salomon sagt, daß die Frucht des Studierens süß sei, so fühlte Elidurus doch jetzt nur die Bitterkeit seiner Wurzel –, und kurz – eines Tages lief er, um der Zucht und den Schlägen seines Lehrers zu entgehen, fort und versteckte sich unter dem hohlen Ufer eines Flußes. Nachdem er daselbst zwei Tage gehungert hatte, erschienen ihm zwei Männer, klein wie die Zwerge, und sagten ihm: »wenn Du mit uns gehen willst, so wollen wir Dich in ein Land voll Lust und Freude bringen!« Er willigte gleich ein, stand auf und folgte seinen Führern auf einem Pfad, der zuerst unterirdisch und finster war, endlich aber in ein gar wunderherrliches Land mit schönen Strömen und Wiesen, Wäldern und Ebnen führte. Aber das Land war dunkel und nicht von dem vollen Licht der Sonne beschienen. Die Tage waren alle trüb, und die Nächte äußerst finster, kein Mond und kein Stern war zu sehn.
Der Knabe ward vor den König geführt und ihm in Gegenwart des ganzen Hofes vorgestellt. Darauf, nachdem er längere Zeit mit ihm geredet und ihn hinreichend erforscht hatte, übergab er ihn seinem Sohne, der auch noch ein Knabe war. Diese Leute waren alle von der kleinsten Statur, aber sehr lieblich und ebenmäßig gebaut. Sie hatten schönes und glänzendes Haar, welches ihnen, wie das der Frauen, reich über die Schulter fiel. Sie aßen weder Fleisch noch Fisch, sondern lebten nur von Milchspeisen, welche in den Schüßeln mit Saffran angerichtet wurden. Sie bedienten sich niemals eines Eides; denn Nichts war ihnen so sehr verhaßt als Lügen. So oft sie aus der Oberwelt heimkehrten, tadelten sie die Eitelkeit, Untreue und Unbeständigkeit der Menschen. Sie hatten keinen Gottesdienst; das Einzige, was sie liebten und heilig hielten, war die Wahrheit.
Der Knabe kehrte oft an die Oberwelt zurück; zuweilen auf dem Weg, den er zuerst gegangen war, zuweilen auf einem andren. Das erste Mal führten ihn Einige, um ihn zurecht zu weisen; später gieng
er allein. Sein Geheimnis vertraute er nur seiner Mutter an, der er auch von den Sitten, der Natur und Beschaffenheit des Volkes erzählte.
Da diese ihn nun einstens bat, ihr etwas Gold, an welchem das unterirdische Reich Ueberfluß hatte, mitzubringen, so stahl er bei einem Spiele mit dem Sohne des Königs den goldenen Ball, mit
welchem derselbe sich zu zerstreuen pflegte, und brachte ihn seiner Mutter in großer Hast. Aber als er die Thüre seines väterlichen Hauses erreicht hatte und in aller Eile eintreten wollte, da
stolperte er über die Schwelle und schlug seiner Länge nach in die Stube, in welcher seine Mutter saß. Zugleich nahmen die beiden Zwerge, die ihm heimlich gefolgt waren, den Ball auf, der aus
seiner Hand gerollt war, und entfernten sich, indem sie den Knaben anspuckten und verhöhnten. Da er sich von seinem Fall erholt hatte, von Scham verwirrt und den schlimmen Rath seiner Mutter
verwünschend, kehrte er auf dem gewohnten Pfad zu dem unterirdischen Reiche zurück, aber er konnte den Eingang nicht wieder finden, ob er gleich ein ganzes Jahr lang suchte. Seine Freunde und
seine Mutter brachten ihn endlich wohl zurück, und da er sich den gelehrten Studien nun ernstlicher als vorher zuwandte, so ward er auch im Laufe der Jahre zum Priester ordiniert.
Aber so oft David der Zweite, Bischof von St. David, mit ihm – selbst noch in seinem Greisenalter – von diesem Ereignis sprach, so konnte Elidurus die einzelnen Umstände niemals ohne viele Tränen erzählen.
[Julius Rodenberg Märchen aus Wales]
Der Geburtstag der Infantin
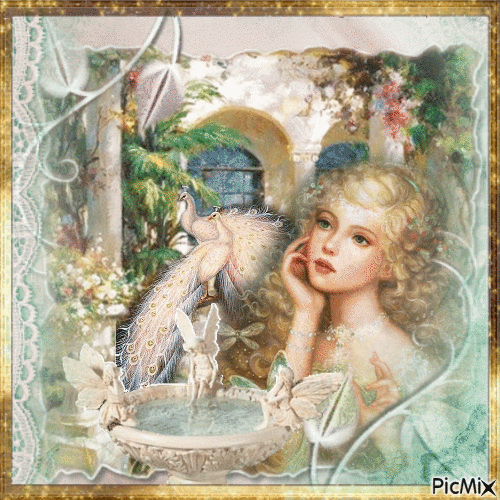
Es war der Geburtstag der Infantin. Sie war just zwölf Jahre alt, und die Sonne schien hell in den Gärten des Palastes.
Obgleich sie eine richtige Prinzessin und die Infantin von Spanien war, hatte sie nur einen einzigen Geburtstag in jedem Jahr, geradeso wie die Kinder ganz armer Leute, deshalb war es natürlich
für das ganze Land eine Sache von höchster Wichtigkeit, dass sie aus diesem Anlass einen wahrhaft schönen Tag habe. Und ein wahrhaft schöner Tag war es zweifellos. Die hohen, gestreiften Tulpen
standen kerzengerade auf ihren Stengeln wie lange Reihen Soldaten und blickten über den Rasen herausfordernd zu den Rosen und sagten: »Wir sind jetzt genauso prächtig wie ihr.« Die purpurnen
Schmetterlinge flatterten mit Goldstaub auf den Flügeln umher und besuchten der Reihe nach alle Blumen, die kleinen Eidechsen krochen aus den Rissen in der Mauer und sonnten sich in dem
blendendweißen Glast, und die Granatäpfel brachen in der Hitze auf und zeigten ihre blutenden Herzen. Selbst die blassgelben Zitronen, die in solcher Überfülle an den verwitterten Spalieren und
in den dämmrigen Bogengängen hingen, schienen von dem herrlichen Sonnenlicht eine lebhaftere Färbung erhalten zu haben, und die Magnolienbäume öffneten ihre großen, kugelförmigen EIfenbeinblüten
und erfüllten die Luft mit einem süßen, schweren Duft.
Die kleine Prinzessin selbst spazierte mit ihren Gefährten auf der Terrasse hin und her und spielte Versteck um die steinernen Vasen und die alten, moosbewachsenen Statuen. An gewöhnlichen Tagen
durfte sie nur mit Kindern ihres Ranges spielen; aber ihr Geburtstag war eine Ausnahme, und der König hatte verfügt, sie solle einladen, wen von ihren jungen Freunden sie bei sich haben wolle,
dass sie sich mit ihr vergnügten. Eine stolze Anmut lag um diese schlanken spanischen Kinder mit ihren gleitenden Bewegungen, die Knaben in ihren Hüten mit großen Federn und ihren kurzen,
flatternden Mänteln und die Mädchen, die die Schleppen ihrer langen Brokatgewänder rafften und ihre Augen mit riesigen Fächern in Schwarz und Silber vor der Sonne schützten. Doch die Infantin war
die Anmutigste von allen und am geschmackvollsten gekleidet nach der etwas hinderlichen Mode der Zeit. Ihr Gewand war aus grauem Atlas, am Saum und an den weiten, gepufften Ärmeln reich mit
Silber bestickt, und das steife Mieder war mit Reihen schöner Perlen besetzt. Zwei winzige Pantöffelchen mit blassroten Rosetten guckten, wenn sie ging, unter ihrem Kleid hervor. Blassrot und
perlgrau war ihr großer Gazefächer, und in dem Haar, das wie ein Strahlenkranz aus verblichenem Gold steif um ihr blasses Gesichtchen stand, trug sie eine schöne weiße Rose.
Von einem Fenster des Palastes aus sah ihnen der traurige, schwermütige König zu. Hinter ihm stand sein Bruder, Don Pedro von Aragon, den er hasste, und sein Beichtvater der Großinquisitor von
Granada, saß neben ihm. Trauriger noch als sonst war der König, denn als er auf die Infantin blickte, wie sie sich mit kindlicher Würde vor den herbeikommenden Höflingen verneigte oder hinter
ihrem Fächer über die grimmige Herzogin von Albuquerque, ihre ständige Begleiterin, lachte, da musste er an die junge Königin, ihre Mutter denken, die erst vor kurzem - so schien es ihm - aus dem
heiteren Frankreich gekommen und in der düsteren Pracht des spanischen Hofes dahingewelkt war; sie starb sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes und ehe sie die Mandelbäume im Obstgarten zum
zweitenmal hatte blühen sehen oder die zweite Frucht des Jahres von dem alten, knorrigen Feigenbaum gepflückt hatte, der in der Mitte des nun mit Gras überwachsenen Hofes stand. So groß war seine
Liebe zu ihr gewesen, dass er nicht einmal dem Grab gestattet hatte, sie vor ihm zu verbergen. Sie wurde von einem maurischen Arzt einbalsamiert, dem zum Dank für seine Dienste das Leben gewährt
wurde, das, wie die Leute sagten, wegen Ketzerei und des Verdachtes magischer Künste bereits der Inquisition verfallen war, und ihr Leichnam lag immer noch auf der mit Teppichen behangenen Bahre
in der schwarzen Marmorkapelle des Palastes, so wie die Mönche sie an jenem stürmischen Märztag vor nahezu zwölf Jahren hineingetragen hatten. Einmal im Monat ging der König, in einen dunklen
Mantel gehüllt und eine abgeblendete Laterne in der Hand, dorthin und kniete an ihrer Seite nieder und rief: »Mi reina! Mi reina!«, und zuweilen durchbrach er die steife Etikette, die in Spanien
jede persönliche Lebensäußerung beherrscht und selbst dem Schmerz eines Königs Grenzen setzt, und griff in wildem Herzeleid nach der bleichen, juwelengeschmückten Hand und versuchte mit seinen
wahnsinnigen Küssen das kalte, bemalte Gesicht zu erwecken.
An diesem Tag schien er sie wieder vor sich zu sehen, wie er sie zum erstenmal im Schloss Fontainebleau erblickt hatte, als sie erst fünfzehn Jahre alt war und er noch jünger. Bei dieser
Gelegenheit waren sie in Anwesenheit des französischen Königs und des gesamten Hofes von dem päpstlichen Nuntius in aller Form einander anverlobt worden, und er war in den Escorial zurückgekehrt,
wohin er eine kleine Locke gelben Haares und die Erinnerung an zwei kindliche Lippen mitnahm, die sich niederbeugten, um seine Hand zu küssen, als er in seinen Wagen stieg. Später folgten die
eilig in Burgos, einem kleinen Städtchen an der Grenze zwischen den beiden Ländern, vollzogene Eheschließung und der prächtige öffentliche Einzug in Madrid mit der üblichen Feier der Hochmesse in
der Kirche Nuestra Señora de Atocha und einem feierlicheren Autodafé als sonst, bei dem nahezu dreihundert Ketzer, darunter viele Engländer, dem weltlichen Arm zur Verbrennung überliefert wurden.
Wahrlich, er hatte sie wahnsinnig geliebt und, wie viele meinten, zum Verderben seines Landes, das damals wegen der Herrschaft über die Neue Welt mit England im Krieg lag. Er hatte ihr kaum
jemals gestattet, ihm aus den Augen zu geraten; um ihretwillen hatte er alle ernsten Staatsgeschäfte vernachlässigt oder schien sie außer acht zu lassen, und in jener schrecklichen Blindheit, mit
welcher die Leidenschaft ihre Knechte schlägt, hatte er nicht wahrgenommen, dass die sorgfältig vorbereiteten Zeremonien, mit denen er sie zu ergötzen trachtete, die sonderbare Krankheit, an der
sie litt, nur verschlimmerten. Als sie starb, war er eine Zeitlang wie einer, der seiner Vernunft beraubt ist. Tatsächlich gibt es keinen Zweifel darüber, dass er in aller Form abgedankt und sich
in das große Trappistenkloster in Granada zurückgezogen hätte, dessen Titularprior er bereits war, wenn er nicht Angst gehabt hätte, die kleine Infantin der Gewalt seines Bruders auszuliefern,
dessen Grausamkeit selbst in Spanien berüchtigt war und der von vielen verdächtigt wurde, den Tod der Königin durch ein Paar vergifteter Handschuhe herbeigeführt zu haben, die er ihr anlässlich
ihres Besuches auf seinem Schloss in Aragon geschenkt hatte. Selbst nach Ablauf der drei Jahre währenden öffentlichen Trauer, die er durch ein königliches Edikt für seinen gesamten
Herrschaftsbereich angeordnet hatte, erlaubte er seinen Ministern nie, über eine neue Heirat zu sprechen, und als der Kaiser selbst zu ihm sandte und ihm die Hand der lieblichen Erzherzogin von
Böhmen, seiner Nichte, zur Ehe anbot, hieß er die Gesandten ihrem Herrn sagen, der König von Spanien sei bereits mit der Trauer vermählt, und obgleich sie eine unfruchtbare Braut sei, liebe er
sie mehr als die Schönheit, eine Antwort, die seiner Krone die reichen Provinzen der Niederlande kostete, die sich bald darauf auf Anstiftung des Kaisers unter der Führung einiger Fanatiker der
Reformierten Kirche gegen ihn erhoben.
Sein ganzes eheliches Leben mit seinen leidenschaftlichen, glühend gefärbten Freuden und der entsetzlichen Qual seines jähen Endes schien ihm an diesem Tag wiederzukehren, als er der Infantin bei
ihrem Spiel auf der Terrasse zusah. Sie hatte in ihrem Betragen bereits ganz und gar den reizenden Übermut der Königin, die gleiche eigenwillige Art, den Kopf zurückzuwerfen, den gleichen stolz
geschwungenen, schönen Mund, das gleiche wundervolle Lächeln - in der Tat das vrai sourire de France -, wenn sie hin und wieder zu dem Fenster aufblickte oder den vornehmen spanischen Herren die
Hand zum Kuss entgegenstreckte. Doch das schrille Gelächter der Kinder verletzte seine Ohren, und das helle, erbarmungslose Sonnenlicht verhöhnte seinen Kummer, und ein dumpfiger Geruch
fremdartiger Spezereien, wie sie zum Einbalsamieren gebraucht werden, schien - oder war es nur Einbildung? - die klare Morgenluft zu verpesten. Er vergrub sein Gesicht in den Händen, und als die
Infantin abermals hochblickte, waren die Vorhänge zugezogen, und der König hatte sich entfernt.
Sie zog ein Mäulchen der Enttäuschung und zuckte die Achseln. An ihrem Geburtstag hätte er doch wahrhaftig bei ihr bleiben können. Was kam es auf die dummen Staatsgeschäfte an? Oder war er zu der
düsteren Kapelle gegangen, in der ständig Kerzen brannten und in die sie nie eintreten durfte? Wie töricht von ihm, da die Sonne so strahlend schien und jedermann so glücklich war! Außerdem würde
er den gespielten Stierkampf versäumen, zu dem schon die Trompete erscholl, gar nicht zu reden von dem Puppenspiel und den anderen wundervollen Dingen. Ihr Onkel und der Großinquisitor waren viel
gescheiter. Sie waren auf die Terrasse herausgekommen und machten ihrer Nichte Komplimente. Also warf sie ihren hübschen Kopf zurück, nahm Don Pedro bei der Hand und schritt langsam die Stufen
hinab zu einem langen Zelt aus purpurner Seide, das am Ende des Gartens errichtet war, und die anderen Kinder folgten ihr in strenger Rangordnung, die mit den längsten Namen als erste.
Ein feierlicher Zug phantastisch als Toreadore gekleideter adliger Knaben kam ihr aus dem Zelt entgegen, und der junge Graf von Tierra-Nueva, ein wunderschöner Knabe von etwa vierzehn Jahren,
entblößte seinen Kopf mit der ganzen Anmut eines geborenen Hidalgos und Granden von Spanien und führte sie feierlich hinein zu einem kleinen Sessel aus Gold und Elfenbein, der auf einer erhöhten
Estrade über der Arena stand. Die Kinder gruppierten sich überall in der Runde, bewegten ihre großen Fächer und flüsterten miteinander, und Don Pedro und der Großinquisitor standen lachend am
Eingang. Selbst die Herzogin - die Camarera mayor, wie sie genannt wurde -, ein mageres Weib mit harten Zügen und einer gelben Halskrause, sah nicht ganz so übellaunig aus wie sonst, und so etwas
wie ein frostiges Lächeln flog über ihr runzliges Gesicht und zuckte um ihre dünnen, mutlosen Lippen.
Es war zweifellos ein herrlicher Stierkampf und viel hübscher, dachte die Infantin, als der richtige Stierkampf, zu dem man sie in Sevilla geführt hatte, als der Herzog von Parma ihren Vater
besuchte. Einige der Knaben parodierten auf prächtig herausgeputzten Steckenpferden und schwangen lange Wurfspieße mit bunten Fähnchen aus leuchtenden Bändern, andere gingen zu Fuß und schwenkten
ihre scharlachroten Mäntel vor dem Stier und sprangen mühelos über die Barriere, wenn er sie angriff, und was den Stier selbst betraf, so glich er haargenau einem lebendigen Stier, obgleich er
aus Flechtwerk und gedehnter Haut gemacht war und sich mitunter darauf versteifte, auf seinen Hinterbeinen rund um die Arena zu laufen, was sich ein lebendiger Stier nie im Traum einfallen lässt.
Er lieferte auch einen herrlichen Kampf und die Kinder wurden so aufgeregt, dass sie sich von ihren Bänken erhoben und mit ihren Spitzentaschentüchern winkten und »Bravo toro! Bravo toro!«
riefen, genauso verständig, als wären sie erwachsene Leute. Am Ende jedoch, nach einem verlängerten Kampf, bei dem mehrere Steckenpferde ganz und gar durchbohrt und ihre Reiter aus dem Sattel
gehoben wurden, zwang der junge Graf von Tierra-Nueva den Stier in die Knie, und nachdem er von der Infantin die Erlaubnis erhalten hatte, ihm den coup de grtice zu geben, stieß er dem Tier
seinen hölzernen Degen mit solcher Gewalt in den Nacken, dass sogleich der Kopf abfiel und das lachende Gesicht des kleinen Monsieur de Lorraine zum Vorschein kam, des Sohns des französischen
Gesandten in Madrid.
Darauf wurde die Arena unter großem Beifall geräumt, und die toten Steckenpferde wurden von zwei maurischen Pagen in gelbschwarzen Livreen feierlich abgeschleppt, und nach einem kurzen
Zwischenspiel, das ein französischer Akrobat auf dem Straffseil ausfüllte, erschienen ein paar italienische Marionetten in der halb klassischen Tragödie >Sophonisbeden Tanz Unsrer Lieben
Frauen<, wie er genannt wurde, nur vom Hörensagen gekannt, und es war wirklich ein schöner Anblick. Die Knaben trugen altmodische Hofgewänder aus weißem Samt, und ihre sonderbaren
dreispitzigen Hüte waren mit silbernen Fransen verziert und überragt von riesigen Büschen Straußenfedern; das blendende Weiß ihrer Kostüme, als sie sich so im Sonnenlicht bewegten, wurde noch
mehr hervorgehoben durch ihre dunklen Gesichter und ihr langes schwarzes Haar. Alle waren entzückt über die gemessene Würde, mit der sie sich durch die verschlungenen Figuren des Tanzes bewegten,
und über die vollendete Anmut ihrer langsamen Gesten und vornehmen Verneigungen, und als sie ihre Vorführung beendet hatten und ihre großen Federhüte vor der Infantin zogen, nahm sie ihre
Huldigung mit großer Höflichkeit entgegen und gelobte, für den Altar Unsrer Lieben Frau von Pilar zum Dank für das Vergnügen, das sie ihr bereitet. eine große Wachskerze zu stiften.
Dann betrat eine Truppe hübscher Ägypter - wie die Zigeuner zu jener Zeit genannt wurden - die Arena; sie setzten sich mit gekreuzten Beinen im Kreise und begannen leise auf ihren Zithern zu
spielen, wobei sie den Körper nach der Melodie bewegten und mit halber Stimme ein leises, träumerisches Lied sangen. Als sie Don Pedros ansichtig wurden, warfen sie finstere Blicke auf ihn, und
manchen von ihnen sah man die Furcht an, denn erst wenige Wochen zuvor hatte er zwei ihres Stammes wegen Hexerei auf dem Marktplatz von Sevilla hängen lassen; aber die hübsche Infantin, wie sie
sich zurücklehnte und mit ihren großen blauen Augen über den Fächer guckte, bezauberte sie, und sie waren überzeugt, dass ein so liebliches Geschöpf wie sie niemals grausam gegen jemanden sein
könne. So spielten sie weiter, sehr sanft und indem sie die Saiten der Zither nur eben mit den langen, spitzen Nägeln berührten, und ihre Köpfe sanken nieder, als fielen sie in Schlaf. Plötzlich,
mit einem so geltenden Schrei, dass alle Kinder erschraken und Don Pedros Hand nach dem Achatknauf seines Dolches griff, sprangen sie auf die Füße und wirbelten wie toll in der Arena herum, ihre
Tamburins schlagend und in ihrer seltsamen, gutturalen Sprache irgendein wildes Liebeslied singend. Dann, auf ein anderes Zeichen, warfen sie sich alle wieder zu Boden und lagen ganz still, das
eintönige Klimpern der Zithern war der einzige Laut, der die Stille durchbrach. Nachdem sie dies mehrmals getan hatten, verschwanden sie für einen Augenblick und kehrten mit einem zottigen
braunen Bären zurück, den sie an der Kette führten, und ein paar kleinen Berberaffen, die sie auf der Schulter trugen. Der Bär stand mit äußerster Würde auf dem Kopf, und die runzligen Äffchen
trieben allerlei Possen mit zwei Zigeunerbuben, die ihre Lehrmeister zu sein schienen, und fochten mit winzigen Schwertern und feuerten Kanonen ab und vollführten ein regelrechtes Exerzieren,
geradeso wie des Königs Leibwache. Die Zigeuner waren in der Tat ein großer Erfolg.
Der spaßigste Teil der ganzen Vormittagsunterhaltung war jedoch zweifellos das Tanzen des kleinen Zwerges. Als er, auf seinen krummen Beinen torkelnd und mit dem großen, missgestalteten Kopf
wackelnd, in die Arena stolperte, brachen die Kinder in lautes Jubelgeschrei aus, und selbst die Infantin lachte so sehr, dass sich die Camarera genötigt sah, sie an folgende Tatsache zu
erinnern: Wenn es auch in Spanien viele Fälle gäbe, da eine Königstochter vor ihresgleichen geweint habe, so gäbe es doch kein einziges Beispiel dafür, dass eine Prinzessin von königlichem Geblüt
so vergnügt gewesen sei in Anwesenheit solcher, die ihr an Herkunft nachstünden. Doch der Zwerg war wirklich ganz unwiderstehlich, und selbst am spanischen Hofe, der von jeher dafür bekannt war,
seiner Leidenschaft für das Grässliche zu frönen, hatte man nie eine so wunderliche kleine Missgeburt gesehen. Es war auch sein erstes Auftreten. Erst tags zuvor war er, als er wie wild durch den
Wald lief, von zwei Adligen entdeckt worden, die zufällig mit anderen in einem entlegenen Teil des großen Korkeichenwaldes jagten, der die Stadt umgibt, und sie hatten ihn als eine Überraschung
für die Infantin in den Palast gebracht, da sein Vater, ein armer Köhler, nur allzu froh war, ein so hässliches und nutzloses Kind loszuwerden. Vielleicht war das Ergötzlichste an ihm, dass er
überhaupt keine Ahnung davon hatte, wie grotesk er aussah. In der Tat schien er durchaus glücklich zu sein und munterster Laune. Wenn die Kinder lachten, dann lachte er so unbefangen und fröhlich
wie nur irgendeines, und am Ende jedes Tanzes verbeugte er sich vor allen auf die drolligste Weise und lächelte und nickte ihnen zu, als gehöre er wirklich zu ihnen und wäre nicht ein
missgestaltes kleines Geschöpf, das die Natur in einer sonderbaren Laune erschaffen hatte, damit andere ihren Spaß an ihm hätten. Und die Infantin bezauberte ihn ganz und gar. Er konnte seine
Augen nicht von ihr abwenden und schien nur für sie zu tanzen, und als sie sich am Schluss seiner Darbietung daran erinnerte, wie die vornehmen Damen des Hofes dem berühmten italienischen
Sopranisten Caffarelli, den der Papst aus seiner Kapelle nach Madrid geschickt hatte, damit er durch den lieblichen Wohlklang seiner Stimme den König von seiner Schwermut heile, Blumensträuße
zugeworfen hatten, und als sie aus ihrem Haar die schöne weiße Rose löste und sie ihm, halb aus Spaß, halb um die Camarera zu ärgern, mit ihrem süßesten Lächeln durch die Arena zuwarf, da nahm er
die ganze Sache durchaus für Ernst und drückte die Blume an seine rauhen, dicken Lippen, legte die Hand auf sein Herz und sank vor ihr in die Knie, von einem Ohr bis zum andern grinsend und ein
Funkeln der Freude in seinen blanken kleinen Augen.
Das überwältigte die Würde der Infantin so sehr, dass sie noch lange, nachdem der kleine Zwerg aus der Arena gelaufen war, weiterlachte und ihrem Onkel den Wunsch kundgab, der Tanz solle
augenblicklich wiederholt werden. Die Camarera entschied jedoch, unter dem Vorwand, die Sonne brenne zu heiß, dass es besser wäre, wenn Ihre Hoheit ohne Zögern in den Palast zurückkehre, wo
bereits ein herrliches Festmahl für sie bereitstünde, einschließlich eines richtigen Geburtstagskuchens mit ihren Initialen aus buntem Zucker und einem allerliebsten silbernen Fähnchen, das von
der Spitze wehe. Also erhob sich die Infantin, höchst würdevoll, und nachdem sie Befehl gegeben hatte, dass der kleine Zwerg nach der Siestastunde abermals vor ihr tanzen solle, und nachdem sie
dem jungen Grafen von Tierra-Nueva ihren Dank für den reizenden Empfang ausgesprochen hatte, ging sie zurück in ihre Gemächer, und die Kinder folgten ihr in der gleichen Rangordnung, in der sie
eingetreten waren.
Als nun der kleine Zwerg vernahm, dass er ein zweites Mal und auf ihren ausdrücklichen Befehl vor der Infantin tanzen sollte, war er so stolz, dass er in den Garten hinauslief und in alberner
Wonneverzückung die weiße Rose küsste und sich in den wunderlichsten und unbeholfensten Gebärden erging.
Die Blumen waren ganz entrüstet über seine Dreistigkeit, in ihre schöne Heimstatt einzudringen, und als sie ihn die Spazierwege auf und nieder hüpfen und auf eine so lächerliche Weise die Arme
über dem Kopf schwenken sahen, konnten sie ihre Gefühle nicht länger zurückhalten.
»Er ist wahrhaftig bei weitem zu hässlich, um an einem Ort spielen zu dürfen, an dem wir uns befinden«, riefen die Tulpen.
»Er sollte Mohnsaft trinken und tausend Jahre schlafen«, sagten die großen Feuerlilien und wurden ganz hitzig und wütend.
»Er ist ein wahrer Graus!« schrie der Kaktus. »Er ist ja ganz krumm und klotzig, und sein Kopf steht in gar keinem Verhältnis zu seinen Beinen. Mich prickelt es richtig bei seinem Anblick, und
wenn er mir in die Nähe kommt, werde ich ihn mit meinen Stacheln pieken.«
»Und er hat tatsächlich eine meiner besten Blüten«, rief der weiße Rosenstrauch. »Ich gab sie heute morgen selber der Infantin als Geburtstagsgeschenk, und er hat sie ihr gestohlen.« Und er rief,
so laut er konnte: »Dieb, Dieb, Dieb!«
Selbst die roten Geranien, die sich sonst nicht hervortaten und dafür bekannt waren, dass sie selber eine Unmenge armer Verwandter besaßen, rümpften vor Abscheu die Nase als sie ihn sahen, und
als die Veilchen sanft bemerkten, er sei zwar höchst unschön, doch das könne er nicht ändern, erwiderten sie sehr zu Recht, das sei gerade sein Hauptfehler, und es gäbe keinen Grund, warum man
einen Menschen bewundern solle, weil er unheilbar sei, und tatsächlich hatten einige Veilchen selber das Gefühl, dass die Hässlichkeit des kleinen Zwerges nahezu protzig war und dass er viel
besseren Geschmack bewiesen hätte, wenn er traurig oder zumindest nachdenklich aussähe, statt fröhlich umherzuhüpfen und sich auf so groteske und alberne Gebärden zu verlegen.
Was die alte Sonnenuhr betraf, die eine höchst bemerkenswerte Persönlichkeit war und die einstmals keinem Geringeren als Kaiser Karl V. die Tageszeit angegeben hatte, so war sie dermaßen bestürzt
über das Äußere des kleinen Zwerges, dass sie fast zwei volle Minuten mit ihrem langen Schattenfinger anzuzeigen vergaß und nicht umhin konnte, zu dem prächtigen, milchweißen Pfau, der sich auf
der Balustrade sonnte, zu bemerken, jedermann wisse, dass die Königskinder Könige wären und die Köhlerkinder Köhler, und es sei gegen alle Vernunft, zu behaupten, dem sei nicht so; eine
Feststellung, mit welcher der Pfau völlig einverstanden war; und tatsächlich schrie er mit einer so lauten, misstönenden Stimme: »Gewiss, gewiss!«, dass die Goldfische, die in dem Becken des
kühlen, sprühenden Springbrunnens wohnten, die Köpfe aus dem Wasser streckten und die riesigen steinernen Tritonen fragten, was in aller Welt denn nur los sei.
Aber den Vögeln gefiel er irgendwie. Sie hatten ihn oft im Wald gesehen, wenn er wie ein Kobold hinter den wirbelnden Blättern her tanzte oder in der Höhlung einer alten Eiche kauerte und seine
Nüsse mit den Eichhörnchen teilte. Ihnen machte es nicht das geringste aus, dass er hässlich war. Je nun, schließlich war nicht einmal die Nachtigall, die des Nachts so süß in den Orangenhainen
sang, dass sich zuweilen der Mond hernieder beugte, um zu lauschen, besonders ansehnlich, und außerdem war er so freundlich gegen sie gewesen, und in jenem schrecklich bitterkalten Winter, als
keine Beeren an den Bäumen hingen und der Boden hart war wie Eisen und die Wölfe auf der Suche nach Futter bis zu den Toren der Stadt herabgekommen waren, hatte er sie niemals vergessen, sondern
ihnen stets Krumen von seinem kleinen Kanten Schwarzbrot abgegeben und sein Frühstück mit ihnen geteilt, wie karg es auch sein mochte.
So umkreisten sie ihn immerfort, nur eben seine Wange im Vorbeifliegen mit den Flügeln streifend, und zwitscherten miteinander, und der kleine Zwerg freute sich so sehr, dass er ihnen unbedingt
die schöne weiße Rose zeigen und ihnen erzählen musste, dass die Infantin selbst sie ihm geschenkt habe, weil sie ihn liebe.
Sie verstanden nicht ein einziges Wort von dem, was er sagte, aber das machte nichts; denn sie legten die Köpfe auf die Seite und blickten verständig drein, was gerade so gut ist, wie eine Sache
verstehen, und sehr viel bequemer.
Auch die Eidechsen fassten große Zuneigung zu ihm, und als er vom Umherlaufen müde wurde und sich ins Gras niederwarf, um auszuruhen, spielten und tollten sie auf ihm herum und versuchten ihn so
gut zu unterhalten, wie sie nur konnten. »Nicht jeder kann so schön sein wie eine Eidechse«, riefen sie, »das hieße zu viel erwarten. Und obgleich es absurd klingt, so etwas zu sagen, alles in
allem ist er eigentlich gar nicht so hässlich, vorausgesetzt natürlich, man macht die Augen zu und sieht ihn nicht an.« Die Eidechsen waren von Natur aus höchst philosophisch und hockten oft,
wenn nichts anderes zu tun oder wenn das Wetter zum Ausgehen zu regnerisch war, Stunden und Stunden beisammen und dachten nach.
Doch die Blumen waren im höchsten Grade verärgert über ihr Benehmen und über das Benehmen der Vögel. »Das beweist nur«, sagten sie, »welch eine erniedrigende Wirkung dies dauernde Umherrennen und
-fliegen hat. Wohlerzogene Leute bleiben stets an genau dem selben Platz, so wie wir es tun. Keiner hat uns je die Wege auf und nieder hopsen oder wie verrückt durch das Gras nach Libellen rennen
sehen. Wenn wir eine Luftveränderung brauchen, schicken wir nach dem Gärtner, und er setzt uns in ein anderes Beet. Das ist würdevoll und so, wie es sein sollte. Aber Vögel und Eidechsen haben
keinen Sinn für Ruhe, und die Vögel haben wahrhaftig nicht einmal eine ständige Adresse. Sie sind bloß Vagabunden wie die Zigeuner und sollten auf genau die gleiche Weise behandelt werden.« So
reckten sie ihre Nasen in die Luft und blickten sehr hochmütig drein und waren sehr froh, als sie nach geraumer Zeit den Zwerg aus dem Gras krabbeln und seines Weges gehen sahen, über die
Terrasse zu dem Palast.
»Man sollte ihn wirklich für den Rest seines Erdenlebens im Hause halten«, sagten sie. »Seht nur seinen buckligen Rücken und seine krummen Beine«, und sie kicherten.
Doch der kleine Zwerg wusste von all dem nichts. Ihm gefielen die Vögel und die Eidechsen über die Maßen, und die Blumen hielt er für das Wundervollste auf der ganzen Welt, ausgenommen natürlich
die Infantin; aber die hatte ihm auch die schöne weiße Rose gegeben, und sie liebte ihn, und das machte einen großen Unterschied. Wie sehr wünschte er sich, er wäre mit ihr zurück gegangen! Sie
hätte ihn zu ihrer Rechten befohlen und ihn angelächelt, und nie wäre er von ihrer Seite gewichen, sondern wäre ihr Spielgefährte geworden und hätte sie alle nur erdenklichen herrlichen
Kunststücke gelehrt. Denn obgleich er nie zuvor in einem Palast gewesen war, kannte er eine Unmenge wundervoller Dinge. Er konnte aus Einsen kleine Käfige für die Grashüpfer machen, dass sie
darin zirpten, und den langgliedrigen Bambus zu einer Pfeife schneiden, die Pan so gern hört. Er kannte den Ruf jedes Vogels und konnte die Stare aus dem Baumwipfel und den Reiher vom See
herbeilocken. Er kannte die Spur jedes Tieres und konnte den Hasen nach seinen schwachen Fußabdrücken und den Keiler nach den niedergetrampelten Blättern verfolgen. Alle Tänze des Windes kannte
er, den tollen Tanz in rotem Gewand mit dem Herbst, den frohen Tanz in blauen Sandalen über dem Korn, den Tanz mit weißen Schneewehen im Winter und den Blütentanz durch die Obstgärten im
Frühling. Er wusste, wo die Waldtauben ihre Nester bauten, und einmal, als ein Vogelsteller die Vogeleltern gefangen hatte, zog er die jungen selber auf und baute ihnen im Riss einer gekappten
Ulme einen kleinen Taubenschlag. Sie waren ganz zahm und fraßen ihm jeden Morgen aus den Händen. Sie würden ihr gefallen, und auch die Kaninchen, die in dem hohen Farn umherliefen, und die Häher
mit ihren stahlblauen Federn und schwarzen Schnäbeln und die Igel, die sich zu stachligen Bällen einrollten, und die großen, weisen Schildkröten, die bedächtig umherkrochen, ihre Köpfe
schüttelten und an den jungen Blättern knabberten. ja, sie musste bestimmt in den Wald kommen und mit ihm spielen. Er würde ihr sein eigenes Bettchen geben und bis zum Morgengrauen draußen vor
dem Fenster wachen und aufpassen, dass ihr das wilde Hornvieh nichts zuleide tat oder dass sich die mageren Wölfe nicht zu nahe an die Hütte heranschlichen. Und wenn es dämmerte, würde er an die
Fensterläden pochen und sie wecken, und sie würden hinausgehen und den ganzen Tag zusammen tanzen. Es war wirklich kein bisschen einsam im Wald. Manchmal ritt auf seinem weißen Maultier ein
Bischof durch den Wald und las aus einem buntbemalten Buch. Manchmal kamen in ihren grünen Samtkappen und Wämsen aus gegerbtem Hirschleder die Falkeniere vorbei, die aufgekappten Falken auf dem
Handgelenk. Zur Zeit der Weinlese kamen die Kelterer mit purpurroten Händen und Füßen, mit blankem Efeu umkränzt, und trugen tropfende Weinschläuche, und die Köhler saßen des Nachts um ihre
riesigen Kohlenpfannen und beobachteten, wie die trockenen Scheite langsam im Feuer verkohlten, und rösteten Kastanien in der Asche, und die Räuber kamen aus ihren Höhlen und schmausten mit
ihnen. Einmal hatte er auch eine schöne Prozession gesehen, die sich die lange staubige Straße nach Toledo hinaufwand. Voran gingen mit holdem Gesang die Mönche und trugen lichte Banner und
Kreuze von Gold, und dann kamen in silberner Rüstung mit Musketen und Piken die Soldaten, und in ihrer Mitte gingen drei barfüßige Männer in seltsamen, gelben Gewändern, die über und über mit
wundervollen Figuren bemalt waren, und trugen angezündete Kerzen in den Händen. Wirklich es gab im Wald eine Unmenge zu sehen, und wenn sie müde wäre, würde er ihr eine weiche Moosbank suchen
oder sie auf den Armen tragen; denn er war sehr stark, wenn auch nicht groß, wie er wusste. Er würde ihr eine Halskette aus den roten Beeren der Zaunrebe machen, die wäre dann genauso hübsch wie
die weißen Beeren an ihrem Kleid, und wenn sie ihrer überdrüssig war, konnte sie sie wegwerfen, und er würde ihr andere suchen. Er würde ihr Eichelnäpfe und mit Tau gefüllte Anemonen bringen und
winzige Glühwürmchen als Sterne für das blasse Gold ihres Haars.
Doch wo war sie? Er fragte die weiße Rose, aber sie gab ihm keine Antwort. Der ganze Palast schien zu schlafen, und selbst wo die Läden nicht geschlossen waren, hatte man schwere Vorhänge vor die
Fenster gezogen, um das blendende Licht auszuschließen. Er wanderte um den ganzen Palast und suchte nach einer Stelle, wo er hineingelangen könnte, und schließlich erblickte er eine kleine
verborgene Tür, die offen stand. Er schlüpfte hindurch und sah sich in einem herrlichen Saal, viel herrlicher, fürchtete er, als der Wald; denn überall war soviel mehr Vergoldetes, und selbst der
Fußboden war aus großen, bunten Steinen, die zu einer Art geometrischem Muster zusammengefügt waren. Aber die kleine Infantin war nicht da, nur ein paar wundervolle weiße Statuen, die von ihren
Jaspispiedestalen mit traurigen, leeren Augen und seltsam lächelnden Lippen auf ihn nieder blickten.
Am Ende des Saales hing ein reichbestickter Vorhang aus schwarzem Samt, mit Sonnen und Sternen, den Lieblingssymbolen des Königs, besät und auf jene Farbe gestickt, die ihm die liebste war.
Vielleicht verbarg sie sich dahinter? Er wollte es auf jeden Fall erforschen.
Deshalb schlich er sich leise hin und zog ihn beiseite. Nein, da war nur ein zweiter Raum, wenngleich noch hübscher, wie ihm schien, als jener, den er soeben verlassen hatte. Die Wände waren mit
einem handgearbeiteten, an Bildern reichen grünen Arrazo behangen, der eine Jagd darstellte, das Werk flämischer Künstler, die mehr als sieben Jahre gebraucht hatten, es zu schaffen. Einst hatte
das Gemach Jean le Fou gehört, wie er genannt wurde, jenem wahnsinnigen König, der so verliebt in die Jagd gewesen war, dass er in seiner Geistesverwirrung oft versucht hatte, die mächtigen, sich
räumenden Pferde zu besteigen und den Hirsch hinabzuziehen, den die großen Hetzhunde ansprangen, wozu er sein Hifthorn blies und mit seinem Dolch nach dem matten, fliehenden Wild stach. jetzt
wurde es als Beratungszimmer benutzt, und auf dem Mitteltisch lagen die roten Portefeuilles der Minister mit den in Gold geprägten Tulpen Spaniens und dem Wappen und den Emblemen des Hauses
Habsburg.
Der kleine Zwerg blickte verwundert um sich und fürchtete sich fast, weiterzugehen. Die seltsamen, schweigenden Reiter, die so hurtig durch die langen Lichtungen galoppierten, ohne das mindeste
Geräusch zu verursachen, erschienen ihm wie jene schrecklichen Gespenster, von denen er die Köhler hatte sprechen hören - die Comprachos, die nur des Nachts jagen, und wenn sie einem Menschen
begegnen, verwandeln sie ihn in eine Hindin und hetzen ihn. Doch er dachte an die hübsche Infantin und fasste sich ein Herz. Er wollte sie finden, wenn sie allein war, und ihr sagen, dass auch er
sie liebe. Vielleicht war sie in dem nächsten Zimmer.
Er lief über die weichen maurischen Teppiche und öffnete die Tür. Nein! Dort war sie auch nicht. Der Raum war ganz leer.
Es war ein Thronsaal, der zum Empfang ausländischer Gesandter benutzt wurde, wenn der König einwilligte, was in der letzten Zeit nicht oft geschehen war, ihnen eine Privataudienz zu gewähren, der
gleiche Raum, in dem vor vielen Jahren Gesandte aus England erschienen waren, um Abmachungen über die Heirat ihrer Königin, die damalige zählte zu den katholischen Souveränen Europas, mit dem
ältesten Sohn des Kaisers zu treffen. Die Wandbekleidung war aus vergoldetem Korduanleder, und ein schwerer vergoldeter Kronleuchter mit Armen für dreihundert Wachskerzen hing von der
schwarzweißen Decke. Unter einem großen Baldachin aus Goldgewebe, auf den mit Staubperlen die Löwen und Türme von Kastilien gestickt waren, stand der Thron, mit einer kostbaren Hülle aus
schwarzem Samt, die mit silbernen Tulpen besät und kunstvoll mit Silber und Perlen besetzt war. Auf der zweiten Thronstufe stand der Knieschemel der Infantin mit seinem Kissen aus Silberbrokat,
und noch tiefer und abseits vom Bereich des Thronhimmels befand sich der Sessel für den päpstlichen Nuntius, der als einziger das Recht hatte, in Gegenwart des Königs bei jedem öffentlichen
Zeremoniell zu sitzen, und dessen Kardinalshut mit den gedrehten scharlachroten Quasten auf einem purpurnen Taburett davor lag. An der Wand gegenüber dem Thron hing ein lebensgroßes Bild Karls V.
in Jagdkleidung, mit einer riesigen Bulldogge an seiner Seite, und ein Bild Philipps II., wie er die Huldigung der Niederlande empfängt, nahm die Mitte der anderen Wand ein. Zwischen den Fenstern
stand ein Schrank aus schwarzem Ebenholz mit eingelegten EIfenbeintafeln, in die Gestalten aus Holbeins Totentanz geschnitten waren - von der Hand jenes berühmten Meisters selbst, wie manche
behaupteten.
Doch der kleine Zwerg kümmerte sich nicht um die ganze Herrlichkeit. Er hätte seine Rose nicht hergegeben für alle Perlen vom Thronhimmel, nicht ein weißes Blütenblatt für den Thron selbst. Was
er sich wünschte, war, die Infantin zu sehen, ehe sie zu dem Zelt hinabging, und sie zu bitten, sie möge mit ihm fortgehen, wenn er seinen Tanz beendet habe. Hier im Palast war die Luft
bedrückend und schwer, doch im Wald blies der Wind ungehemmt, und das Sonnenlicht schob mit unsteten Goldhänden die zitternden Blätter beiseite. Es gab auch Blumen im Wald, nicht so prächtige
vielleicht wie die Blumen im Garten, aber dennoch süßer duftend: Hyazinthen im Vorfrühling, die mit wogendem Purpur die kühlen Schluchten und die grasbewachsenen Hügelkuppen überfluteten, gelbe
Schlüsselblumen, die sich in kleinen Büscheln an die knorrigen Wurzeln der Eichen schmiegten, leuchtendes Schöllkraut und blauer Ehrenpreis und Iris in Lila und Gold. An den Haselbüschen hingen
graue Kätzchen, und der rote Fingerhut neigte sich unter dem Gewicht seiner ständig von Bienen besuchten getüpfelten Stübchen. Die Kastanie hatte ihre Spitztürme weißer Sterne und der Weißdorn
seine bleichen Monde der Schönheit. ja, bestimmt würde sie mitkommen, wenn er sie nur finden könnte! Sie würde mit ihm kommen in den schönen Wald, und den ganzen Tag würde er zu ihrer Freude
tanzen. Ein Lächeln erhellte bei diesem Gedanken seine Augen, und er ging in den nächsten Raum.
Von allen Räumen war dies der prächtigste und schönste. Die Wände waren mit in sich geblümtem blassrotem Lucceser Damast bespannt, der ein Muster von Vögeln und zierlichen silbernen Blüten trug; die Möbel aus massivem Silber schmückten Blumengirlanden und schaukelnde Liebesgötter; vor den beiden gewaltigen Kaminen standen große, mit Papageien und Pfauen bestickte Paravents, und der Fußboden aus meergrünem Onyx schien sich weit in die Ferne zu dehnen. Er befand sich auch nicht allein. Unter dem Schatten des Türbogens am äußersten Ende des Raumes sah er eine kleine Gestalt stehen, die ihn beobachtete. Sein Herz bebte, ein Freudenschrei löste sich von seinen Lippen, und er trat hinaus in das Sonnenlicht. Als er es tat, trat auch die Gestalt hervor, und er nahm sie deutlich wahr.
Die Infantin? Eine Missgeburt war es, die lächerlichste Missgeburt, die er je gesehen hatte. Nicht ansehnlich von Gestalt wie alle anderen Leute, sondern bucklig und krummbeinig, mit einem
mächtigen Hängekopf und einer Zottelmähne schwarzen Haares. Der kleine Zwerg runzelte die Stirn, und die Missgeburt runzelte ebenfalls die Stirn. Er lachte, und sie lachte mit und hielt sich die
Seiten, geradeso wie er selbst. Er machte ihr eine spöttische Verbeugung, und sie erwiderte sie mit einer tiefen Reverenz. Er ging auf sie zu, und sie kam ihm entgegen, jeden Schritt nachahmend,
den er tat, und blieb stehen, wenn er selbst stehen blieb. Er jauchzte vor Vergnügen und lief vorwärts und streckte die Hand aus, und die Hand der Missgeburt berührte die seine, und sie war kalt
wie Eis. Er bekam Angst und führte seine Hand über die Brust, und die Hand der Missgeburt machte es ihr hurtig nach. Er versuchte, vorwärts zu drängen, aber etwas Glattes und Hartes gebot ihm
Einhalt. Das Gesicht der Missgeburt war jetzt dicht vor dem seinen und schien voller Entsetzen. Er strich sich das Haar aus den Augen. Sie äffte ihm nach. Er schlug nach ihr, und sie gab ihm
Schlag für Schlag zurück Er zeigte seinen Abscheu vor ihr, und sie schnitt ihm abscheuliche Gesichter. Er zog sich zurück, und sie entfernte sich von ihm.
Was war das? Er überlegte einen Augenblick und sah sich nach dem anderen Teil des Raumes um. Es war sonderbar, aber alles schien in dieser unsichtbaren Wand aus klarem Wasser sein Ebenbild zu
haben. Ja, Bild für Bild wiederholte sich und ein Ruhebett um das andere. Der schlafende Faun, der in dem Alkoven neben dem Türbogen lag, hatte seinen schlummernden Zwillingsbruder, und die
silberne Venus, die im Sonnenlicht stand, hielt ihre Arme einer ebenso lieblichen Venus entgegen.
War es das Echo? Er hatte es einmal im Tal angerufen, und es hatte ihm Wort für Wort geantwortet. Konnte es das Auge narren, wie es die Stimme nachäffte? Konnte es eine Scheinwelt schaffen,
geradeso wie die richtige Welt? Konnten die Schatten der Dinge Farbe, Leben und Bewegung haben? Konnte es sein, dass ... ?
Er erschrak, und während er von seiner Brust die schöne weiße Rose nahm, drehte er sich um und küsste sie. Die Missgeburt hatte auch eine Rose, Blatt für Blatt die gleiche! Sie küsste sie mit
gleichen Küssen und drückte sie mit grässlichen Gebärden an die Brust.
Als ihm die Wahrheit dämmerte, stieß er einen wilden Schrei der Verzweiflung aus und fiel schluchzend zu Boden. Also war er es, der missgestalt und bucklig, widerwärtig anzusehen und lächerlich
war. Er selbst war die Missgeburt, und über ihn hatten alle Kinder gelacht, und die kleine Prinzessin, von der er geglaubt hatte, sie liebe ihn - auch sie hatte sich nur über seine Hässlichkeit
lustig gemacht und ihren Spaß gehabt an seinen verdrehten Beinen. Warum hatten sie ihn nicht im Wald gelassen, wo es keinen Spiegel gab, der ihm erzählte, wie abscheulich er war? Warum hatte ihn
sein Vater nicht lieber getötet, als ihn zu seiner Schmach zu verkaufen? Heiße Tränen rannen über seine Wangen hernieder, und er zerpflückte die weiße Rose. Die auf dem Boden liegende Missgeburt
tat das gleiche und warf die welken Blütenblätter in die Luft. Sie lag bäuchlings am Boden, und wenn er sie ansah, beobachtete sie ihn mit schmerzverzerrtem Gesicht. Er kroch fort, damit er sie
nicht sähe, und bedeckte die Augen mit den Händen. Er kroch wie ein verwundetes Geschöpf in den Schatten und blieb dort stöhnend liegen.
Und in diesem Augenblick kam die Infantin mit ihren Gefährten durch die offene Fenstertür herein, und als sie den hässlichen kleinen Zwerg sahen, wie er da an der Erde lag und auf die
wunderlichste und überspannteste Weise mit seinen geballten Fäusten auf den Boden schlug, da brachen sie in einen Jubel glücklichen Gelächters aus und stellten sich um ihn und beobachteten
ihn.
»Sein Tanzen war drolliger, sagte die Infantin, »aber seine Schauspielkunst ist noch drolliger. Er ist wahrhaftig beinahe so gut wie die Marionetten, nur selbstredend nicht ganz so natürlich.«
Und sie bewegte ihren großen Fächer und applaudierte.
Aber der kleine Zwerg blickte nicht hoch, und sein Schluchzen wurde schwächer und schwächer, und plötzlich japste er auf sonderbare Weise nach Luft und griff sich in die Seite. Und dann fiel er
wieder zurück und lag ganz still.
»Famos«, sagte die Infantin nach einer Pause, »aber jetzt musst du für mich tanzen.«
»Ja«, riefen alle Kinder, »du musst aufstehen und tanzen, denn du bist so geschickt wie die Berberaffen und viel komischer.«
Doch der kleine Zwerg gab keine Antwort.
Und die Infantin stampfte mit dem Fuß auf und rief ihren Onkel an, der draußen auf der Terrasse mit dem Kämmerer spazierte und einige Depeschen las, die soeben aus Mexico angelangt waren, wo man
vor kurzem die Inquisition eingesetzt hatte. »Mein drolliger kleiner Zwerg schmollte, rief sie, »du musst ihn aufrütteln und ihm befehlen, dass er für mich tanzt.« Sie lächelten einander zu und
schlenderten hinein, und Don Pedro beugte sich nieder und schlug dem Zwerg mit seinem gestickten Handschuh auf die Wange. »Du musst tanzen, petit monstre«, sagte er. »Du musst tanzen. Die
Infantin von Spanien und den beiden Indien wünscht, unterhalten zu werden.«
Doch der kleine Zwerg rührte sich nicht.
»Man sollte einen Auspeitscher kommen lassen«, sagte Don Pedro müde und ging wieder auf die Terrasse. Der Kämmerer machte jedoch ein ernstes Gesicht und kniete sich neben den kleinen Zwerg und
legte die Hand auf sein Herz. Und wenige Augenblicke später zuckte er die Achseln und stand auf, und nach einer tiefen Verneigung vor der Infantin sagte er: »Mi bella princesa, Euer drolliger
kleiner Zwerg wird nie wieder tanzen. Schade drum, denn er ist so hässlich, dass er vielleicht den König zum Lächeln gebracht hätte.«
»Aber warum wird er nicht tanzen?« fragte die Infantin lachend.
»Weil ihm das Herz gebrochen ist«, antwortete der Kämmerer.
Und die Infantin runzelte die Stirn und warf in reizender Verachtung die hübschen rosenblättrigen Lippen auf. »In Zukunft lasst die, die zu mir spielen kommen, keine Herzen haben«, rief sie und
lief hinaus in den Garten.
Quelle: (Oscar Wilde)
Der opferwillige Freund

Eines Morgens steckte der alte Wasserratz den Kopf aus seinem Loche. Er hatte blanke Kulleraugen, einen borstigen grauen Kotelettenbart und einen Schwanz wie ein langes Stück schwarzer
Radiergummi. Die kleinen Enten schwammen auf dem Teich spazieren und sahen genau wie ein Schwarm gelber Kanarienvögel aus, und ihre Mutter, die ganz reinweiß war mit echtroten Beinen, versuchte
ihnen beizubringen, wie man im Wasser Kopf steht.
"Ihr werdet niemals zur feinsten Gesellschaft zugelassen werden, wenn ihr nicht Kopf stehen könnt", sagte sie unausgesetzt zu den Kleinen; und alle Augenblicke führte sie ihnen von neuem vor, wie
man's macht. Aber die kleinen Enten passten überhaupt nicht auf. Sie waren noch so jung und unerfahren, dass sie nicht wussten, von welch großem Nutzen es ist, zur feinen Gesellschaft zugelassen
zu sein. "Was für ungehorsame Kinder!" schrie der alte Wasserratz, "sie verdienten weiß Gott, dass man sie ertränkte."
"Beileibe nicht!" erwiderte die Ente, "es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und Eltern können nie geduldig genug sein."
"Ach so! Ich verstehe nichts von elterlichen Gefühlen", sagte der Wasserratz, "ich bin kein Familienmensch. Ob Sie's glauben oder nicht - Tatsache ist, dass ich niemals verheiratet war, und ich
habe auch nicht im Sinn, es nachzuholen. Liebe ist auf ihre Art ja sehr hübsch, aber Freundschaft ist weitaus erhabener. Ich wüsste wahrhaftig nichts auf der Welt, das edler oder auch seltener
wäre als aufopfernde Freundschaft."
"Und was, wenn ich bitten darf, sind Ihrer Meinung nach die Pflichten eines opferwilligen Freundes?" fragte ein Grünhänfling, der nahebei in einem Weidenbaume saß und der Unterhaltung zugehört
hatte. "Ja, das würde mich auch furchtbar interessieren", sagte die Ente und schwamm davon bis ans Ende des Teiches und stellte sich auf den Kopf, um ihren Kindern ein gutes Beispiel zu
geben.
"So , ne dumme Frage!" rief der Wasserratz. "Ich würde selbstverständlich erwarten, dass mein opferwilliger Freund sich für mich opfert."
"Und was würden Sie als Gegenleistung für ihn tun?" fragte der kleine Vogel und schaukelte sich, mit den zierlichen Flügeln schlagend, auf einem silbrig grauen Zweige. "Ich verstehe Sie nicht",
entgegnete der Wasserratz. "so will ich Ihnen eine Geschichte zu dem Thema erzählen", sagte der Hänfling.
"Handelt sie von mir?" fragte der Wasserratz. "In diesem Falle will ich sie mir anhören, denn ich bin ganz verrückt auf Romane aus dem Leben."
"Die Geschichte lässt sich auf Sie anwenden", sagte der Hänfling; und er flog herab, setzte sich auf die Uferböschung und erzählte die
Geschichte vom opferwilligen Freund.
"Es war einmal", begann der Hänfling, "es war einmal ein redlicher Bursche, der hieß Hans."
"War er was Großes, was Ausgezeichnetes?" fragte der Wasserratz.
"Nein", antwortete der Hänfling, "ich glaube kaum, dass irgend etwas groß an dem kleinen Hans war außer seiner Herzensgüte, auch zeichnete ihn wohl nichts weiter aus als sein lustiges, gutmütiges
Vollmondgesicht. Er wohnte ganz für sich in einem kleinen Hüttchen und arbeitete jeden Tag in seinem Garten. In der ganzen Gegend war kein Garten so schön wie seiner. Federnelken wuchsen darin
und Goldlack und Hirtentäschel und Eisenhut. Da waren gelbe Rosen und rote Damaszenerrosen, lila Krokus und goldener, und purpurne und weiße Veilchen. Akelei und Wiesenschaum, Majoran und
Basilienkraut, Himmelschlüsselchen und Lilien, Narzissen und Nelken sprossen und blühten da jedes zu seiner Zeit, wie die Monate es brachten, und eine Blume trat an der vorigen Statt, so dass es
stets viel Schönes anzuschauen und liebliche Düfte zu atmen gab.
Der kleine Hans hatte sehr viele Freunde, aber der aufopferndste von allen war der Müller, der große dicke Hugho. ja, eine so selbstlose Zuneigung hegte der reiche Müller für den kleinen Hans,
dass er nie an dessen Garten vorübergehen konnte, ohne sich über das Mäuerchen zu lehnen und einen gewaltigen Blumenstrauß oder eine Handvoll würziger Kräuter zu pflücken oder sich die Taschen
mit Pflaumen und Kirschen vollzustopfen, wenn gerade die Reifezeit war.
Wahre Freunde sollten alles gemeinsam besitzen, sagte er dann stets, und der kleine Hans nickte dazu und lächelte und war sehr stolz, einen Freund mit solch hohen Gedanken zu haben.
Bisweilen fanden es die Nachbarn zwar sonderbar, dass der reiche Müller dem kleinen Hans niemals etwas als Gegengabe brachte, obwohl er hundert Säcke feinstes Mehl besaß, die in seiner Mühle
aufgespeichert standen, und sechs Milchkühe und eine große Herde wollige Schafe; aber Hans zerbrach sich den Kopf über solche Dinge nicht, und er kannte kein größeres Vergnügen, als all den
wunderbaren Worten zu lauschen, die der Müller unermüdlich über die Uneigennützigkeit echter Freundschaft zu sagen wusste.
Der kleine Hans arbeitete also tagaus, tagein in seinem Garten. Im Frühling, im Sommer und im Herbst war er froh und glücklich, doch wenn dann der Winter kam und er nicht Obst noch Blumen auf den
Markt zu bringen hatte, litt er recht arg durch Hunger und Kälte, und oftmals musste er sich schlafen legen, ohne etwas anderes gegessen zu haben als ein paar gedörrte Birnen oder einige trockene
Nüsse. Auch war er im Winter ganz mutterseelenallein, denn der Müller kam dann nie zu ihm. ,Es hätte keinen Zweck, wenn ich zu dem kleinen Hans ginge, solange noch Schnee liegt', pflegte er zu
seiner Frau zu sagen. Wenn einer Kummer hat, soll man ihn in Ruhe lassen und ihn nicht mit Besuchen quälen. Ich jedenfalls hege diese Vorstellung von Freundschaft, und ich bin fest überzeugt, ich
habe damit recht. Deshalb werde ich bis zum Frühling warten und ihn dann aufsuchen, denn erst im Frühling kann er mir einen großen Korb voll Schlüsselblumen geben, und darüber wird er sich so
herzlich freuen.'
,Du bist wahrhaftig sehr rücksichtsvoll gegen andere', erwiderte seine Frau, die behaglich in ihrem Lehnstuhl neben dem großen Kiefernholzfeuer saß, "sehr, sehr rücksichtsvoll. Es ist ein wahrer
Genuss, dich über die Freundschaft sprechen zu hören. Ich sage dir, der Pfarrer selbst kann nicht so erbaulich reden wie du, und dabei wohnt er in einem dreistöckigen Hause und trägt einen
goldenen Ring am kleinen Finger.'
'Aber könnten wir den kleinen Hans nicht zu uns einladen?!' sagte des Müllers Jüngster. 'Wenn der arme Hans traurig ist, will ich ihm die Hälfte von meinem Haferbrei abgeben und ihm meine weißen
Kaninchen zeigen!' 'Dummer Junge!' schrie der Müller, 'ich möchte wirklich wissen, was für einen Zweck es hat, dich in die Schule zu schicken. Mir scheint, du wirst immer dümmer statt klüger.
Verstehst du nicht - wenn der kleine Hans zu uns heraufkäme und unsern warmen Kamin sähe und unser gutes Essen und unser großes Fass voll rotem Wein, da könnte er neidisch werden, und Neid ist
etwas ganz Schlimmes und verdirbt jeden Charakter. Ich aber werde es keinesfalls zulassen, dass Hansens Charakter verdorben wird. Ich bin sein bester Freund, und ich werde stets über ihn wachen
und Sorge tragen, dass keiner ihn in Versuchung führt. Und noch eins: wenn Hans hierher käme, würde er mich vielleicht bitten, ihm etwas Mehl auf Kredit abzulassen, und das könnte ich nicht tun.
Mehl ist eines, und Freundschaft ist ein anderes, und sie dürfen nicht miteinander vermengt werden.
Die beiden Wörter klingen ganz verschieden, und folglich bedeuten sie auch etwas ganz Verschiedenes. Ich dächte, das sieht jedes Kind.' 'Wie gut du sprichst!' sagte die Müllersfrau und schenkte
sich ein großes Glas Warmbier ein, 'ich bin ganz schläfrig dabei geworden. Es ist genau, als ob man in der Kirche sitzt.'
'Viele, viele Leute handeln gut', erwiderte der Müller, 'aber sehr wenige sprechen gut, woraus erhellt, dass Sprechen das weitaus Schwierigere von beiden ist, und das viel Vornehmere dazu.' Und
er schoss quer über den Tisch einen strengen Blick nach seinem kleinen Jungen, der vor lauter Scham über seine Dummheit den Kopf hängen ließ und ganz puterrot anlief und in seinen Tee zu weinen
begann. Na ja, er war noch so klein, dass ihr's ihm nicht übel nehmen dürft."
"Ist das der Schluss von der Geschichte?" fragte der Wasserratz.
"Aber nein", antwortete der Hänfling, "das ist der Anfang. "
"Dann sind Sie ganz und gar nicht auf der Höhe Ihrer Zeit", sagte der Wasserratz. jeder gute Schriftsteller fängt heutzutage seine Geschichte am Ende an und geht dann auf den Anfang über und
schließt mit der Mitte. Das ist die neue literarische Mode. Ich habe es kürzlich ganz genau von einem Kritiker gehört, der mit einem jungen Mann um den Teich herumwandelte. Er sprach sehr
ausführlich über diese Materie, und bestimmt hatte er mit allem recht, was er sagte, denn er trug eine blaue Brille zu seinem Kahlkopf, und jedes mal wenn der junge Mann eine Bemerkung einwarf,
machte er nur immer 'Pah!' Aber bitte, fahren Sie in Ihrer Geschichte fort. Der Müller gefällt mir ganz ungemein. Ich habe selber schöne Gefühle aller Art, und das schafft eine tiefe
Seelenverwandtschaft zwischen uns."
"Gut", sagte der Hänfling und hüpfte bald auf dem rechten, bald auf dem linken Bein. Als der Winter vorüber war und die Schlüsselblumen ihre blassgelben Sterne eben aufgetan hatten, sagte der
Müller zu seiner Frau, er wolle nun hinübergehen und den kleinen Hans besuchen. 'Nein, was für ein gutes Herz du hast!' rief die Frau, du denkst doch in einem fort an die anderen. Und vergiss
nicht, den großen Korb für die Blumen mitzunehmen.'
Also band der Müller die Flügel der Windmühle mit einer starken Eisenkette fest und ging den Hügel hinab, den Korb am Arm.
'Guten Morgen, kleiner Hans', sagte der Müller.
,Guten Morgen', sagte Hans und lehnte sich auf seinen Spaten und lachte von einem Ohr zum andern. ,Und wie ist dir's den ganzen Winter durch ergangen?' fragte der Müller.
,Oh, danke', rief Hans, ,du bist sehr gütig, dich danach zu erkundigen, wirklich sehr gütig. Offen gesagt, ich habe eine ziemlich böse Zeit hinter mir, aber nun ist der Frühling da, und ich bin
wieder ganz vergnügt, und alle meine Blumen gedeihen.'
,Wir haben während des Winters oft von dir gesprochen, Hans', sagte der Müller, ,und uns gefragt, wie dir's gehen mag.'
'Das war sehr lieb von euch', sagte Hans, ich hatte schon ein bisschen Angst, ihr hättet mich vergessen.' ,Hans, ich muss mich über dich wundern', sagte der Müller. ,Freundschaft vergisst
niemals. Das ist ja das Wundervolle an ihr; aber ich fürchte, du begreifst die Poesie des Lebens nicht. Nebenbei bemerkt - wie hübsch deine Schlüsselblumen sind!'
,Ja, sie sind wirklich sehr hübsch', sagte Hans, ,und es ist ein großes Glück für mich, dass ich ihrer so viele habe. Ich will sie auf den Markt bringen und sie der Tochter des Bürgermeisters
verkaufen, und mit dem Geld werde ich meinen Schubkarren auslösen.' ,Deinen Schubkarren auslösen? Willst du damit etwa sagen, du hast ihn verkauft? Das wäre eine schöne Dummheit von dir
gewesen!'
,Na ja', antwortete Hans, ,die Wahrheit zu sagen, ich konnte nicht anders. Den ganzen Winter ist's so ärmlich bei mir zugegangen, verstehst du, dass ich nicht mal das Geld hatte, mir Brot zu
kaufen. Da verkaufte ich zuerst die silbernen Knöpfe von meinem Sonntagsrock, und dann verkaufte ich meine silberne Kette, und dann verkaufte ich meine lange Tabakspfeife, und zuletzt verkaufte
ich meinen Schubkarren. Aber jetzt werde ich alles wieder zurückkaufen.'
,Hans', sagte der Müller, ,ich schenke dir meinen eigenen Schubkarren. Er ist nicht eben im besten Zustand; die eine Seite fehlt ganz, und auch an den Radspeichen ist verschiedenes entzwei, aber
trotz alledem will ich ihn dir schenken. Ich weiß, das ist sehr edelmütig von mir, und die Leute werden mich für äußerst töricht halten, weil ich mich von dem Schubkarren trenne; aber ich bin
anders als der gemeine Haufen. Meiner Meinung nach ist Edelmut das innerste Wesen der Freundschaft, und außerdem habe ich mir einen neuen Schubkarren zugelegt. jawohl, sei gutes Muts und mach dir
keine Kopfschmerzen - ich schenke dir meinen Schubkarren.'
,Ach, das ist wirklich sehr edelmütig von dir', sagte der kleine Hans, und sein lustiges rundes Gesicht strahlte über und über vor Freude. ,Ich kann ihn auch leicht reparieren, denn ich habe ein
schönes Brett bei mir im Haus.' ,Ein schönes Brett!' sagte der Müller, ,sieh an, das ist genau das, was ich für mein Scheunendach brauche. Mein Scheunendach hat nämlich ein gewaltig großes Loch,
und das Korn wird ganz feucht werden, wenn ich nicht etwas drüber nagle. Welch ein Glück, dass du davon gesprochen hast! Es ist doch erstaunlich, wie eine gute Tat stets eine zweite nach sich
zieht. Ich habe dir meinen Schubkarren geschenkt, und nun willst du mir dein Brett schenken. Natürlich ist mein Schubkarren viel mehr wert als dein Brett, aber wahre Freundschaft rechnet nicht.
Bitte, hol es gleich, damit ich noch heute mit der Arbeit an meiner Scheune beginnen kann.'
,Gern', rief der kleine Hans, und er rannte in den Schuppen und schleppte das Brett heraus. ,Es ist gerade kein sehr großes Brett', sagte der Müller und schaute es prüfend an, ,und ich glaube
fast, wenn ich mein Scheunendach damit ausgebessert habe, wird nichts für dich übrigbleiben, um den Schubkarren zu reparieren; aber selbstverständlich ist das nicht meine Schuld. Und jetzt, da
ich dir meinen Schubkarren geschenkt habe, wirst du mir sicherlich gern ein paar Blumen als Gegengabe schenken. Hier ist der Korb, sieh nur zu, dass er bis oben voll wird.' ,Bis oben voll?' sagte
der kleine Hans etwas bekümmert, denn der Korb war wirklich sehr groß, und er wusste, dass keine Blumen für den Markt übrigbleiben würden, wenn er ihn bis oben füllte; und ihm lag sehr viel
daran, seine Silberknöpfe wiederzubekommen. ,Aber gewiss', antwortete der Müller. ,Da ich dir meinen Schubkarren geschenkt habe, halte ich es nicht für unbillig, dass ich dich um ein paar
Blümchen bitte. Vielleicht irre ich mich, aber ich sollte meinen, Freundschaft, wahre Freundschaft, ist ganz frei von jeder Art Eigennutz.' ,Lieber Freund, bester Freund!' rief der kleine Hans,
,alle Blumen meines Gartens sind dein. Mir liegt jederzeit viel mehr an deiner guten Meinung als an meinen silbernen Knöpfen.' Und er lief und pflückte alle seine schönen Schlüsselblumen und
füllte den Korb des Müllers bis oben hin.
,Auf Wiedersehen, kleiner Hans', sagte der Müller, als er mit dem Brett auf der Schulter und dem großen Korb in der Hand den Hügel hinanstieg.
,Auf Wiedersehen', sagte der kleine Hans und machte sich höchst vergnügt wieder ans Graben; er freute sich so sehr über den Schubkarren.
Am nächsten Tag band er gerade ein paar Geißblattranken über der Tür fest, als er den Müller hörte, der von der Straße her nach ihm rief. Er sprang also von der Leiter, lief hinab in den Garten
und blickte über die Mauer. Da stand der Müller mit einem großen Sack Mehl auf dem Rücken.
,Lieber kleiner Hans', sagte der Müller, würde es dir was ausmachen, diesen Sack Mehl für mich auf den Markt zu bringen?'
,Oh, das tut mir wirklich leid', sagte Hans, ,aber ich habe heute sehr viel zu tun. Ich muss all meine Schlingpflanzen aufbinden und all meine Blumen gießen und meinen ganzen Rasen walzen.'
,In der Tat', sagte der Müller, ,wenn ich recht bedenke, dass ich dir meinen Schubkarren schenken will, finde ich es sehr wenig freundschaftlich von dir, mir den kleinen Gefallen zu
verweigern.'
,Ach, sprich nicht so', rief der kleine Hans, ,nicht um alles in der Welt möchte ich unfreundschaftlich gegen dich sein.' Und er lief nach seiner Mütze und keuchte mit dem großen Sack auf den
Schultern davon.
Es war ein sehr heißer Tag, und die Landstraße war entsetzlich staubig, und ehe Hans den sechsten Meilenstein erreicht hatte, fühlte er sich so matt, dass er sich niedersetzen und ausruhen
musste. Aber gleich ging er tapfer weiter und gelangte endlich zum Markt. Nachdem er dort eine Weile gewartet hatte, verkaufte er den Sack Mehl zu einem sehr günstigen Preis und kehrte dann
unverzüglich heim; denn er fürchtete unterwegs den Räubern in die Hände zu fallen, wenn er sich länger aufhielte.
,Das war mal ein schwerer Tag heut', sagte der kleine Hans zu sich selber, als er ins Bett ging, ,aber ich freue mich doch, dass ich's dem Müller nicht abgeschlagen habe. Er ist ja mein bester
Freund, und überdies will er mir seinen Schubkarren schenken.'
Früh am nächsten Morgen kam der Müller herüber, das Geld für den Sack Mehl zu holen; der kleine Hans jedoch war so müde, dass er noch im Bett lag.
,So wahr ich hier stehe', sagte der Müller, ,du bist sehr faul. Ich dächte, da ich dir doch meinen Schubkarren schenken will, solltest du fürwahr fleißiger arbeiten. Müßiggang ist aller Laster
Anfang, und ich sehe sehr ungern, wenn einer meiner Freunde träge oder saumselig ist. Du darfst mir's nicht übel nehmen, dass ich so unumwunden mit dir rede. Wäre ich nicht dein Freund, so würde
mir das natürlich nicht im Traume einfallen. Welchen Nutzen aber hätte die Freundschaft, wenn man unter Freunden nicht aufrichtig seine Meinung sagte? Komplimente machen, Wohlgefallen zu erregen
trachten und schmeicheln, das kann ein jeder; doch der wahre Freund spricht immer Unangenehmes und trägt kein Bedenken, auch wehzutun. ja, dem wahren Freund von echtem Schrot und Korn ist dies
sogar das liebste, denn er weiß, dass Wehtun Wohltun ist.' ,Verzeih, ich wollte dich nicht erzürnen', sagte der kleine Hans, während er sich den Schlaf aus den Augen rieb und seine Nachtmütze
abnahm, aber weil ich gar so müde war, dachte ich mir, ich könnte eigentlich noch ein bisschen liegen bleiben und den Vögeln zuhören. Weißt du, die Arbeit geht mir stets besser von der Hand, wenn
ich vorher die Vögel habe singen hören.'
,So? das freut mich', sagte der Müller und klopfte dem kleinen Hans auf den Rücken, ,denn ich möchte, dass du zur Mühle hinaufkommst, sobald du dich angezogen hast, und mir mein Scheunendach
ausbesserst.'
Der arme kleine Hans brannte zwar darauf, in seinem Garten zu arbeiten, denn er hatte die Blumen seit zwei Tagen nicht mehr gegossen; aber er wollte dem Müller die Bitte nicht abschlagen, da
dieser doch ein so guter Freund von ihm war.
,Würdest du's für sehr unfreundschaftlich von mir halten, wenn ich sagte, ich hätte viel zu tun?' fragte er ganz behutsam und schüchtern.
,Allerdings', antwortete der Müller, ,ich glaube, es ist nicht zu viel von dir verlangt, da ich dir ja meinen Schubkarren schenken will; aber wenn du nicht magst, werde ich selbstverständlich
alles selber machen.' ,Oh, auf keinen Fall!' rief der kleine Hans; und er sprang aus dem Bett und zog sich an und ging hinaus zu der Scheune.
Dort werkte er den ganzen Tag bis zum Sonnenuntergang, und bei Sonnenuntergang kam der Müller, um zu sehen, wie es mit der Arbeit vorwärts ging. ,Hast du das Loch im Dach schon repariert, kleiner
Hans?' rief der Müller fröhlichen Tones. ,Es ist fertig ausgebessert', antwortete der kleine Hans und stieg die Leiter hinab.
,Ah!' sagte der Müller, nichts gewährt uns größere Befriedigung als die Arbeit, die wir für andere verrichten.' ,Es ist wirklich ein großer Vorzug, dich reden zu hören', erwiderte der kleine Hans
und setzte sich nieder und wischte den Schweiß von der Stirn, ,ein sehr großer Vorzug sogar. Ich fürchte freilich, mir werden niemals so schöne Gedanken kommen wie dir.' ,Oh! das wird schon
werden', sagte der Müller, du musst dir nur mehr Mühe geben. Vorläufig übst du die Freundschaft nur praktisch aus; eines Tages aber wirst du auch ihre Theorie begreifen.'
,Meinst du wirklich?' fragte der kleine Hans.
,Unbedingt', antwortete der Müller. ,Doch nun, da du das Dach ausgebessert hast, solltest du lieber nach Hause gehen und dich ausruhen, denn ich möchte, dass du morgen meine Schafe auf den Berg
treibst.'
Der arme kleine Hans hatte Angst, irgend etwas dagegen zu sagen, und am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe brachte der Müller seine Schafe hinüber zu Hansens Häuschen, und der ging mit ihnen
auf den Berg. Er brauchte den ganzen Tag, um hinauf und wieder hinunter zu gelangen; und als er heimkehrte, war er so müde, dass er in seinen Stuhl sank und schlief, und er wachte nicht auf, bis
es helllichter Tag geworden war.
,Wie herrlich werde ich heut in meinem Garten arbeiten' sagte er und machte sich unverweilt ans Werk.
Aber mal aus diesem Grunde, mal aus jenem - nie hatte er Zeit, sich um seine Blumen zu kümmern; denn immerzu kam sein Freund, der Müller, herüber und schickte ihn fort mit langwierigen Aufträgen
oder holte ihn, damit er in der Mühle half. Der kleine Hans war mitunter ganz niedergeschlagen, weil er fürchtete, seine Blumen könnten glauben, er habe sie vergessen. Aber dann tröstete er sich
wieder mit dem Gedanken, dass der Müller doch sein bester Freund war. ,Zudem', sagte er sich stets, ,will er mir seinen Schubkarren schenken, und das ist ein Akt reinen Edelmuts.'
So arbeitete der kleine Hans weiter für den Müller, und der Müller sagte allerhand Schönes über die Freundschaft, was Hans wortwörtlich in ein Notizbuch eintrug und nachts immer wieder durchlas,
denn er war ein sehr gewissenhafter Schüler.
Eines Abends nun saß der kleine Hans noch spät an seinem Kamin, als es laut an der Tür klopfte. Die Nacht war dunkel und schaurig, und der Wind fuhr mit so wildem Getöse ums Haus, dass Hans
zunächst dachte, es sei nur der Sturm. Aber ein zweites Klopfen folgte, und dann ein drittes, lauter als jedes zuvor.
,Das ist ein armer Wandersmann', sagte der kleine Hans bei sich und lief an die Tür.
Da stand der Müller mit einer Laterne in der einen Hand und einem großen Stecken in der anderen. ,Lieber, kleiner Hans', rief der Müller, ,ich bin in großer Bedrängnis. Mein kleiner Junge ist von
der Leiter gestürzt und hat sich verletzt, und ich muss den Doktor holen. Aber der wohnt so weit weg, und die Nacht ist so schlimm, dass mir eben eingefallen ist, es wäre doch viel besser, wenn
du statt meiner hingingest. Du weißt, ich will dir meinen Schubkarren schenken, und da ist es doch nur in der Ordnung, wenn du mir auch einmal einen Gegendienst leistest.'
,Gewiss', rief der kleine Hans, ,ich betrachte es als eine große Ehre, dass du zu mir gekommen bist, und will sofort aufbrechen. Aber leih mir bitte deine Laterne, denn bei der Finsternis heute
Abend könnte ich sonst den Weg verfehlen und in den Graben fallen.'
,Leider', erwiderte der Müller, ,leider ist das meine neue Laterne, und wenn ihr etwas zustieße, wäre das ein sehr empfindlicher Schaden für mich.' ,Gut, macht nichts, es geht auch so', rief der
kleine Hans, und er nahm seinen großen Pelzrock vom Nagel und seine warme rote Tuchkappe und band sich einen Schal um den Hals und machte sich auf den Weg.
Was tobte da für ein fürchterlicher Sturm! Die Nacht war so schwarz, dass der kleine Hans kaum sehen konnte, und der Wind wehte so heftig, dass er sich nur mit Mühe auf den Beinen hielt. Er
ertrug aber alles sehr tapfer, und nach drei Stunden Weges kam er zum Doktorhaus und pochte an die Tür.
,Wer ist da?' rief der Arzt und steckte den Kopf zum Schlafzimmerfenster heraus. ,Der kleine Hans, Doktor.' ,Was willst du denn, kleiner Hans?' ,Der Junge vom Müller ist die Leiter runtergefallen
und hat sich was getan, und der Müller lässt sagen, Sie möchten doch gleich hinkommen.'
,Gut!' sagte der Doktor; und er rief nach seinem Pferd und seinen großen Stiefeln und seiner Laterne und kam die Treppe herab und ritt davon nach des Müllers Hause, der kleine Hans aber stapfte
hinter ihm drein.
Doch der Sturm wurde schlimmer und schlimmer, und es regnete in Strömen, und der kleine Hans konnte nicht sehen, wohin er lief, und nicht mit dem Pferd gleichen Schritt halten. Zum Schluss kam er
vom Wege ab und verirrte sich ins Moor, wo es sehr gefährlich war, denn das Moor war voll tiefer Wasserlöcher; und in einem davon ertrank der arme kleine Hans. Sein Leichnam wurde, in einem
großen Tümpel treibend, am nächsten Tage von ein paar Ziegenhirten aufgefunden und nach seinem Häuschen gebracht.
Die ganze Gegend ging mit bei seinem Begräbnis, denn alle hatten den kleinen Hans gekannt und gerne gehabt, und der Müller war der Hauptleidtragende. ,Da ich sein bester Freund gewesen bin',
sagte der Müller, ,ist es nur recht und billig, dass ich den besten Platz einnehme.' Und so schritt er im langen schwarzen Rock an der Spitze des Trauerzuges, und dann und wann wischte er sich
mit einem großen Taschentuch die Augen.
,Jedem von uns wird der kleine Hans bestimmt sehr fehlen', sagte der Schmied, als das Begräbnis vorüber war und alle bei Glühwein und süßen Kuchen gemütlich im Wirtshaus beisammen saßen.
,Mir jedenfalls wird er wirklich fehlen', erwiderte der Müller. jawohl, ich hatte ihm meinen Schubkarren schon so gut wie geschenkt, und nun weiß ich beim besten Willen nicht, was ich damit
anfangen soll. Er steht mir zu Hause immerzu im Wege, und er ist in so schlechtem Zustand, dass ich nichts dafür bekäme, wenn ich ihn verkaufte. Ich will mich fortan hüten, je wieder irgend etwas
zu verschenken. Man hat bloß den Schaden für seinen Edelmut.' "Nun, und weiter?" sagte der Wasserratz nach einer langen Pause.
"Nun, das ist der Schluss", sagte der Hänfling. "Aber was wurde aus dem Müller?" fragte der Wasserratz. "Oh, das weiß ich wahrhaftig nicht", antwortete der Hänfling, "und es ist mir auch ganz
einerlei."
"Daraus ersieht man deutlich, Sie sind keiner Anteilnahme fähig", sagte der Wasserratz.
"Ich fürchte, Sie begreifen die Moral der Geschichte nicht ganz", bemerkte der Hänfling.
"Die was?" kreischte der Wasserratz.
"Die Moral."
"Wollen Sie damit sagen, dass die Geschichte eine Moral hat?"
"Gewiss", sagte der Hänfling.
"Zum Kuckuck", sagte der Wasserratz höchst erbost, "ich dächte, Sie hätten mir das sagen können, bevor Sie anfingen. Dann hätte ich Ihnen nämlich ganz bestimmt nicht zugehört; im Gegenteil, ich
hätte 'Pah!' gesagt wie der Kritiker neulich. Immerhin kann ich's ja jetzt nachholen." Und er brüllte aus vollem Halse: "Pah!", schwenkte den Schwanz und kroch in sein Loch zurück.
"Und wie gefällt Ihnen der Wasserratz?" fragte die Ente, die ein paar Minuten danach angerudert kam. "Er hat eine Menge hervorragende Eigenschaften, ich für meine Person aber hege die Gefühle
einer Gattin und Mutter, und ich kann einen eingefleischten Junggesellen nicht ansehen, ohne dass mir die Tränen kommen."
"Mir scheint, er hat sich über mich geärgert", meinte der Hänfling, "und zwar, weil ich ihm eine Geschichte mit einer Moral erzählt habe."
"Ah! Das ist immer ein sehr gefährliches Unterfangen" sagte die Ente.
Und ich gebe ihr vollkommen recht.
Quelle: (Oscar Wilde)
Der junge König
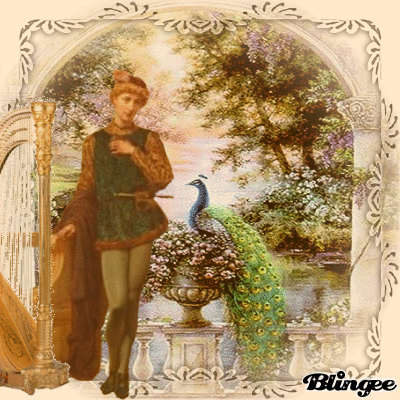
Es war der Abend vor dem anberaumte Tag seiner Krönung, und der junge König saß allein in seinem schönen Gemach. All seine Höflinge hatten sich, nach dem zeremoniellen Brauch der Zeit die Köpfe bis zum Boden neigend, empfohlen und in den großen Saal des Palastes zurückgezogen, um von dem Oberhofzeremonienmeister ein paar letzte Vorschriften entgegenzunehmen, da es einige unter ihnen gab, die noch ganz natürliche Manieren hatten, und das ist, ich brauche es kaum zu erwähnen, bei einem Höfling ein sehr schweres Vergehen.
Der Knabe - denn er war noch ein Knabe mit seinen nur sechzehn Jahren - war nicht traurig über ihren Abgang und hatte sich mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung auf die weichen Kissen seines bestickten Ruhelagers zurückgeworfen, wo er nun scheuen Blicks und offenen Mundes lag wie ein brauner Waldfaun oder ein junges, soeben von den Jägern gefangenes Tier des Waldes.
Und tatsächlich waren es die Jäger, die ihn gefunden hatten, die fast durch Zufall auf ihn gestoßen waren, als er, barbeinig und die Hirtenpfeife in der Hand, der Herde des armen Ziegenhirten
folgte, der ihn aufgezogen und für dessen Sohn er sich stets gehalten hatte. Das Kind der einzigen Tochter des alten Königs aus heimlicher Ehe mit einem, der an Rang tief unter ihr stand - einem
Fremden, sagten manche, der die junge Prinzessin durch den wunderbaren Zauber seines Flötenspiels dahin gebracht hatte, ihn zu lieben, während andere von einem Künstler aus Rimini sprachen, dem
die Prinzessin viel, möglicherweise allzu viel Ehre erwiesen hatte und der plötzlich, ohne seine Arbeit in der Kathedrale vollendet zu haben, aus der Stadt verschwunden war -, hatte man ihn, erst
eine Woche alt, heimlich von der Seite seiner schlafenden Mutter geraubt und einem gemeinen Bauern und seiner Frau in Obhut gegeben, die keine eigenen Kinder besaßen und in einem entlegenen Teil
des Waldes, mehr als einen Tagesritt von der Stadt entfernt, lebten.
Kummer oder die Pest, wie der Hofarzt erklärte, oder, wie manche flüsterten, ein schnell wirkendes italienisches Gift, in einem Becher Würzwein gereicht, tötete eine Stunde nach dem Erwachen das bleiche Mädchen, das ihn gebar, und als sich der verlässliche Bote, der das Kind über dem Sattelbogen trug, von seinem müden Pferd niederbeugte und bei der Hütte des Ziegenhirten an die rohe Tür klopfte, wurde der Leichnam der Prinzessin in ein offenes Grab gesenkt, das man auf einem verlassenen Friedhof jenseits der Stadttore geschaufelt hatte, ein Grab, in dem, wie es hieß, noch ein Leichnam lag, der eines jungen Mannes von wundersamer und fremdländischer Schönheit, dessen Hände mit einem geflochtenen Strick auf dem Rücken gebunden waren und dessen Brust durchbohrt war von vielen roten Wunden.
So lautete zumindest die Geschichte, die sich die Leute zurannten. Gewiss war, dass der alte König, ob von Reue bewegt über seine große Sünde oder nur, weil er seinem Geschlecht das Königreich zu erhalten wünschte, auf seinem Totenbett nach dem Knaben geschickt und ihn im Beisein des Kronrats als seinen Erben anerkannt hatte.
Und es scheint, als habe er vom ersten Augenblick seiner Anerkennung an Zeichen jener sonderbaren Leidenschaft für Schönheit offenbart, die bestimmt war, einen so großen Einfluss auf sein Leben
auszuüben. Die ihn zu der Zimmerflucht geleiteten, die seinem persönlichen Gebrauch vorbehalten war, sprachen oft von dem Freudenschrei, der von seinen Lippen brach, als er die erlesenen Gewänder
und die kostbaren Juwelen erblickte, die für ihn bereitlegen, und von dem fast wilden Entzücken, mit dem er sein derbes, ledernes Unterkleid und seinen plumpen Schaffellmantel beiseite warf
mitunter freilich vermisste er die schöne Freiheit seines Lebens im Walde, und stets war er geneigt, sich über die langweiligen Hofzeremonien zu ereifern, die soviel von jedem Tag in Anspruch
nahmen; aber der wundervolle Palast - >JoyeusePest Du sollst für soundso viel kaufen? Du sollst zu diesem Preis verkaufen?< Doch wohl nicht. Deshalb geh zurück in deinen Palast und lege
deinen Purpur und dein feines Leinen an.
Was hast du mit uns und mit dem, was wir leiden, zu schaffen?«
»Sind nicht der Reiche und der Arme Brüder?« fragte der junge König.
»Ja«, antwortete der Mann, »und der Name des reichen Bruders ist Kain.«
Und die Augen des jungen Königs füllten sich mit Tränen, und er ritt weiter durch das Murren des Volkes, und der kleine Page bekam Angst und verließ ihn.
Und als er bei dem großen Portal der Kathedrale anlangte, streckten die Soldaten ihre Hellebarden vor und sagten: »Was suchst du hier? Niemand tritt durch diese Tür als der König.« Und sein
Gesicht flammte vor Zorn, und er sprach zu ihnen: »Ich bin der König«, und schob ihre Hellebarden beiseite und ging hinein.
Und als ihn der alte Bischof in seinem Hirtenkleid kommen sah, erhob er sich verwundert von seinem Sitz und ging ihm entgegen und sprach zu ihm: »Mein Sohn, ist dies eines Königs Kleidung? Und
mit Welcher Krone soll ich dich krönen, und welches Zepter soll ich in deine Hand legen? Wahrlich, dies sollte ein Tag der Freude für dich sein und nicht ein Tag der Erniedrigung.«
»Soll die Freude tragen, was der Kummer schuf?« entgegnete der junge König. Und er erzählte ihm seine drei Träume.
Und als der Bischof sie vernommen hatte, runzelte er die Stirn und sagte: »Mein Sohn, ich bin ein alter Mann und stehe im Winter meiner Tage, und ich weiß, dass viel üble Dinge in der weiten Welt
getan werden. Die wilden Räuber kommen von den Bergen herab und entführen die kleinen Kinder und verkaufen sie an die Mauren. Die Löwen lauern den Karawanen auf und springen auf die Kamele. Das
Wildschwein zerwühlt das Korn im Tal, und die Füchse zernagen die Weinstöcke auf dem Hügel. Die Seeräuber verheeren die Küste und verbrennen die Boote der Fischer und nehmen ihnen ihre Netze. In
den Salzsümpfen leben die Aussätzigen; ihre Häuser sind aus geflochtenem Schilfrohr, und niemand darf ihnen nahen. Die Bettler wandern durch die Städte und essen ihre Speise mit den Hunden.
Kannst du bewirken, dass diese Dinge nicht geschehen? Willst du den Aussätzigen zu deinem Bettgenoss machen und den Bettler an deinen Tisch setzen? Soll der Löwe tun nach deinem Geheiß und das
Wildschwein dir gehorchen? Ist nicht Er, der das Elend schuf, weiser als du? Deshalb lobe ich dich nicht für das, was du getan hast, sondern fordere dich auf, in den Palast zurückzukehren und
dein Gesicht zu erheitern und die Kleidung anzulegen, die einem König geziemt, und mit der Krone aus Gold werde ich dich krönen, und das Zepter aus Perlen werde ich in deine Hand legen. Und was
deine Träume betrifft, so denke nicht mehr an sie. Die Bürde dieser Welt ist zu groß, als dass ein Mensch sie trage, und das Leid der Welt zu schwer, als dass ein Herz es erdulde.«
»Sprichst du so in diesem Hause?« sagte der junge König, und er schritt an dem Bischof vorbei und stieg die Altarstufen hinauf und stand vor dem Bilde Christi.
Er stand vor dem Bilde Christi, und zu seiner Rechten und zu seiner Linken standen die wundervollen Gefäße aus Gold, der Abendsmahlskelch mit dem gelben Wein und die Phiole mit dem heiligen Öl.
Er kniete vor dem Bilde Christi nieder, und hell brannten die großen Kerzen neben dem juwelenbesetzten Schrein, und der Qualm des Weihrauchs kräuselte in dünnen, blauen Girlanden durch die
Kuppel. Er beugte sein Haupt im Gebet, und die Priester in ihren steifen Chormänteln schlichen vom Altar fort.
Und plötzlich kam von der Straße draußen ein wilder Tumult, und herein traten die Edlen mit gezückten Degen und nickenden Federbüschen und Schilden aus blankem Stahl. »Wo ist dieser
Träumeträumer?« riefen sie. »Wo ist dieser König, der wie ein Bettler gekleidet ist - dieser Knabe, der Schande über unsern Staat bringt? Wahrlich, wir wollen ihn töten, denn er ist nicht wert,
über uns zu herrschend. «
Und abermals beugte der junge König sein Haupt und betete, und als er sein Gebet beendet hatte, stand er auf und wandte sich um und blickte sie traurig an. Und siehe! Durch die gemalten Fenster
kam das Sonnenlicht auf ihn herabgeströmt, und die Sonnenstrahlen woben ein Gewand aus zartem Gewebe um ihn, das schöner war als das zu seiner Freude geschaffene Gewand. Der verdorrte Stab blühte
und trug Lilien, die weißer waren als Perlen. Der dürre Dorn blühte und trug Rosen, die röter waren als Rubine. Weißer als reine Perlen waren die Lilien, und ihre Stiele waren von blankem Silber.
Röter als edle Rubine waren die Rosen, und ihre Blätter waren von gehämmertem Gold.
Er stand da in der Kleidung eines Königs, und die Türen des juwelenbesetzten Schreins flogen auf, und von dem Kristall der vielstrahligen Monstranz ging ein wunderbares, geheimnisvolles Licht
aus. Er stand da in eines Königs Kleidung, und die Glorie Gottes erfüllte den Raum, und die Heiligen in ihren geschnitzten Nischen schienen sich zu bewegen. In der makellos schönen Kleidung eines
Königs stand er vor ihnen, und die Orgel ließ ihre Musik erbrausen, und die Trompeter bliesen auf ihren Trompeten, und die Sängerknaben sangen.
Und das Volk fiel in Ehrfurcht auf die Knie, und die Edlen stießen den Degen in die Scheide und huldigten ihm, und des Bischofs Gesicht wurde bleich, und seine Hände zitterten. »Ein größerer als
ich hat dich gekrönt, rief er aus, und er kniete vor ihm nieder. «
Und der junge König kam vom Hochaltar herab und ging mitten durch das Volk heim. Aber niemand wagte zu seinem Gesicht aufzublicken, denn es glich dem Antlitz eines Engels.
Quelle: (Oscar Wilde)
Ewenn Congar

Es war einmal ein armer Mann, der hatte seine Frau verloren und lebte mit seinem einzigen Sohn. Der Mann hieß Ewenn Congar, und alles was er besaß waren drei Äcker, zwei Kühe und ein Pferd. Sein Sohn, der auch Eween genannt wurde, war ein gewecktes Bürschchen, und als er im zehnten Lebensjahr war, sagte er eines Tages zu dem alten Ewenn Congar: „Vater, ich muß wohl in der Schule etwas lernen.“ – „Mein Kind, wie soll ich das denn machen, du weißt ja, daß ich arm bin.“ – „Verkauf doch eine Kuh.“ Da ging der Vater auf den nächsten Viehmarkt und verkaufte eine seiner Kühe, und von dem Gelde, das er bekam, bezahlte er den Lehrer für seinen Jungen. Der kleine Ewenn wurde bald der Liebling und der Stolz seiner Lehrer; denn er zeigte sich anstellig und sehr fleißig. Nach einem Jahr war das Geld aufgebraucht, und der gute Vater mußte seine zweite Kuh verkaufen und wieder ein Jahr später auch das Pferd, damit sein Sohn noch auf der Schule bleiben konnte. Nach drei Jahren hatte der Jüngling so gut und so viel gelernt, daß er für seine Jahre wahrhaft ein Gelehrter genannt werden konnte. Er ließ sich ein Gewand schneidern, das war von außen weiß, von innen schwarz; dann zog er aus, sein Glück zu machen.
Unterwegs traf er einen vornehmen Herrn, der ihn anhielt und fragte: „Wohin des Wegs, junger Freund?“ – „Ein Unterkommen und ein Auskommen suchen, gnädiger Herr.“ – „Verstehst du zu lesen?“ – „Ja, ich kann lesen und schreiben.“ – Dann paßt du nicht in mein Geschäft.“ Damit ritt der Herr seine Wege und ließ Ewenn stehen. Der aber, nicht faul, drehte sein Gewand um, lief querfeldein und erreichte die Straße wieder noch vor dem Fremden. „Wohin des Wegs, junger Freund?“ fragte ihn dieser, ohne ihn zu erkennen. „Eine Anstellung suchen, gnädiger Herr.“ – Verstehst du zu lesen?“ – „Leider nein, ich kann nicht lesen und nicht schreiben, mein Vater war zu arm, um mich auf die Schule schicken zu können.“ – „Gut, gut, dann taugst du für mein Geschäft. Setz dich hinter mir aufs Pferd.“ Ewenn Congar stieg auf, setzte sich hinter den Sattel zu dem Herrn aufs Pferd, und bald erreichten sie ein schönes Schloß, das von hohen Mauern umgeben war. Niemanden kam ihnen im Hof entgegen, um sie zu empfangen.
Sie stiegen ab, und der fremde Herr führte sein Roß selber in den Stall. Dann wandte er sich an Ewenn Congar und sagte zu dem Jüngling: „Du wirst hier weder Mann noch Frau begegnen, niemanden außer mir. Aber sei unbesorgt, es wird dir an nichts fehlen, und wenn du genau befolgst, was ich dir sage, so erhälst du im Jahr fünfhundert Taler Lohn.“ – Und was muß ich tun, gnädiger Herr?“ – Ich habe in meinem Schloß fünfzig Käfige und in jedem einen Vogel, außerdem habe ich in meinem Stall zehn Pferde; die Vögel und die Pferde hast du zu versorgen, und zwar so, daß ich damit zufrieden bin.“ – „Ich werde mein Bestes tun.“ Darauf zeigte ihm der Herr des Schlosses die Käfige und die Pferde und sprach zu Eween: „Nun gehe ich auf Reisen und komme erst über ein Jahr und einen Tag zurück.“ Dann ritt er davon. Eween Congar war nun ganz allein in dem Schlosse und pflegte Vögel wie Pferde aufs beste. Viermal am Tage fand er im Speisesaal den Tisch für sich gedeckt, ohne daß er jemals einer Menschenseele begegnet wäre. Er aß und trank und ließ es sich nach Herzenslust schmecken, und wenn er mit seiner Arbeit fertig war, strich er durch das Schloß und durch die Gärten.
Als er nun eines Tages wieder einmal so durch alle Zimmer ging, von denen eines immer reicher an Schätzen und Kostbarkeiten war als das andere, stand plötzlich eine wunderschöne Prinzessin vor ihm. Die sprach: „Erkennst du mich? Ich bin eines der Pferde, die du in dem Stall täglich fütterst und tränkst, und
zwar das dritte von links, wenn du in den Stall trittst, die
Apfelschimmelstute. Der Zauberer des Schlosses hat mich so verwandelt, und ich muß diese Gestalt behalten, bis einer kommt, der mich erlöst. Vier haben es schon versucht, aber sie sind in Vögel
oder Pferde verwandelt worden. Wenn nun der Zauberer nach seiner Rückkehr mit deinen Diensten zufrieden ist, so wird er dir gestatten, dir zur Belohnung eines der Pferde auszuwählen, damit du zu
deinem Vater zurückkehren kannst. Wählst du mich, so wirst du es nicht bereuen. Ich bin die Tochter des Königs von Spanien. Aber behalte es gut im Kopf: die Apfelschimmelstute, das dritte Pferd
von links, wenn du in den Stall trittst. Viele Königssöhne und andere tapfere und edle Männer haben das Wagnis schon unternommen, mich zu befreien, aber viele haben dabei ihr Leben eingebüßt, und
in einem Saal des Schlosses findest du ihre Haut an Nägeln aufgehängt. Darum gib acht, daß nicht auch du deine Haut lassen mußt.“
Darauf zeigte die Prinzessin Ewenn Congar, wo der der Magier seine Zauberbücher verborgen hielt, nämlich in einem winzigen Kabinett, das ganz und gar mit schwarzem Tuch ausgeschlagen war. Da lagen viele große, mit schönen Schlössern und Beschläge verzierte Bücher, und mitten unter ihnen ein kleines, unscheinbares rotes Buch. Die Prinzessin trug Ewenn Congar auf, das wichtigste Buch auszuwählen, und er griff ohne Zaudern nach dem kleinen roten. „Das ist gut“, rief die Prinzessin, „du bist der Richtige, nun gib acht, ich will dich in der schwarzen Kunst unterweisen, damit du den Zauberer bestehen kannst.“
Nach einem Jahr und einem Tag erschien der Herr des Schlosses wieder, wie er angezeigt hatte. Er war sehr zufrieden mit Congars Diensten und sagte ihm, er solle noch ein weiteres Jahr bei ihm bleiben, er wolle ihm auch den doppelten Lohn zahlen. „Nein, danke, Herr“, antwortete Ewenn Congar, „ich will zu meinem Vater zurückkehren.“ – „Aber bedenke doch, daß du jetzt mehr als zwölftausend Meilen von deiner Heimat entfernt bist.“ – „Mir gleich, Herr, ich muß zu meinem Vater zurück.“ – „Gut, wie du willst. Hier hast du deine fünfhundert Taler Lohn, und ich werde dir noch ein Pferd geben, damit du nach Hause zurückkehren kannst. Komm in den Stall und such dir eins aus.“ Sie gingen in den Stall, und Ewenn tat, als ob er nicht wüßte, welches er sich auswählen sollte; dann zeigte er auf die Apfelschimmelstute und sagte: „Die hier will ich, die kleine Stute da.“ – „Was, diese Mähre? Du verstehst wirklich nichts von Pferden. Schau doch hin, daneben, das sind schöne Rosse.“ – „Nein, gerade diese Apfelschimmelstute hat mir’s angetan, die will ich, und keine andere.“ – „Der Teufel soll dich holen! Nimm sie also, aber merke dir, ich krieg dich doch noch!“
Congar führte die Apfelschimmelstute aus dem Stall hinaus auf dem Hof. Kaum waren sie außerhalb des Schlosses, so verwandelte sich die Stute und wurde wieder eine wunderschöne Prinzessin. „Nun
kehre nach Hause zurück“, sprach die Prinzessin zu ihrem Befreier, „ich will ebenfalls zu meinem Vater gehen, dem König von Spanien, dort wirst du mich finden, übers Jahr und über ein Tag.“ Und
im nächsten Augenblick war sie verschwunden.
Also machte sich Congar mutig auf den Weg zu seiner Heimat. Als er nur noch wenige Meilen bis zum Hause seines Vaters hatte, begegnete ihm ein Bettler, den er früher oft gesehen hatte; dieser aber erkannte ihn nicht. Den fragte er: „Guter Mann, ist Euch nicht vielleicht ein Ewenn Congar bekannt?“ – „Oh, den kenne ich gut, ich wohne ja nicht weit von ihm“, antwortete der alte Bettelmann. – „So lebt er noch? Und wie geht es ihm?“ – „Er lebt schon noch, aber es geht ihm sehr schlecht, und er ist nicht viel glücklicher dran als ich. Denn das Wenige, das er besaß, hat er vergeudet, um seinen Sohn auf die Schule schicken zu können; dieser aber kümmert sich nicht um ihn, und niemand weiß, was aus ihm geworden ist.“ Congar erwiderte nichts, gab dem Bettler ein großes Geldstück und eilte nach Hause. Als er zu der morschen Hütte kam, fand er seinen alten Vater auf einem runden Feldstein vor der Türschwelle hocken.
Er umarmte ihn und rief: „Guten Tag, lieber Vater, da bin ich wieder!“ Doch sein Vater erkannte ihn nicht und sagte: „Schämt Euch, daß ihr Euch über einen alten Mann lustig macht!“ – „Nicht doch,
Vater! Jetzt bin ich reich, nun sollst du dich erholen, wir wollen uns gemeinsam ein schönes Leben machen. Da, schau her!“ Und damit warf er die fünfhundert neue Goldstücke auf den Tisch. Dann
ließ er den Vater im Ort einkaufen, Weißbrot, Fleisch, Speck, Würstchen und sogar Wein, und sie veranstalteten ein wahres Festessen und luden auch ihre Nachbarn dazu ein. Alle Tage ging es so
herrlich zu, solange die fünfhundert Goldstücke reichen wollten. Aber als der alte Ewenn Congar den letzten Dukaten wechseln mußte, sprach er zu seinem Sohn: „Nun sind wir am Ende mit unserm
Geld, mein Söhnchen, jetzt wird wieder Schmalhans Küchenmeister bei uns werden.“ „Macht Euch deshalb keine Sorge, Vater, denn habt Ihr Euch um alles gebracht, damit Ihr mich zur Schule schicken
konntet, so hab’ ich einiges unterwegs gelernt, wie Ihr bald erleben werdet, und ich werde es Euch weder an Geld noch an sonst irgend etwas mangeln lassen. Morgen früh, Vater, geht auf den
Viehmarkt, um dort einen feisten Ochsen zu verkaufen.“ – „Und woher soll ich den Ochsen nehmen, Söhnchen? Es ist lange her, daß ich einmal einen Ochsen, eine Kuh und ein Kalb mein Eigen nannte.“
– „S’ist gleich, woher der Ochse kommt, doch morgen früh, wenn Ihr aufsteht, werdet Ihr vor Eurer Kammer einen stattlichen Ochsen finden: den führt nach Lannion zum Viehmarkt und verlangt
zweihundert Taler dafür. Ihr werdet sie auch erhalten, ohne einen Heller nachzulassen. Doch behaltet den Strick zurück!“ – „Der Strick wird mitverkauft, so ist es üblich“, sagte der Alte.“ – „Ich
sagte Euch, gebt den Strick unter keinen Bedingungen her, oder Ihr bringt mich in große Gefahr. Ihr versteht mich doch, bringt den Strick unter allen Umständen wieder nach Hause, ansonsten
verliert Ihr etwas, was Euch so teuer ist wie Euer eigenes Leben.“ – „Also gut, ich werde den Strick nicht hergeben, obwohl das nicht üblich ist.“
Am nächsten Morgen fand der Alte in der Tat vor seiner Tür einen prächtigen Ochsen, der hatte einen ganz neuen Strick um den Hals.
Der alte Ewenn Congar führte den Ochsen zum Viehmarkt, ohne sich wegen seines Sohnes irgendwelche Gedanken zu machen. Kaum war er mit dem Ochsen auf dem Markt angelangt, drängten sich alle Händler und Metzger heran, um ihm den Ochsen abzuhandeln. „Was kostet der Ochse, guter Mann?“ – „Zweihundert Taler und der Strick bleibt mir!“ – Ihr seid nicht ganz bei Trost. Sagt hundertfünfzig und schlagt ein, dann trinken wir noch zusammen eine Flasche darauf.“ – „Zweihundert Taler, und nicht einen Heller weniger.“ – „Na schön, Ihr werdet sehen, Ihr bleibt sitzen mit Eurem Ochsen.“ Schließlich hatten alle Metzger und alle Händler den Ochsen betrachtet, abgetastet und ihr Gebot gemacht. Wie jedoch der Alte immerzu auf zweihundert Taler bestand, ohne etwas nachzulassen, hatten sie sich verlaufen. Als der Markt zu Ende und die Sonne schon zur Ruhe ging, erschien noch ein fremder Händler, mit flammenden Haaren und stechenden, unruhigen Augen; der näherte sich dem alten Ewenn Congar, betrachtete den Ochsen und fragte: „Na, Biedermann, wieviel soll der Ochse kosten?“ – „Zweihundert Taler, und der Strick bleibt mir.“ – „Das ist ziemlich teuer, aber das Tier gefällt mir, ich kann es gut gebrauchen, hier sind die zweihundert Taler. So, und nun gebt mir den Strick, damit ich den Ochsen wegführen kann.“ – „Ohne den Strick! Ich habe Euch gesagt, der Strick bleibt bei mir.“ „Was soll das heißen? Der Strick gehört immer dem Käufer, alter Narr!“ – „Den Strick gebe ich Euch nicht, ich sag’ noch einmal, und wenn Euch das nicht paßt, ist der Handel hinfällig, Ihr behaltet Euer Geld, und ich meinen Ochsen.“ – „so häng dich auf mit deinem Strick!“ Und damit ging der Fremde fort. Der Ochse wurde endlich verkauft an einen Metzger, der ihn mitnahm und in seinen Stall stellte, um ihn am nächsten Tag zu schlachten. Aber am anderen Morgen war der Ochse aus dem Stall verschwunden, und Ewenn Congar war wieder bei seinem Vater.
Solange die zweihundert Taler reichten, führten Vater und Sohn ein lustiges Leben wie zuvor, und ihre Freunde hatten auch ihren Teil daran. Als es aber wieder an den letzten Sechser ging, sagte der junge Mann zu seinem Vater: „Morgen früh, Vater, mußt du auf den Viehmarkt und dort ein Pferd verkaufen.“ – „Und woher sollen wir das Pferd nehmen, mein Sohn?“ – Es wird dorther kommen, woher auch der Ochs gekommen ist. Das laß nur meine Sorge sein. Morgen früh werdet ihr es an Eurer Tür finden. Dreihundert Taler müßt Ihr dafür verlangen und keinen Heller heruntergehen! Ihr werdet sie auch kriegen. Aber erinnert Euch, wie bei dem Ochsen verkauft unter keiner Bedingung das Halfter mit. Bringt es ja wieder nach Hause, oder es kommt Euch teuer zu stehen, und mich auch.“ – „Schon gut“, antwortet der brave Alte, „ich werde das Halfter wieder mit nach Hause bringen, da du es so willst, obwohl das hierzulande, sonst nicht üblich ist.“ Am nächsten Morgen ritt der alte Congar also auf den Pferdemarkt mit einem wunderschönen Pferd, auf das er furchtbar stolz war, und er wunderte sich nicht einmal darüber, was aus seinem Sohn geworden sein konnte. Auf dem Markt kamen zahllose Händler herbei und handelten um das Roß, da ihnen das Tier über die Maßen gefiel. Aber da der Alte von seinen dreihundert Talern auch nicht einen Heller abging, ließen sie ihn samt seines Pferdes stehen.
Gegen Abend erschien wieder der unbekannte Händler, der schon um den Ochsen gefeilscht hatte, und gleich den anderen fragte er: „Wie viel soll das Pferd kosten, Biedermann?“ – „Dreihundert
Taler, und das Halfter bleibt mir.“ – „Das ist teuer, aber das Pferd gefällt mir, und ich werde dir dreihundert Taler geben, ohne einen Heller abzuhandeln. Jedoch mußt du mir das Halfter lassen,
das ist nicht mehr als üblich.“ – „Mitnichten, das Halfter bleibt mir, oder der Handel gilt nichts.“ – „Alter Dummkopf, weißt du denn nicht, daß das Halfter immer und stets dem Käufer gehört?“ –
„Das kann jeder halten, wie er mag. Ich will aber mein Pferd verkaufen und das Halfter behalten.“ – „Daß dich der Teufel hole, dich samt deinem Roß und dem Halfter.“ – Und voller Wut und Zorn
verschwand er. Das Pferd wurde ein wenig später an einen Roßhändler verkauft, der es mit nach Hause nahm, wo er es mit mehreren Pferden zusammen für die Nacht in den Stall tat, um am nächsten Tag
weiterzureisen. Doch am anderen Morgen war das Pferd verschwunden, ohne daß der Händler gewusst hätte, wie es zugegangen war. Und Ewenn Congar war wieder zu Hause bei seinem Vater.
Als die dreihundert Taler von neuem ausgegeben waren, ließ sich Ewenn zum dritten Mal, diesmal als Esel, von seinem Vater auf den Markt führen; zweihundert Taler soll der Vater für den Esel fordern und gut darauf achten, daß er das Halfter wieder mit nach Hause bringe. Und wiederum stellte sich der rothaarige Händler ein. „Wieviel der Esel, alter Freund?“ – „Zweihundert Taler!“ – „Viel Geld, viel Geld für das abgetriebene Langohr, aber ich liebe es nicht, zu feilschen – da sind zweihundert Taler, her mit dem Esel!“ und schnell sprang er auf das Tier. „Hallo“, rief der alte Congar, das Halfter müßt ihr mir lassen!“ – „Zu spät, Graukopf“, erwiderte spöttisch der andere, schlug mit dem Stock auf den Esel und jagte im Galopp davon. Nach einiger Zeit kam er vor eine Schmiede am Wege, dort hielt er an und sagte zu dem Schmied: „ Rasch, rasch Meister, macht mir vier Hufeisen, aber jedes zweihundert Pfund schwer und beschlagt meinen Esel damit!“ – „Wollt Ihr mich zum Narren halten?“ gab der Schmied zurück.“ – Keineswegs, tut, wie ich Euch sage, und ich werde es Euch gut bezahlen.“ Während der Schmied daranging, die vier Hufeisen zu machen, wurde der Esel an einem Ring draußen vor der Schmiede angebunden. Die Kinder standen um ihn herum und zogen ihn an den Ohren, damit er schrie. „Bindet mich los“, sprach der Esel. „Ein Esel, der reden kann!“ rief einer der Buben. – „Was hat er gesagt?“ fragte ein anderer. „Wir sollen ihn losbinden.“ – „Ja, Kinder, bindet mich los, und ihr werdet etwas Lustiges zu sehen bekommen“, wiederholte der Esel. Da lösten die Kinder den Knoten. Sofort verwandelte sich der Esel in einen Hasen und stob über die Felder davon, daß der Staub aufwirbelte.
Als der Zauberer das Geschrei der Kinder vernahm, eilte er aus der Schmiede und fragte: „Wo ist mein Esel?“ – „Er hat sich als Hase aus dem Staub gemacht“, schrien die Buben. – „Wohin ist er
gelaufen?“ – „Dorthin über das Feld!“ – Und schon jagte der Zauberer als Jagdhund fort und setzte dem Hasen nach. Wie er diesem dicht auf den Fersen war, verwandelte sich der Hase unversehens in
eine Taube und flog davon, der Zauberer nun als Sperber hintendrein. So schossen sie durch die Luft, der Sperber immer dicht hinter der Taube, bis sie an das Schloß des Königs von Spanien kamen.
Es fehlte nicht mehr viel, und der Sperber packte die Taube, da erschien die Königstochter an einem Fenster des Schlosses, und flugs wurde die Taube zu einem Ring und glitt der Prinzessin an den
Finger. Da nahm der Zauberer menschliche Gestalt an, ging zum Schloß und meldete sich als Arzt, den schon lang schwererkrankten König heilen wolle. Weil nun die Ärzte des ganzen Landes ihre
Künste an dem alten König bisher vergeblich ausprobiert hatten, ließ ihn der Kranke kommen, und nach kurzer Zeit hatte er ihn geheilt. Darüber war der König sehr glücklich, daß er ihm alles
versprach; was er auch verlange, er werde es ihm geben. Der falsche Arzt sprach: „Ich erbitte mir nicht viel, o König, nichts anders und nicht mehr als den goldenen Ring, den die Prinzessin, Eure
Tochter, am Finger trägt.“ – „Wie, Ihr wollt Euch mit so wenig zufrieden geben? Und wenn Ihr Gold von mir verlangt, soviel wie meine Krone, mein Zepter und mein Thron zusammen wiegen, ich werde
es Euch geben.“
„Nein, König, ich bitte nur um den goldenen Ring von der Hand Eurer Tochter.“ – „Gut denn, wie Ihr wollt. Morgen früh sollt Ihr ihn bekommen.“
Als sich die Prinzessin am Abend zum Schlafen niederlegte, mit dem Ring an ihrem Finger, erschrak sie sehr, denn auf einmal lag neben ihr ein Mann, der sprach geschwind zu ihr: „Prinzessin, erkennt Ihr mich nicht? Es ist gerade ein Jahr her, da habe ich Euch aus der Gewalt des Zauberers befreit. Seit ich Euch erlöst habe, verfolgt mich die Rache des Zauberers ohne Unterlaß. Jetzt ist es ihm, als Arzt verkleidet, gelungen, Euren Vater von seiner Krankheit zu heilen. Zum Preis dafür verlangt er den Ring, den Ihr am Finger habt. Nun bitte ich Euch, zu tun, was ich Euch sage. Antwortet dem Zauberer, Ihr wollt ihm den Ring geben und Ihr wolltet ihm sogar selber ihm an den Finger stecken. Dabei lasst den Ring zu Boden fallen. Ist es so weit, macht Euch wegen des Ausgangs keine Sorge mehr; alles wird gut gehen, wenn Ihr genau tut, was ich Euch gesagt habe.“
Am nächsten Morgen ließ der König seine Tochter zu sich rufen; der Zauberer, als Arzt verkleidet, war bei ihm, und der König sagte zu der Prinzessin: „siehe, meine Tochter, das ist der Mann, der
mir Gesundheit und Leben geschenkt hat, indessen alle Ärzte des ganzen Reiches meinem Leiden machtlos zusahen.
Zur Belohnung für diesen unschätzbaren Dienst fordert er nichts weiter als den goldenen Ring, den du am Finger trägst. Das wirst du ihm nicht abschlagen.“ – „Wahrhaftig nicht, mein Vater“,
antwortete die Prinzessin, „und ich bitte sogar darum, ihm den Ring selber und jetzt sogleich auf den Finger stecken zu dürfen.“ Damit zog sie den Ring von ihrem Finger, doch in dem Augenblick,
da sie ihn dem Zauberer anstecken wollte, tat sie, als ob sie zu bewegt oder ungeschickt wäre, und ließ ihn zu Boden fallen. Sofort wurden aus dem ring viele Kichererbsen, die auf dem Boden
herumkollerten, doch schnell verwandelte sich der Zauberer, um die Erbsen aufzupicken, in einen Hahn. Da wurden die Erbsen zu einem Fuchs, der stürzte sich auf den Hahn und biß ihn tot. So endete
der Wettkampf, und Ewenn Congar hatte den bösen Zauberer endlich besiegt. Nun nahm die Prinzessin Ewenn bei der Hand und berichtete ihrem Vater, wie Ewenn sie befreit hatte. Und er erzählte, was
sich inzwischen zugetragen und wie der Zauberer ihn mit seiner Rache verfolgt habe. Darauf bekam Ewenn die Prinzessin zur Frau, es wurde eine prächtige Hochzeit gefeiert, und der alte Ewenn
Congar war auch dabei, denn er lebte immer noch.
Märchen aus Schottland
Der Ernteschmaus in der Eierschaale

Ein alter Mann, Namens David Tomos Bowen erzählte folgende Geschichte. –
Meine Mutter, sagte er, wohnte in der Nachbarschaft eines Farmhauses, welches, wie allgemein geglaubt wurde, von den Feen heimgesucht war. Es war eines jener altmodigen Häuser unter den Bergen, welches nach der Sitte der Zeiten gebaut war, wo die Farmer auf die Sicherheit und das Wohlbefinden ihres Viehs noch ebensoviel bedacht waren, als auf das ihrer Kinder und ihres Gesindes. Küche und Kuhstall waren auf derselben Flur; wo beide aneinander stießen, waren sie nur durch einen niedrigen Verschlag getrennt, über welchen hin der gute Farmer seine Thiere sehen konnte, ohne daß er einmal hätte aufzustehn brauchen.
Nun waren meine Mutter und des Farmers Frau gute Freundinnen, und die letztere beklagte sich öfters bei ihr, daß die Feen sie und ihre Familie so plagten, daß sie gar keinen Frieden mehr hätten,
und daß diese kleinen Ruhestörer immer, wenn die Familie zu Mittag oder zu Abend oder zu irgend einer andern Zeit äße, oder auch nur still beisammen säße, sich im nächsten Zimmer tummelten und
sie und ihre Leute fortwährend ärgerten. Wenn sie zum Beispiel in der Küche säßen, so schlügen die Feen in der Milchkammer ihre Purzelbäume, daß sie immer vor den Milchsetten Angst hätten, und
wenn sie die Kühe anspannten, so wären die Feen in der Küche, sängen, lachten und sprängen über Tisch und Bänke, Topf und Tiegel.
Eines Tages, als ihre Leute und die Schnitter vom Feld gekommen waren, um den Ernteschmaus, welchen die Hausfrau mit großer Sorgfalt und Schmackhaftigkeit bereitet hatte, verzehren zu helfen, und
alle sich schon um den Tisch gesetzt hatten: da hörten sie auf einmal Musik über sich und Lachen und Tanzen und pardauz! fiel eine dicke Staubwolke hernieder und verschüttete alle Speisen, die
auf dem Tische standen. Besonders war der Pudding ganz verdorben, und den Leuten, welche sich schon auf das leckre Essen gefreut hatten, war vor Schreck aller Hunger vergangen. In diesem
Augenblick der Verwirrung und des Aergers trat eine alte Frau herein, welche die Unordnung sah und die ganze Geschichte erzählen hörte.
»Laßt's Euch nicht verdrießen,« flüsterte sie der Frau des Farmers in's Ohr, »ich will Euch sagen, wie Ihr die Feen los werden könnt. Ladet auf morgen Mittag sechs von den Schnittern dort zum
Eßen – aber tut's recht laut, damit Euch die Feen auch hören! – Und dann macht nicht mehr Pudding, als in eine Eierschaale geht und laßt es hübsch kochen. Für die sechs ausgehungerten Mähder wird
es freilich ein knappes Gericht sein, aber es wird hinreichen, um die Feen zu vertreiben. Folgt meinem Winke, und Ihr werdet in der Zukunft nicht mehr belästigt werden!«
Die Farmersfrau tat, was ihr die Alte geraten hatte; und als die Feen nun hörten, daß ein Pudding für sechs Mähder in einer Eierschaale angerührt und gekocht werde, da entstand im anstoßenden
Zimmer gar ein gewaltiger Lärm und eine Stimme rief ärgerlich aus:
»Wir haben lange in der Welt gelebt; wir wurden geboren, sogleich nachdem die Erde geschaffen und noch ehe die Eichel gepflanzt war: aber einen Ernteschmaus in einer Eierschaale kochen haben wir
noch nicht gesehen. Nein – in diesem Hause muß nicht Alles richtig sein – kommt, wir wollen nicht länger unter diesem Dache bleiben!«
Von der Zeit an hatte es mit der Musik, dem Lärmen und Tanzen ein Ende, und die Feen wurden in diesem Hause nicht mehr gesehen noch gehört.
[Julius Rodenberg: Märchen aus Wales ]
Das Sternenkind
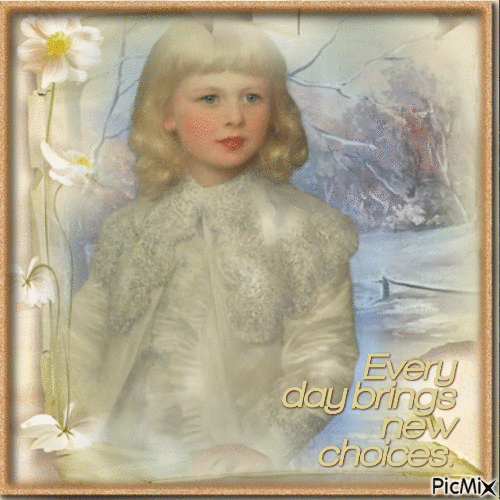
Es waren einmal zwei ärmliche Holzfäller, sie waren auf ihrem Weg nachause und gingen durch einen großen Kiefernwald. Es war eine bitterkalte Winternacht und der Schnee lag dick auf den Ästen der Bäume. Wo sie gingen, knickte der Frost links und rechts die kleinen Zweige, und als sie zur der Quelle eines Bachs kamen, sahen sie wie sie da reglos in der Luft hing, denn der Eiskönig hatte sie geküsst.
So kalt war es, dass selbst die Tiere und Vögel nicht wussten, was sie davon halten sollten.
»Huuu« knurrte der Wolf, als er mit eingezogenem Schwanz durch das Dickicht humpelte. »Das ist ja ein geradezu widernatürliches Wetter. Warum kümmert sich die Regierung nicht darum?« »Twiet,
twiet, twiet« zwitscherten die grünen Hänflinge. »Die alte Erde ist tot, und man hat sie in ihrem weißen Leilach aufgebahrt.«
»Die Erde will Hochzeit halten, und dies ist ihr Brautkleid«, raunten die Turteltauben einander zu. Ihre kleinen blassroten Füße waren ganz erfroren, aber sie hielten es für ihre Pflicht, die
Umstände in einem romantischen Licht zu betrachten.
»Unsinn« heulte der Wolf »Ich sage euch, an all dem ist nur die Regierung schuld, und wenn ihr mir nicht glaubt, fresse ich euch.« Der Wolf hatte einen von Grund auf praktischen Sinn und war nie
um ein gutes Argument verlegen.
»Nun, ich für mein Teil«, sagte der Specht, der ein geborener Philosoph war, »ich mache mir nichts aus analysierenden Betrachtungen. Wenn etwas soundso ist, dann ist es so, und gegenwärtig ist es
grässlich kalt.«
Grässlich kalt war es zweifellos. Die kleinen Eichhörnchen, die im Innern der großen Föhre wohnten, rieben ständig ihre Nasen aneinander, um sich warm zu halten, und die Kaninchen kringelten sich
in ihren Löchern zusammen und wagten nicht einmal, zum Einstieg hinauszuschauen. Die einzigen, die sich über die Kälte zu freuen schienen, waren die großen Uhus. Ihr Gefieder war ganz steif vom
Rauhreif, aber das machte ihnen nichts aus, und sie rollten ihre großen gelben Augen und riefen einander durch den Wald zu: »Tu-witt Tu-hu Tu-witt Tu-hu Welch herrliches Wetter haben wir«
Weiter und immer weiter gingen die beiden Holzfäller, wobei sie kräftig auf ihre Finger hauchten und mit ihren mächtigen, eisenbeschlagenen Stiefeln auf den zusammengebackenen Schnee stampften. Einmal versanken sie in einer tiefen Schneewehe und kamen so weiß heraus wie Müller, wenn die Steine mahlen, und einmal rutschten sie auf dem harten, glatten Eis des gefrorenen Sumpfwassers aus, und das Reisig fiel aus ihren Bündeln, und sie mussten es auflesen und wieder zusammenbinden, und einmal glaubten sie schon, sie hätten den Weg verloren, und eine Riesenangst packte sie, da sie wussten, dass der Schnee grausam ist gegen solche, die in seinen Armen einschlafen. Doch sie vertrauten auf den guten heiligen Martin, der über alle Wanderer wacht, und gingen in ihrer Spur zurück und bewegten sich umsichtig, und am Ende erreichten sie den Saum des Waldes und erblickten weit drunten in dem Tal zu ihren Füßen die Lichter des Dorfes, in dem sie wohnten. So überglücklich waren sie über ihre Errettung, dass sie lauthals lachten, und die Erde erschien ihnen wie eine Blume aus Silber und der Mond wie eine Blume aus Gold.
Doch nachdem sie gelacht hatten, wurden sie traurig, da sie ihrer Armut gedachten, und der eine von ihnen sagte zu dem anderen: »Warum war uns so vergnügt zumute, da doch das Leben für die
Reichen da ist und nicht für solche wie wir? Besser wir wären im Wald vor Kälte gestorben oder ein wildes Tier hätte uns angefallen und umgebracht.«
»Wahrhaftig«, antwortete sein Gefährte, »manchen ist viel gegeben und anderen wenig. Die Ungerechtigkeit hat die Welt aufgeteilt, und nichts als die Sorge ist uns in gleichem Maße beschieden.«
Doch während sie einander ihr Elend klagten, geschah etwas Seltsames. Vom Himmel fiel ein sehr heller und schöner Stern. Er glitt seitlich vom Himmel herab, vorbei an den anderen Sternen, und als sie ihn staunend beobachteten, schien es ihnen, als sinke er hinter einer Weidengruppe nieder, die, keinen Steinwurf entfernt, an einer kleinen Schafbürde stand.
»Ei Da liegt ein Topf voll Gold für den, der ihn findet«, riefen sie, und sie machten sich auf und rannten, so begierig waren sie nach dem Gold.
Und der eine lief schneller als sein Gefährte und war ihm voraus und bahnte sich seinen Weg durch die Weiden und kam auf der anderen Seite heraus, und siehe, da lag wirklich etwas Goldenes im
Schnee. Er eilte hin, bückte sich und legte die Hände darauf, und es war ein Mantel aus Goldgewebe, kunstvoll mit Sternen durchwirkt und in viele Falten gelegt. Und er rief seinem Gefährten zu,
er habe den Schatz gefunden, der vom Himmel gefallen, und als sein Gefährte herbeigekommen war, setzten sie sich in den Schnee und lockerten die Falten des Mantels, um die Goldstücke zu teilen.
Aber ach, kein Gold war darin, kein Silber noch überhaupt irgendein Schatz, sondern nur ein kleines, schlafendes Kind.
Und der eine von ihnen sagte zu dem anderen: »Das ist ein bitteres Ende unserer Hoffnung, uns ist kein Glück zuteil geworden, denn was nützt einem Menschen ein Kind? Wir wollen es hier lassen und
unseres Weges gehen, denn wir sind arm und haben eigene Kinder, deren Brot wir nicht einem anderen geben können.«
Doch sein Gefährte antwortete ihm: »Nein, es wäre übel getan, ließen wir das Kind hier, dass es im Schnee umkommt, und obgleich ich so arm bin wie du und viele Münder zu stopfen und nur wenig im
Topf habe, will ich es doch mit nach Hause nehmen, und mein Weib soll für das Kind sorgen.«
Ganz behutsam hob er also das Kind auf und hüllte es in den Mantel, um es vor der grimmigen Kälte zu schützen, und ging seines Weges den Hügel hinab zum Dorf, während sich sein Gefährte höchlich
verwundene über seine Torheit und Weichherzigkeit.
Und als sie zum Dorf kamen, sagte sein Gefährte zu ihm: »Du hast das Kind, also gib mir den Mantel, denn es ist recht und billig, dass wir teilen.«
Doch er antwortete ihm: »Nein, denn der Mantel ist weder mein noch dein, sondern gehört einzig und allein dem Kinde«, und er wünschte ihm einen guten Weg und ging zu seinem eigenen Hause und
klopfte an.
Und als seine Frau die Tür öffnete und sah, dass ihr Mann unversehrt zu ihr zurückgekommen war, legte sie die Arme um seinen Hals und küsste ihn und nahm das Reisigbündel vom Rücken und bürstete
den Schnee von seinen Stiefeln und hieß ihn eintreten.
Er aber sagte zu ihr: »Ich habe im Wald etwas gefunden und habe es dir mitgebracht, damit du es hütest«, und er rührte sich nicht von der Schwelle.
»Was ist es?« rief sie. »Zeig es mir, denn das Haus ist leer, und wir brauchen vieles.« Und er schlug den Mantel zurück und zeigte ihr das schlafende Kind.
»Meinje, lieber Mann« klagte sie. »Haben wir nicht eigene Kinder, dass du unbedingt noch einen Wechselbalg an unsern Herd bringen musst? Und wer weiß, ob er uns nicht Unglück bringt? Und wie sollen wir ihn warten?« Und sie war zornig auf ihn.
»Nein, es ist ein Sternenkind«, antwortete er, und er erzählte ihr, auf wie seltsame Weise er es gefunden hatte.
Doch sie wollte sich nicht besänftigen lassen, sondern verlachte ihn und zürnte und sprach: »Unsere Kinder darben, und da sollen wir das Kind eines anderen füttern? Wer sorgt denn für uns? Und
wer gibt uns Nahrung?«
»Nicht so, Gott sorgt selbst für die Sperlinge und speist sie«, antwortete er.
»Sterben nicht im Winter die Sperlinge vor Hunger?« fragte sie. »Und ist es jetzt nicht Winter?« Der Mann gab keine Antwort, rührte sich aber nicht von der Schwelle.
Und ein scharfer Wind vom Walde her fuhr durch die offene Tür und ließ sie zittern, und es schauderte sie, und sie sagte zu ihm: »Willst du nicht die Tür schließen? Ein scharfer Wind fährt ins
Haus, und ich friere.«
»Fährt nicht immer ein scharfer Wind in ein Haus, in dem ein hartes Herz wohnt?« fragte er. Und die Frau antwortete nicht, sondern kroch näher ans Feuer.
Und nach einer Weile drehte sie sich um und sah ihn an, und ihre Augen waren voll Tränen. Und er kam geschwind herein und legte ihr das Kind in die Arme, und sie küsste es und legte es in ein Bettchen, in dem das jüngste ihrer eigenen Kinder schlief Und am Morgen nahm der Holzfäller den wunderlichen goldenen Mantel und legte ihn in eine große Truhe, und seine Frau nahm eine Bernsteinkette, die das Kind um den Hals trug, und legte sie ebenfalls in die Truhe.
So wurde das Sternenkind mit den Kindern des Holzfällers aufgezogen und saß mit ihnen am selben Tisch und war ihr Spielgefährte. Und Jahr für Jahr ward es schöner anzusehen, so dass alle, die im
Dorf wohnten, sich verwundenen, denn sie waren dunkel und schwarzhaarig, der Knabe aber war weiß und fein wie aus Elfenbein geschnitten, und seine Locken glichen den Blütenkränzen der
Osterglocke. Auch seine Lippen waren wie Blütenblätter einer roten Blume, und seine Augen waren wie Veilchen an einem Strom klaren Wassers, und sein Leib glich der Narzisse auf einem Felde, wohin
der Schnitter nicht kommt.
Doch seine Schönheit verdarb ihn. Denn er wurde hoffärtig und grausam und eigensüchtig. Die Kinder des Holzfällers und die anderen Kinder im Dorf verachtete er und sagte von ihnen, sie seien niederer Herkunft, während er hochgeboren sei, da er von einem Stern abstamme, und er machte sich zum Herrn über sie und nannte sie seine Diener. Kein Mitleid hatte er mit den Armen oder mit solchen, die blind oder verkrüppelt oder auf andere Weise leidend waren, sondern warf Steine nach ihnen und jagte sie hinaus auf die Straße und hieß sie ihr Brot anderswo erbetteln, so dass niemand außer den Geächteten zweimal in das Dorf kam, Almosen zu erbitten. Wahrlich, er war wie einer, der in die Schönheit verliebt ist, und pflegte über die Schwachen und Missgestalten zu spotten, und im Sommer, wenn die Winde sanft waren, lag er an dem Quell im Obstgarten des Priesters und blickte nieder auf das Wunder seines Antlitzes und lachte vor Freude, die ihm seine Schönheit bereitete.
Oft schalten ihn der Holzfäller und sein Weib und sagten: »Wir handelten an dir nicht so, wie du an denen handelst, die trostlos sind und niemanden haben, der ihnen beisteht. Warum bist du so grausam gegen alle, die Mitleid brauchen?«
Oft schickte der alte Priester nach ihm und versuchte, ihn die Liebe zu allen lebenden Geschöpfen zu lehren, und sprach zu ihm: »Die Fliege ist dein Bruder. Tu ihr nichts zuleide. Die wilden Vögel, die durch den Wald schwärmen, haben ihre Freiheit. Fange sie nicht zu deinem Vergnügen mit der Schlinge. Gott hat die Blindschleiche und den Maulwurf erschaffen, und ein jedes hat seinen Platz. Wer bist du, dass du Leid in Gottes Welt bringst? Selbst das Vieh auf dem Felde preiset lhn.«
Doch das Sternenkind achtete ihrer Worte nicht, sondern blickte finster und höhnte und ging zurück zu seinen Gefährten und führte sie an. Und seine Gefährten folgten ihm, denn er war schön und leichtfüßig und konnte tanzen und pfeifen und musizieren. Und wohin auch das Sternenkind sie führte, dahin folgten sie ihm, und was er sie auch tun hieß, das taten sie. Und wenn er mit einem scharfen Rohr dem Maulwurf die trüben Augen durchbohrte, dann lachten sie, und wenn er nach dem Aussätzigen mit Steinen warf, lachten sie gleichfalls. Und in allen Dingen beherrschte er sie, und sie wurden so hartherzig wie er.
Nun kam eines Tages ein armes Bettelweib durch das Dorf. Ihre Kleider waren zerrissen und zerlumpt, und ihre Füße bluteten von dem holprigen Weg, den sie gewandert war, und sie befand sich in einem sehr schlimmen Zustand. Und da sie müde war, setzte sie sich unter eine Kastanie, um auszuruhen.
Doch als das Sternenkind sie sah, sagte es zu seinen Gefährten: »Seht nur Da sitzt ein schmutziges Bettelweib unter dem schönen, grünbelaubten Baum. Kommt, wir wollen sie von dort verjagen; denn
sie ist hässlich und widerwärtig.«
Also ging er näher und warf mit Steinen nach ihr und verhöhnte sie, und sie sah ihn mit entsetzten Augen an und wandte nicht den Blick von ihm. Und als der Holzfäller, der ganz in der Nähe auf
einem Hof Holz hackte, sah, was das Sternenkind tat, lief er hin und schalt ihn und sprach: »Wahrlich, du bist hartherzig und kennst kein Erbarmen, denn was hat dir diese arme Frau Böses getan,
dass du sie auf solche Weise behandelst?«
Und das Sternenkind wurde rot vor Zorn und stampfte mit dem Fuß auf und sagte: »Wer bist du, dass ich dir Rechenschaft geben sollte über mein Tun? Ich bin nicht dein Sohn, dass ich dir gehorchen
müsste.«
»Da sprichst du wahr«, antwortete der Holzfäller, »dennoch habe ich mich deiner erbarmt, als ich dich im Walde fand.« Und als die Frau diese Worte hörte, stieß sie einen lauten Schrei aus und
fiel in Ohnmacht. Und der Holzfäller trug sie in sein Haus, und sein Weib kümmerte sich um sie, und als sie aus ihrer Ohnmacht erwachte, setzten sie ihr zu essen und zu trinken vor und luden sie
ein, sich's bequem zu machen.
Aber sie wollte weder essen noch trinken, sondern fragte den Holzfäller: »Sagtest du nicht, der Knabe wurde im Wald gefunden? Und war das nicht heute vor zehn Jahren?«
Und der Holzfäller antwortete: »Ja, im Wald habe ich ihn gefunden, und das war heute vor zehn Jahren.«
»Und welche Kennzeichen fandest du an ihm?« rief sie. »Trug er nicht eine Bernsteinkette um den Hals? War er nicht gehüllt in einen Mantel aus Goldgewebe, mit Sternen bestickt?«
»Wahrhaftig«, erwiderte der Holzfäller, »es war so, wie du sagst.« Und er holte den Mantel und die Bernsteinkette aus der Truhe, darin sie lagen, und zeigte sie ihr.
Und als sie die beiden Dinge erblickte, weinte sie vor Freude und sagte: »Er ist mein kleiner Sohn, den ich im Wald verlor. Ich bitte dich, rufe ihn schnell, denn auf der Suche nach ihm habe ich die ganze Welt durchwandert.«
Also gingen der Holzfäller und sein Weib hinaus und riefen das Sternenkind und sprachen zu ihm: »Geh ins Haus, dort wirst du deine Mutter finden, die dich erwartet.«
So lief er hinein, von Staunen und großer Freude erfüllt. Doch als er jene erblickte, die dort wartete, lachte er höhnisch und sagte: »Nun, wo ist meine Mutter? Denn ich sehe hier niemanden als
dies garstige Bettelweib.«
Und die Frau antwortete ihm: »Ich bin deine Mutter.«
»Du bist toll, so zu reden«, rief das Sternenkind zornig. »Ich bin nicht dein Sohn, denn du bist eine Bettlerin und hässlich und in Lumpen. Deshalb scher dich fort von hier und lass mich nie
wieder dein abscheuliches Gesicht sehen.«
»Nicht so, du bist wirklich mein kleiner Sohn, den ich im Walde gebar«, rief sie, und sie fiel auf die Knie und streckte die Arme nach ihm aus. »Die Räuber stahlen dich von meiner Seite und
überließen dich dem Tod«, sagte sie leise, »aber ich erkannte dich, sobald ich dich erblickte, und die Kennzeichen habe ich ebenfalls erkannt, den Mantel aus Goldgewebe und die Bernsteinkette.
Deshalb bitte ich dich, komm mit mir, denn die ganze Welt habe ich auf der Suche nach dir durchwandert. Komm mit mir, mein Sohn, denn ich brauche deine Liebe.«
Doch das Sternenkind rührte sich nicht von der Stelle, sondern verschloss die Türen seines Herzens gegen sie, und es war kein Laut zu hören als das schmerzliche Weinen der Frau.
Und endlich sprach er zu ihr, und seine Stimme war hart und unfreundlich. »Wenn du in Wahrheit meine Mutter bist«, sagte er, »so wärest du besser fortgeblieben und nicht hierher gekommen, mich in Schande zu bringen, da ich glaubte, ich sei das Kind eines Sternes und nicht einer Bettlerin Kind, wie du mir erzählst. Deshalb scher dich fort von hier und lass mich dich nie wieder sehen.«
»Ach, mein Sohn«, rief sie, »willst du mich nicht küssen, ehe ich gehe? Denn ich habe viel erlitten, dich zu finden.«
»Nein«, sagte das Sternenkind, »du bist zu widerwärtig anzusehen, und lieber als dich wollte ich die Natter oder die Kröte küssen.«
Da stand die Frau auf und ging bitterlich weinend fort in den Wald, und als das Sternenkind sah, dass sie gegangen war, freute sich der Knabe und lief zurück zu seinen Spielgefährten, um mit
ihnen zu spielen.
Doch als sie ihn kommen sahen, verlachten sie ihn und sagten: »Ei, du bist garstig wie die Kröte und ekelhaft wie die Natter. Scher dich fort, denn wir wollen dich nicht mit uns spielen lassen«,
und sie jagten ihn aus dem Garten.
Und das Sternenkind blickte finster und sprach zu sich: >Was soll das bedeuten, was sie zu mir sagen? Ich will zum Wasserquell gehen und hineinschauen, und er wird mir von meiner Schönheit
sprechen.<
So ging er zum Wasserquell und schaute hinein, und siehe, sein Gesicht glich dem Gesicht einer Kröte, und sein Körper war schuppig wie eine Natter. Und er warf sich nieder in das Gras und weinte
und sprach zu sich: >Wahrlich, das ist über mich gekommen wegen meiner Sünde. Denn ich habe meine Mutter verleugnet und sie davongejagt und bin hochmütig und grausam gegen sie gewesen. Deshalb
will ich gehen und in der ganzen Welt nach ihr suchen, und ich will nicht rasten, ehe ich sie gefunden habe.
Und die kleine Tochter des Holzfällers kam zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte: »Was macht es schon, wenn du deine Wohlgestalt verloren hast? Bleib bei uns, und ich will
nicht über dich spotten.«
Und er antwortete ihr: »Nein, ich bin grausam gegen meine Mutter gewesen, und zur Strafe dafür wurde mir dies Unheil zuteil. Deshalb muss ich von hier fortgehen und durch die Welt wandern, bis
ich sie finde und ihre Vergebung erlange.«
So lief er fort in den Wald und rief nach seiner Mutter, dass sie zu ihm komme, erhielt aber keine Antwort. Den ganzen Tag rief er nach ihr, und als die Sonne unterging, legte er sich auf einem Lager von Blättern zum Schlaf nieder, und die Vögel und anderen Tiere flohen vor ihm, denn sie gedachten seiner Grausamkeit, und er blieb allein, bis auf die Kröte, die ihn belauerte, und die träge Natter, die vorbeiglitt. Und am Morgen stand er auf und pflückte ein paar herbe Beeren von den Bäumen und aß sie und nahm heftig weinend seinen Weg durch den großen Wald. Und bei jedem, den er traf, erkundigte er sich, ob er vielleicht seine Mutter gesehen habe.
Zu dem Maulwurf sprach er: »Du kannst unter die Erde gehen. Sag mir, ist meine Mutter dort?«
Und der Maulwurf antwortete: »Du hast mir die Augen geblendet. Wie sollte ich es wissen?«
Zu dem Hänfling sprach er: »Du kannst über die Wipfel der hohen Bäume fliegen und kannst die ganze Welt sehen. Sag mir, kannst du meine Mutter sehen?«
Und der Hänfling antwortete: »Du hast mir zu deinem Spaß die Flügel beschnitten. Wie sollte ich fliegen?«
Und zu dem kleinen Eichhörnchen, das in der Föhre wohnte und einsam war, sprach er: »Wo ist meine Mutter?«
Und das Eichhörnchen antwortete: »Die meine hast du umgebracht. Willst du jetzt auch die deine umbringen.«
Und das Sternenkind weinte und beugte den Kopf und bat Gottes Geschöpfe um Vergebung und ging weiter durch den Wald auf der Suche nach dem Bettelweib. Und am dritten Tag kam er zum anderen Ende
des Waldes und ging hinab in die Ebene.
Und wenn er durch die Dörfer kam, verhöhnten ihn die Kinder und warfen Steine nach ihm, und die Bauern wollten ihn nicht einmal im Kuhstall schlafen lassen, damit er nicht den Brand über das gespeicherte Korn bringe, so garstig war er anzusehen, und ihre Tagelöhner jagten ihn fort, und da war niemand, der Mitleid mit ihm hatte. Auch konnte er nirgendwo etwas von der Bettlerin erfahren, die seine Mutter war, obgleich er drei Jahre lang durch die Welt wanderte und obgleich ihm häufig war, als sähe er sie vor sich auf der Straße, und er nach ihr rief und hinter ihr her lief, bis die scharfen Kiesel das Blut aus seinen Füßen springen ließen. Aber er vermochte sie nicht einzuholen, und die am Weg wohnten, verneinten stets, sie oder eine, die ihr glich, gesehen zu haben, und machten sich lustig über seinen Kummer.
Drei Jahre lang wanderte er durch die Welt, und es gab in der Welt weder Liebe noch Herzensgüte, noch Barmherzigkeit für ihn, sondern es war genauso eine Welt, wie er sie sich in den Tagen seiner großen Hoffart geschaffen hatte.
Und eines Tages kam er an das Tor einer Stadt mit starken Mauern, die an einem Fluss stand, und ob er gleich müde war und sich die Füße wundgelaufen hatte, ging er doch darauf zu, um einzutreten.
Aber die Soldaten, die Wache standen, senkten ihre Hellebarden über den Eingang und fragten ihn unfreundlich: »Was willst du in dieser Stadt?«
»Ich suche meine Mutter«, antwortete er, »und ich bitte euch, mich durchzulassen, denn vielleicht befindet sie sich in dieser Stadt.« Aber sie verlachten ihn, und einer von ihnen schüttelte
seinen schwarzen Bart und setzte seinen Schild nieder und sprach: »Wahrhaftig, deine Mutter wird sich nicht freuen, wenn sie dich sieht, denn du bist hässlicher als die Kröte im Sumpf oder die
Natter, die im Moor kriecht. Scher dich fort. Scher dich fort. Deine Mutter wohnt nicht in dieser Stadt.«
Und ein anderer, der ein gelbes Banner in der Hand hielt, sagte zu ihm: »Wer ist deine Mutter, und warum suchst du sie?«
Und er antwortete: »Meine Mutter ist eine Bettlerin, so wie ich ein Bettler bin, und ich habe sie übel behandelt, und ich bitte euch, mich durchzulassen, damit ich ihre Vergebung erlangen kann, falls sie in dieser Stadt weilt.« Aber sie wollten nicht und stachen ihn mit ihren Spießen.
Und als er sich weinend abwandte, kam einer, dessen Rüstung mit goldenen Blumen inkrustiert war und auf dessen Helm ein geflügelter Löwe kauerte, und erkundigte sich bei den Soldaten, wer Einlass
begehrt habe. Und sie sagten ihm: »Es ist ein Bettler und einer Bettlerin Kind, und wir haben ihn davongejagt.«
»Nein«, rief er lachend aus, »wir wollen das garstige Geschöpf als Sklaven verkaufen, und sein Preis soll der Preis für einen Humpen süßen Weines sein.«
Und ein alter Mann mit einem bösen Gesicht, der vorbeikam, rief aus: »Für diesen Preis will ich ihn kaufen«, und als er den Preis gezahlt hatte, nahm er das Sternenkind bei der Hand und führte den Knaben in die Stadt.
Und nachdem sie durch viele Straßen gegangen waren, kamen sie an eine kleine, in eine Mauer eingelassene Tür, die ein Granatapfelbaum überdachte. Und der alte Mann berührte die Tür mit einem Ring
aus geschnittenem Jaspis, und sie tat sich auf, und sie gingen fünf eherne Stufen hinab in einen Garten voll schwarzem Mohn und grünen Kruken aus gebranntem Ton. Und der alte Mann entnahm seinem
Turban ein Tuch aus gemusterter Seide und verband dem Sternenkind die Augen und trieb den Knaben vor sich her. Und als ihm die Binde von den Augen genommen war, sah sich das Sternenkind in einem
Verlies, das durch eine Laterne aus Horn erhellt war.
Und der Alte setzte ihm auf einem Brett ein wenig schimmliges Brot vor und sagte: »Iss«, und in einem Becher ein wenig Brackwasser und sagte: »Trink«, und als der Knabe gegessen und getrunken hatte, ging der Alte hinaus und verschloss hinter sich die Tür und sicherte sie mit einer Eisenkette.
Und am Morgen kam der Alte, der in Wahrheit der abgefeimteste aller Zauberer in Libyen war und seine Kunst von einem gelernt hatte, der in den Grabgewölben am Nil wohnte, zu ihm herein und blickte ihn finster an und sprach: »In einem Wald nahe dem Tor dieser Stadt der Ungläubigen liegen drei Stücke Gold. Eines ist von weißem Gold, das zweite von gelbem Gold, und das Gold des dritten ist rot. Heute sollst du mir das Stück weißen Goldes holen, und wenn du es nicht herbringst, werde ich dich mit hundert Streichen schlagen. Mach dich geschwind davon, und bei Sonnenuntergang werde ich dich an der Gartentür erwarten. Sich zu, dass du das weiße Gold bringst, oder es wird dir übel ergehen, denn du bist mein Sklave, und ich habe dich um den Preis für einen Humpen süßen Weines gekauft.« Und er verband dem Sternenkind die Augen mit dem Tuch aus gemusterter Seide und führte den Knaben durch das Haus und durch den Mohngarten und die fünf ehernen Stufen hinauf. Und nachdem er die kleine Tür mit seinem Ring geöffnet hatte, schob er ihn auf die Straße.
Und das Sternenkind ging zum Tor hinaus aus der Stadt und kam zu dem Wald, von dem ihm der Zauberer erzählt hatte.
Nun war dieser Wald von außen sehr schön anzusehen und schien voll singender Vögel und süßduftender Blumen zu sein, und das Sternenkind betrat ihn frohen Herzens. Doch seine Schönheit nützte ihm wenig, denn wohin er auch ging, wuchsen Sträucher und Büsche mit scharfen Dornen aus dem Boden empor und schlossen ihn ein, und böse Nesseln stachen ihn, und die Distel durchbohrte ihn mit ihren Dolchen, so dass er arge Pein litt. Auch konnte er nirgendwo das Stück weißen Goldes finden, von dem der Zauberer gesprochen hatte, obgleich er vom Morgen bis zum Mittag und von Mittag bis Sonnenuntergang danach suchte. Und bei Sonnenuntergang wandte er bitterlich weinend sein Gesicht heimwärts, da er wusste, welches Los seiner wartete.
Doch als er den Saum des Waldes erreicht hatte, vernahm er aus dem Dickicht einen Schrei wie von einem, der in Not ist. Und seinen eigenen Kummer vergessend, lief er zurück zu der Stelle und sah
einen kleinen Hasen, der in einer von Jägerhand aufgestellten Falle gefangen war.
Und das Sternenkind hatte Mitleid mit ihm und befreite ihn und sagte zu ihm: »Ich bin selber nur ein Sklave, dennoch kann ich dir die Freiheit schenken.«
Und der Hase antwortete ihm und sprach: »Du hast mir fürwahr die Freiheit geschenkt, und was soll ich dir zum Dank dafür geben?«
Und das Sternenkind sagte: "Ich suche nach einem Stück weißen Goldes, aber ich kann es nirgendwo finden, und wenn ich es meinem Herrn nicht bringe, wird er mich schlagen.« »Komm mit mir«, sagte der Hase, »ich werde dich hinführen, denn ich weiß, wo es verborgen ist und zu weichem Zweck.«
Also ging das Sternenkind mit dem Hasen, und siehe, im Spalt einer mächtigen Eiche erblickte er das Stück weißen Goldes, das er suchte. Und er war voller Freude und ergriff es und sagte zu dem
Hasen: »Den Dienst, den ich dir geleistet habe, hast du mir viele Male gelohnt, und die Freundlichkeit, die ich dir erwies, hast du mir hundertfach vergolten.«
»Nicht so«, antwortete der Hase, »wie du an mir tatest, so habe ich an dir getan«, und er lief flink davon, und das Sternenkind wanderte der Stadt zu.
Nun hockte aber am Stadttor einer, der aussätzig war. Über das Gesicht hing ihm eine Kapuze aus grauem Leinen, und durch die Sehlöcher funkelten seine Augen wie rotglühende Kohlen. Und als er das Sternenkind kommen sah, schlug er auf einen Holznapf und rasselte mit seiner Schelle und rief ihn an und sprach: »Gib mir ein Geldstück, oder ich muss Hungers sterben. Denn sie haben mich aus der Stadt geworfen, und da ist niemand, der sich meiner erbarmt. «
»Ach«, rief das Sternenkind, »ich habe nur ein einziges Geldstück in meinem Beutel, und wenn ich es meinem Herrn nicht bringe, wird er mich schlagen, denn ich bin sein Sklave.«
Aber der Aussätzige flehte ihn an und bat ihn inständig, bis sich das Sternenkind erbarmte und ihm das Stück weißen Goldes gab.
Und als der Knabe zum Hause des Zauberers kam, öffnete ihm der Zauberer und holte ihn herein und fragte ihn: »Hast du das Stück weißen Goldes?« Und das Sternenkind antwortete: »Ich habe es nicht.« Da fiel der Zauberer über den Knaben her und schlug ihn und setzte ihm ein leeres Brett vor und sagte: »Iss«, und einen leeren Becher und sagte: »Trink«, und warf ihn wieder in das Verlies.
Und am Morgen kam der Zauberer zu ihm und sprach: »Wenn du mir heute nicht das Stück gelben Goldes bringst, so werde ich dich ganz gewiss als meinen Sklaven behalten und dir dreihundert Hiebe geben.«
Also ging das Sternenkind in den Wald, und den ganzen Tag suchte der Knabe nach dem Stück gelben Goldes, aber nirgendwo konnte er es finden. Und bei Sonnenuntergang setzte er sich nieder und
begann zu weinen, und während er noch weinte, kam der kleine Hase zu ihm, den er aus der Falle befreit hatte. Und der Hase fragte ihn: »Warum weinst du? Und wonach suchst du im Wald?«
Und das Sternenkind antwortete: »Ich suche nach einem Stück gelben Goldes, das hier verborgen ist, und wenn ich es nicht finde, wird mein Herr mich schlagen und als Sklave behalten.«
»Folge mir«, rief der Hase, und er lief durch den Wald, bis er zu einem Wassertümpel kam. Und am Grunde des Tümpels lag das Stück gelben Goldes.
»Wie soll ich dir danken?« sagte das Sternenkind. »Denn siehe, dies ist das zweite Mal, dass du mir geholfen hast.«
»Nicht doch, du hast dich zuerst meiner erbarmte, erwiderte der Hase und lief geschwind davon.
Und das Sternenkind nahm das Stück gelben Goldes und steckte es in seinen Beutel und eilte der Stadt zu. Doch der Aussätzige sah den Knaben kommen und lief ihm entgegen und kniete nieder und
rief: »Gib mir ein Geldstück, oder ich werde Hungers sterben.«
Und das Sternenkind sprach zu ihm: »Ich habe in meinem Beutel nur ein Stück gelben Goldes, und wenn ich es meinem Herrn nicht bringe, wird er mich schlagen und als seinen Sklaven behalten.«
Aber der Aussätzige flehte ihn so inständig an, dass sich das Sternenkind seiner erbarmte und ihm das Stück gelben Goldes gab.
Und als er zum Hause des Zauberers kam, öffnete ihm der Zauberer und fragte ihn: »Hast du das Stück gelben Goldes?« Und das Sternenkind antwortete ihm: »Ich habe es nicht.« Da fiel der Zauberer
über den Knaben her und schlug ihn und belud ihn mit Ketten und warf ihn wieder in das Verlies.
Und am Morgen kam der Zauberer zu ihm und sprach: »Wenn du mir heute das Stück roten Goldes bringst, werde ich dich freilassen; bringst du es aber nicht, so werde ich dich wahr und wahrhaftig
erschlagen.«
Also ging das Sternenkind in den Wald, und den ganzen Tag suchte der Knabe nach dem Stück roten Goldes, konnte es jedoch nirgendwo finden. Und am Abend setzte er sich nieder und weinte, und
während er noch weinte, kam der kleine Hase zu ihm.
Und der Hase sprach zu ihm: »Das Stück roten Goldes, das du suchst, befindet sich in der Höhle hinter dir. Deshalb weine nicht mehr, sondern sei fröhlich.«
»Wie soll ich dir nur danken«, rief das Sternenkind, »denn siehe, dies ist das dritte Mal, dass du mir geholfen hast«
»Nicht doch, du hast dich zuerst meiner erbarmt«, antwortete der Hase und lief geschwind davon.
Und das Sternenkind trat in die Höhle und fand in ihrer äußersten Ecke das Stück roten Goldes. Das steckte der Knabe in seinen Beutel und eilte der Stadt zu. Und da ihn der Aussätzige kommen sah,
stellte er sich mitten auf die Straße und rief ihn an und sprach: »Gib mir das rote Goldstück, oder ich muss Hungers sterben«, und wieder erbarmte sich das Sternenkind seiner und gab ihm das
Stück roten Goldes und sagte: »Deine Not ist größer als meine.« Doch das Herz war ihm schwer, denn er wusste, welch schlimmes Los seiner wartete.
Doch siehe, als er durch das Stadttor ging, verneigten sich die Wachen vor ihm und huldigten ihm und sprachen: »Wie schön ist unser Gebieter«, und eine große Schar Bürger folgte ihm und rief:
»Wahrlich, niemand auf der ganzen Welt ist so schön«, weshalb das Sternenkind weinte und zu sich sprach: >Sie verhöhnen mich und achten nicht meines Elends.< Und so gewaltig war der
Zusammenstrom des Volkes, dass der Knabe die Richtung verlor und sich schließlich auf einem Platz sah, wo eines Königs Palast stand.
Und das Tor des Palastes tat sich auf, und die Priester und die hohen Würdenträger der Stadt kamen ihm eilends entgegen, und sie demütigten sich vor ihm und sprachen: »Du bist unser Gebieter, den
wir erwarteten, und der Sohn unseres Königs.«
Und das Sternenkind antwortete ihnen und sprach: »Ich bin keines Königs Sohn, sondern das Kind einer armen Bettlerin. Und warum sagt ihr, ich sei schön, da ich doch weiß, dass ich übel
anzuschauen bin?«
Da hob jener, dessen Rüstung mit goldenen Blumen inkrustiert war und auf dessen Helm ein geflügelter Löwe kauerte, einen Schild empor und rief: »Wie kann mein Gebieter sagen, er sei nicht
schön?«
Und das Sternenkind blickte hinein, und siehe, sein Antlitz war wie einstmals, und seine Wohlgestalt war ihm wiedergegeben, und er sah in seinen Augen, was er nie zuvor darin gesehen hatte.
Und die Priester und die hohen Würdenträger knieten nieder und sprachen zu ihm: »Es wurde uns einst prophezeit, dass am heutigen Tage jener kommen würde, der über uns herrschen soll. Deshalb geruhe unser Gebieter, diese Krone und dies Zepter entgegenzunehmen und in seiner Gerechtigkeit und Gnade König über uns zu sein.«
Er aber antwortete ihnen: »Ich bin dessen nicht wert, denn ich habe die Mutter verleugnet, die mich gebar, und ich darf nicht rasten, ehe ich sie gefunden und ihre Vergebung erlangt habe. Deshalb
lasst mich gehen, denn ich muss wieder durch die Welt wandern und darf hier nicht verweilen, ob ihr mir auch die Krone und das Zepter darbietet.« Und als er gesprochen hatte, wandte er sein
Gesicht von ihnen ab und der Straße zu, die zum Stadttor führte, und siehe, in der Menge, die sich um die Soldaten drängte, erblickte er die Bettlerin, die seine Mutter war, und an ihrer Seite
stand der Aussätzige, der am Wegrand gesessen hatte.
Und ein Schrei der Freude löste sich von seinen Lippen, und er lief hin und kniete nieder und küsste die Wunden an den Füßen seiner Mutter und benetzte sie mit seinen Tränen. Er neigte das Haupt in den Staub, und schluchzend, als sollte ihm das Herz brechen, sprach er zu ihr: »Mutter, in der Stunde meiner Hoffart habe ich dich verleugnet. Nimm mich auf in der Stunde meiner Demut. Mutter, ich gab dir Hass. Gib du mir Liebe. Mutter ich stieß dich zurück. Empfange du nun dein Kind.« Aber die Bettlerin antwortete ihm nicht.
Und er streckte die Hände aus und umfing die weißen Füße des Aussätzigen und sprach zu ihm: »Dreimal habe ich mich deiner erbarmt. Heiße meine Mutter nur einmal zu mir sprechen.« Aber der
Aussätzige antwortete ihm nicht.
Und wieder schluchzte er und sagte: »Mutter, mein Leiden ist größer, als ich es ertragen kann. Lass mir deine Vergebung zuteil werden und lass mich zurückkehren in den Wald.« Und die Bettlerin
legte ihm die Hand aufs Haupt und sprach: »Steh auf«, und der Aussätzige legte ihm die Hand aufs Haupt und sagte ebenfalls: »Steh auf.«
Und er stand auf und blickte sie an, und siehe, sie waren ein König und eine Königin.
Und die Königin sprach zu ihm: »Dies ist dein Vater, dem du geholfen hast.«
Und der König sprach: »Dies ist deine Mutter, deren Füße du in deinen Tränen gebadet hast.«
Und sie fielen ihm um den Hals und küssten ihn und führten ihn in den Palast und kleideten ihn in schöne Gewänder und setzten ihm die Krone aufs Haupt und legten ihm das Zepter in die Hand, und er herrschte über die Stadt am Strom und war ihr Gebieter. Große Gerechtigkeit und Gnade bezeigte er gegen alle, und den bösen Zauberer verbannte er, und dem Holzfäller und seinem Weibe schickte er viele kostbare Geschenke, und ihren Kindern erwies er hohe Ehre. Und er duldete nicht, dass jemand grausam war gegen Vögel oder anderes Getier, sondern lehrte Liebe und Herzensgüte und Barmherzigkeit, und den Armen gab er Brot, und denen, die nackt und bloß waren, gab er Kleidung, und es herrschte Friede und Überfluss im Lande.
Doch er regierte nicht lange, so groß war sein Leiden gewesen und so schmerzhaft das Feuer seiner Prüfung; drei Jahre später starb er. Und der nach ihm kam, regierte schlecht.
Quellangabe: Oscar Wilde - Ein Granatapfelhaus 1891
Kati Knack-die-Nuss
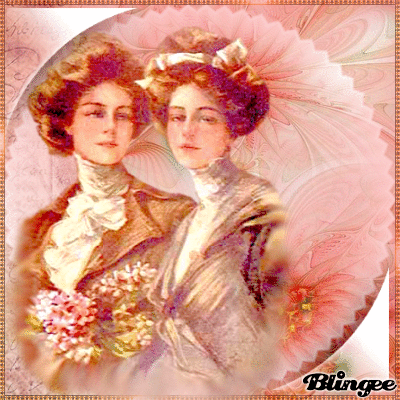
Vor langer Zeit lebten ein König und eine Königin, wie es sie in vielen Ländern gab.
Dem König war die Frau gestorben und der Königin war der Mann gestorben, und nach einer Zeit heirateten die beiden.
Der König hatte eine Tochter, die hieß Anne, und die Königin hatte eine Tochter, die hieß Kati.
Nun war aber Anne, die Tochter des Königs, viel schöner als Kati, die Tochter der Königin; gleichwohl sich die beiden Mädchen einander liebten, wie richtige Schwestern.
Die Königin jedoch war neidisch. Es quälte sie, dass des Königs Tochter hübscher war als ihre eigene, und sie sann darüber nach, wie sie deren Schönheit zerstören könnte.
Sie sann und sann und schließlich ließ sie eine Hühnerfrau, eine alte Zauberin, die in der Nähe in einer Schlucht wohnte, zu sich kommen. „Kannst du mir helfen, Annes Schönheit zu
zerstören?“
„Das kann ich wohl. Schick das Mädchen nur morgen früh zu mir, aber schick sie nüchtern. Sie soll vorher nichts essen und trinken!“
Früh am nächsten Morgen also weckte die Königin Anne: „Meine Liebe, lauf gleich hinunter in die Schlucht zur Hühnerfrau und hole ein paar Eier!“
Da machte sich Anne sogleich auf, doch als sie durch die Küche kam, sah sie dort einen Kanten Brot liegen, den nahm sie mit und kaute ihn beim Gehen.
Sie kam zur Hütte der Hühnerfrau und trat ein.
„Hühnerfrau, die Mutter schickt mich um ein paar Eier“ – „Ja, heb den Deckel von dem Topf dort und sieh, was geschieht!“
Anne nahm den Deckel hoch – doch es geschah nichts.
Die Hühnerfrau gab ihr die Eier. „Geh heim zu deiner Mutter und sag ihr, sie soll die Tür zur Speisekammer besser verschlossen halten!“
Anne ging also heim und erzählte der Königin, was die Hühnerfrau gesagte hatte. Da wusste die Königin, das Mädchen hatte etwas gegessen.
Am nächsten Morgen schickte sie Anne wieder früh zur Hühnerfrau. Diesmal lag kein Brotkanten in der Küche und die Tür zur Speisekammer war verschlossen, und die Königin passte genau auf, dass
Anne ohne Essen fortging.
Doch unterwegs, auf dem Feld neben dem Weg, sah die Anne ein paar Bauern, die pflückten Erbsen, und weil sie freundlich zu jedermann war, sprach sie mit ihnen. Sie bekam eine Handvoll Erbsen und
aß sie unterwegs.
So kam sie zur Hühnerfrau.
„Die Mutter schickt mich um Eier.“
„Heb den Deckel von jenen Topf und sieh, was geschieht.“
Anne hob den Deckel hoch – doch wieder geschah nichts.
Da wurde die Hühnerfrau recht ärgerlich. „Sag deiner Mutter, der Topf wird nicht kochen, wenn kein Feuer da ist.“
Anne nahm die Eier, ging nach Hause und berichtete es der Königin.
Am dritten Morgen nun ging die Königin selbst mit ihr zur Hühnerfrau.
Als Anne diesmal den Deckel vom Topf hob, - da fiel ihr eigener, hübscher Kopf ab und – wupps – ein Schafskopf war an seiner Stelle gesprungen. – Denkt euch, ein Schafskopf saß auf ihren Hals! –
Nun war die Königin zufrieden, und zufrieden ging sie nach Hause.
Ihre eigene Tochter Kati aber, die war sehr unglücklich darüber. Sie nahm ein feines Leinentuch und wickelte es ihrer Schwester um den Kopf, so dass er ganz verdeckt war. Dann nahm sie Anne bei
der Hand, und verließ mit ihr das Schloss. Die beiden gingen fort von zu Hause, um in der Fremde ihr Glück zu suchen.
Sie gingen und gingen und gingen, bis sie an ein Schloss kamen.
Kati klopfte ans Tor. Sie bat um ein Nachtlager für sich und ihre kranke Schwester.
Sie wurden eingelassen und sie erfuhren: dies war das Schloss eines Königs, der hatte zwei Söhne, und der eine Sohn war sterbenskrank. Alle Ärzte und Gelehrten des Reiches waren schon konsultiert
worden, doch keiner konnte herausfinden, was dem Prinzen fehlte. Und das seltsamste war, wer auch immer eine Nacht bei ihm wachte, war am nächsten Morgen verschwunden und wurde nie mehr gesehen.
Nun hatte der König verkünden lassen: „Wer eine Nacht bei dem Prinzen Wache hält, soll einen Viertelscheffel Silber bekommen.“
Kati war ein mutiges Mädchen. Sie ließ sich zum König führen.
„Herr König, wenn Ihr erlaubt, werde ich heute nacht beim Prinzen sitzen und Wache halten.“
So geschah es. Bis Mitternacht war alles in Ordnung.
Dann aber, als die Uhr zwölf schlug, erhob sich der kranke Prinz. Er stand auf, kleidete sich an und huschte die Treppe hinab. Kati folgte ihm, und er schien sie nicht zu bemerken.
Der Prinz ging zum Stall, er sattelte sein Pferd und rief seinen Hund. Dann schwang er sich in den Sattel, und Kati sprang flugs hinter ihm auf.
So ritten sie dahin, der Prinz mit Kati hinter sich. Sie ritten durch einen grünen Wald. Und als sie hindurchritten, pflückte Kati Nüsse von den Bäumen, die sie streiften, und sammelte sie in
ihrer Schürze.
Sie ritten und ritten, bis sie zu einem grünen Hügel kamen.
Hier hielt der Prinz das Pferd an, und er sprach:
„Grüner Hügel, öffne dich,
und lass herein mich,
den Prinzen mit seinem Hund und Pferd.“
Und Kati fügte schnell hinzu:
„Und mit dem Mädchen hinter ihm.“
Im gleichen Augenblick öffnete sich der Hügel und sie ritten hinein.
Der Prinz stieg vom Pferd und betrat eine prächtige Halle, die war strahlend hell erleuchtet. Viele schöne Feen umringten den Prinzen und führten ihn hinweg zum Tanz.
Kati, die keiner bemerkte, versteckte sich inzwischen hinter der Tür.
Von dort sah sie den Prinzen tanzen – und tanzen – und tanzen. Er tanzte, bis er nicht mehr konnte und auf ein Polster niederfiel. Da fächelten ihm die Feen Luft zu, sie fächelten so lange, bis
er sich wieder erheben und weitertanzen konnte.
Schließlich krähte der Hahn – und da hatte es der Prinz höchst eilig, aufs Pferd zu kommen. Kati sprang hinter ihm auf, und schon ritten sie nach Hause.
Als die Morgensonne am Himmel aufging, eilten die Diener des Königs zur Kammer des Prinzen. Sie kamen herein, und sie fanden Kati am Feuer sitzen und ihre Nüsse knacken.
„Der Prinz hatte eine gute Nacht. Er schläft.“
Der König freute sich. Und er bat Kati, noch eine Nacht beim Prinzen zu wachen.
„Wenn ich noch eine Nacht bei ihm wachen soll, will ich einen Viertel Scheffel Gold dafür bekommen.“ Das wurde ihr zugesagt.
Die zweite Nacht verging wie die erste. Um Mitternacht stand der Prinz auf, zog sich an, sattelte sein Pferd und ritt fort zu dem grünen Hügel und dem Feenball in der prächtigen Halle. Wieder folgte Kati ihm unbemerkt und als sie durch den Wald ritten, sammelte sie wieder Nüsse in ihrer Schürze. Dieses Mal beobachtete sie nicht den Prinzen, sie wusste ja, er würde tanzen und tanzen und tanzen. Sie beobachtete die Feen. Sie bemerkte ein Feenkind, das spielte mit einem Stab, und sie hört, wie die Feen miteinander plauderten: „Das Kind sollte nicht mit dem Zauberstab spielen. Es weiß nicht, dass drei Schläge mit diesem Stab würden Katis kranke Schwester gesund und wieder so schön machen, wie sie früher war.“
Da nahm Kati eine Nuss aus ihrer Schürze und rollte sie zu dem Feenkind hin, sie rollte noch eine Nuss und noch eine, bis das Feenkind sie bemerkte, hinter den Nüssen hertapste und den Zauberstab
fallen ließ. Kati hob ihn schnell auf und steckte ihn in ihre Schürze.
Beim ersten Hahnenschrei ritten sie wieder geschwind nach Hause, und als sie dort angekommen waren, eilte Kati zuerst in ihr Kämmerchen. Sie berührte Anne dreimal mit dem Zauberstab. Da fiel der
eklige Schafskopf ab – und Anne war wieder sie selbst, die schöne Anne.
Dann eilte Kati in die Kammer des Prinzen, und als die Diener des Königs eintraten, saß sie beim Feuer und knackte Nüsse.
„Der Prinz hat eine gute Nacht gehabt. Ert schläft. Doch noch eine Nacht wache ich nur, wenn ich den kranken Prinzen heiraten kann.“ Auch das wurde ihr zugesagt.
In der dritten Nacht war alles, wie in den beiden Nächten zuvor: Um Mitternacht stand der Prinz auf und ritt zu dem Feenball und Kati folgte ihm unbemerkt, und im Wald pflückte sie wieder Nüsse
und sammelte sie in ihrer Schürze.
Dieses Mal spielte das Feenkind mit einem Vögelchen und Kati hörte eine von den Feen sagen: „Das Kind sollte nicht mit dem Vögelchen spielen. Es weiß nicht, dass drei Bissen von diesem Vögelchen
würden den kranken Prinzen wieder so gesund machen, wie er es nur je gewesen ist.“
Kati nahm eine Nuss aus der Schürze und rollte sie zu dem Feenkind, und noch eine und noch eine, bis das Kind, das Vögelchen fallen ließ. Kati nahm es an sich und steckte es schnell in ihre
Schürze.
Beim ersten Hahnenschrei ritten sie wieder heim und der Prinz sank müde ins Bett.
Kati aber, anstatt wie gewöhnlich ihre Nüsse zu knacken, rupft diesmal erst das Vögelchen und kocht es.
Bald erfüllte ein köstlicher Duft den Raum.
Der kranke Prinz seufzte auf. „Oh, ich wünschte, ich bekäme ein Stückchen von diesem Vögelchen!“
Kati reichte ihm einen Bissen von dem Vogel, der Prinz ass ihn – und er hob den Kopf und stützte sich auf die Ellenbogen.
Nach einer Weile liess er sich wieder vernehmen: „Oh, wenn ich doch noch einen Bissen von diesem Vögelchen haben könnte!“
Da gab Kati ihm einen zweiten Bissen – und der Prinz setzte sich in seinem Bett auf.
Ein Weilchen später: „Oh, hätte ich doch nur einen dritten Bissen von diesem Vögelchen!“
Kati gab ihm den dritten Bissen. Und der Prinz stand auf und war gesund und bei Kräften. Er kleidete sich an und setzte sich ans Feuer.
Als am Morgen die Diener des Königs hereinkamen, fanden sie Kati und den jungen Prinzen am Feuer sitzend und Nüsse knackend.
Inzwischen hatte der andere Sohn des Königs die Schwester Anne gesehen – und er hatte sich auf der Stelle in sie verliebt, so wie es jeder tat, der ihr schönes Gesicht sah.
So also wurde bald eine Doppelhochzeit gefeiert: der vormals kranke Prinz heiratete die gesunde Schwester und der gesunde Prinz heiratete die vormals kranke Schwester, und alle lebten sie
glücklich und gut bis an ihr Ende und tranken niemals aus einem trockenen Hut.
Quelle: Übersetzung und Erzählbearbeitung nach: J. Jacobs „English Fairy Tales“,
Der selbstsüchtige Riese
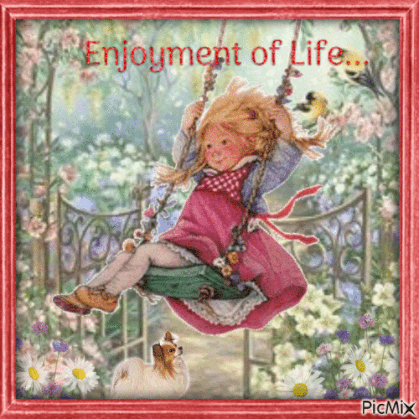
Wenn die Kinder am Nachmittag aus der Schule kamen, gingen sie für gewöhnlich in den Garten des Riesen, um dort zu spielen.
Es war ein großer, wunderschöner Garten mit weichem grünen Gras. Hier und da standen prächtige Blumen sternengleich auf der Wiese, außerdem zwölf Pfirsichbäume, die im Frühjahr zarte Blüten in
rosa und perlweiß hervorbrachten und im Herbst reiche Frucht trugen. Die Vögel saßen in den Bäumen und sangen so lieblich, dass die Kinder im Spiel innehielten, um ihnen zuzuhören. "Wie glücklich
sind wir doch hier!", riefen sie einander zu.
Eines Tages kam der Riese zurück. Er hatte seinen Freund besucht, den Menschenfresser von Cornwall, und er war sieben Jahre lang bei ihm geblieben. Nachdem die sieben Jahre vergangen waren, hatte
der Riese all das gesagt, was zu sagen war; seine Gesprächsbereitschaft war nämlich begrenzt, und so entschied er sich dafür, in sein eigenes Schloss zurückzukehren. Als er dort ankam, sah er die
Kinder in seinem Garten spielen.
"Was macht ihr hier?", schrie er mit äußerst mürrischer Stimme und die Kinder liefen verängstigt davon.
"Mein eigener Garten ist immer noch mein eigener Garten", sagte der Riese, "das muss jeder einsehen, und ich werde niemals jemandem außer mir selbst erlauben, darin zu spielen". Und so errichtete
er eine hohe Mauer rings um den Garten und stellte ein Warnschild mit den folgenden Worten auf: Unbefugten ist der Zutritt bei Strafe verboten! - Er war wirklich ein sehr selbstsüchtiger
Riese.
Die armen Kinder hatten von nun an keinen Ort mehr, wo sie spielen konnten. Sie versuchten auf der Straße zu spielen, aber diese war sehr staubig und voll mit spitzen Steinen, und das gefiel den
Kindern nicht. Immer wieder schlenderten sie nach dem Unterricht um die hohe Mauer herum und sprachen von dem herrlichen Garten, der dahinter verborgen lag. "Wie glücklich waren wir doch dort",
sagten sie zueinander.
Dann kam der Frühling und überall - landauf, landab - waren kleine Blüten zu sehen, und junge Vögel zwitscherten vergnügt. Nur im Garten des selbstsüchtigen Riesen war immer noch Winter. Die
Vögel wollten dort nicht singen und die Bäume vergaßen zu blühen, weil keine Kinder mehr da waren. Einmal streckte eine wunderschöne Blume ihren Kopf aus dem Gras heraus, aber als sie das
Hinweisschild sah, hatte sie so großes Mitleid mit den Kindern, dass sie sich sofort wieder in den Boden zum Schlafen zurückzog. Die einzigen, denen der Garten noch gefiel, waren der Schnee und
der Frost. "Der Frühling hat diesen Garten vergessen", riefen sie erfreut, "wir werden das ganze Jahr über hier bleiben".
Der Schnee bedeckte das Gras mit seinem dicken weißen Mantel und der Frost ließ alle Bäume silbern erscheinen. Dann luden sie den Nordwind ein, ihnen Gesellschaft zu leisten - und er kam. Er war in warme Felle gehüllt, brüllte unaufhörlich durch den Garten und blies die Schornsteinbleche hinunter. "Welch ein herrlicher Platz", schwärmte er, "wir sollten den Hagel bitten, uns zu besuchen". Und der Hagel kam. Jeden Tag prasselte er drei Stunden lang auf das Dach des Schlosses, bis er fast alle Ziegel zerstört hatte, und danach sauste er, so schnell er konnte, quer durch den Garten. Er war ganz in grau gekleidet und sein Atem war so kalt wie Eis.
"Ich kann nicht verstehen, warum der Frühling in diesem Jahr so spät kommt", sagte der selbstsüchtige Riese, als er an dem Fenster saß und in seinen kalten weißen Garten blickte; "ich hoffe, dass
sich das Wetter bald ändert".
Aber es kamen weder Frühling noch Sommer. Der Herbst beschenkte jeden Garten mit goldenen Früchten, nur den Garten des Riesen sparte er aus. "Er ist zu selbstsüchtig", sagte der Herbst. So war
anhaltender Winter im Garten; und der Nordwind, der Hagel, der Frost und der Schnee tanzten im Wechsel zwischen den Bäumen herum.
Eines Morgens lag der Riese wach in seinem Bett, als er eine wunderschöne Musik hörte. Sie klang so lieblich in seinen Ohren, dass er dachte, es könnten nur die Musiker des Königs sein, die
vorbeizögen. In Wirklichkeit aber war es nur ein kleiner Hänfling, der draußen vor seinem Fenster sang; aber es war so lange her, seit er einen Vogel in seinem Garten hatte singen hören, dass er
das Gefühl hatte, die schönste Musik der Welt zu vernehmen. In diesem Moment hörte der Hagel auf, über seinem Kopf herumzutanzen, der Nordwind stellte sein Gebrüll ein und ein köstlicher Duft
strömte ihm durch das geöffnete Fenster entgegen. "Ich glaube, nun kommt der Frühling wohl doch noch", sagte der Riese, sprang aus dem Bett und guckte nach draußen.
Und was sah er da?
Es war der wundervollste Anblick, den man sich denken konnte. Die Kinder waren durch ein kleines Loch in der Mauer in den Garten gekrochen und saßen nun auf den Zweigen der Bäume - in jedem Baum,
den er sehen konnte, ein kleines Kind. Und die Bäume waren so froh, die Kinder endlich wieder bei sich zu haben, dass sie sich mit Blüten schmückten und ihre Zweige gleich schützenden Händen über
den Köpfen der Kinder auf und ab bewegten. Die Vögel flogen umher und zwitscherten vor Vergnügen und die Blumen schauten lachend aus dem frischen grünen Gras heraus. Es war ein anmutiges Bild,
nur in einer Ecke des Gartens war noch immer Winter. Dort, in dem entferntesten Winkel, stand ein kleiner Junge. Er war so klein, dass er nicht an die Zweige des Baumes heranreichen konnte; immer
wieder ging er um ihn herum und weinte bitterlich. Der arme Baum war immer noch über und über mit Eis und Schnee bedeckt und der Nordwind blies und heulte über ihn hinweg. "Klettere nur hinauf,
kleiner Junge!", sagte der Baum freundlich, und beugte seine Zweige so tief herunter, wie er konnte, aber der Junge war einfach zu klein.
Als der Riese das sah, wurde es ihm ganz warm um das Herz. "Wie selbstsüchtig bin ich gewesen!", sprach er reumütig zu sich selbst, "jetzt verstehe ich, warum der Frühling nicht in meinen Garten
kommen wollte. Ich werde den kleinen Jungen auf die Spitze des Baumes setzen und danach die Mauer niederreißen. Von nun an soll der Garten auf ewig der Spielplatz der Kinder sein". Er bedauerte
aufrichtig, was er getan hatte.
Der Riese schlich nach unten, öffnete ganz leise die Haustür und trat in den Garten. Aber als die Kinder ihn sahen, hatten sie solche Angst, dass sie alle davonrannten - und augenblicklich wurde es wieder Winter im Garten. Nur der kleine Junge lief nicht fort; denn er hatte, da seine Augen ganz mit Tränen gefüllt waren, den Riesen nicht kommen sehen. Dieser näherte sich dem Jungen ganz vorsichtig von hinten, nahm ihn sanft in seine Hand und setzte ihn in den Baum. Unverzüglich erstrahlte der Baum in üppiger Blütenpracht und die Vögel kamen, setzten sich hinein und sangen; und der kleine Junge streckte seine Arme aus, schlang sie dem Riesen um den Hals und küsste ihn. Und als all die anderen Kinder sahen, dass der Riese nicht länger böse war, kamen sie eilig zurück - und mit ihnen kam der Frühling. "Von nun an, Kinder, ist dies euer Garten", sagte der Riese, nahm eine riesige Axt und riss die Mauer nieder. Und als die Menschen um die Mittagszeit zum Markt gingen, sahen sie den Riesen mit den Kindern im Garten spielen, dem schönsten Garten, den sie jemals gesehen hatten.
Sie spielten den ganzen Tag lang, und am Abend gingen sie auf den Riesen zu, um sich von ihm zu verabschieden.
"Aber wo ist denn euer kleiner Spielgefährte, der Junge, den ich auf den Baum gesetzt habe?", fragte der Riese. Den kleinen Jungen liebte er nämlich am meisten, weil dieser ihn geküsst
hatte.
"Das wissen wir nicht", antworteten die Kinder, "er ist fort gegangen".
"Ihr müsst ihm sagen, dass er morgen unbedingt wiederkommen soll", sagte der Riese. Aber die Kinder entgegneten, dass sie nicht wüssten, wo er wohne, und dass sie ihn auch niemals zuvor gesehen
hätten. Daraufhin wurde der Riese sehr traurig.
Jeden Nachmittag, wenn die Schule zu Ende war, kamen die Kinder und spielten mit dem Riesen. Aber den kleinen Jungen, den der Riese besonders liebte, sah man nie mehr. Der Riese war sehr
freundlich zu all den Kindern, und dennoch blieb in ihm die Sehnsucht nach seinem ersten kleinen Freund; immer wieder sprach er von dem Jungen. "Wie gerne würde ich ihn wieder sehen", pflegte der
Riese dann zu sagen.
Jahre vergingen und der Riese wurde ganz alt und schwach. Er konnte nicht mehr im Garten spielen, und so saß er in einem riesigen Lehnstuhl, sah den Kindern beim Spielen zu und erfreute sich an
seinem Garten. "Ich habe zwar viele herrliche Blumen, aber die Kinder sind die schönsten von allen", sagte er zu sich selbst.
An einem Wintermorgen schaute er, während er sich anzog, aus dem Fenster. Jetzt hasste er den Winter nicht mehr, denn er wusste, dass dies nur die Zeit des schlafenden Frühlings und der sich
ausruhenden Blumen war. Plötzlich rieb er sich verwundert die Augen - und schaute und schaute. Es war in der Tat ein wundervoller Anblick. In der entlegensten Ecke des Gartens war ein Baum über
und über mit herrlichen weißen Blüten bedeckt. Seine Zweige waren vergoldet und silberne Früchte hingen von ihnen herab. Und unter dem Baum stand der kleine Junge, den der Riese so sehr in sein
Herz geschlossen hatte.
Hocherfreut rannte der Riese nach unten und hinaus in den Garten. Er hastete über die Wiese und näherte sich dem Kind. Und als er ganz nah herangekommen war, wurde sein Gesicht rot vor Zorn, und
er fragte: "Wer hat es gewagt, dich zu verletzen?" Auf den Handflächen des Kindes waren nämlich die Male von zwei Nägeln zu erkennen, und die Male von zwei Nägeln waren auch an seinen kleinen
Füßen.
"Wer hat es gewagt, dich zu verletzen?", schrie der Riese noch einmal, "sag es mir, damit ich mein mächtiges Schwert ziehen und ihn erschlagen kann". "Nein!", antwortete das Kind, "denn dies sind
die Wunden der Liebe". "Wer bist du?", fragte der Riese; eine seltsame Ehrfurcht überkam ihn und er kniete vor dem kleinen Jungen nieder.
Daraufhin lächelte das Kind den Riesen an und sagte zu ihm. "Du hast mich einst in deinem Garten spielen lassen, heute sollst du mit mir in meinen Garten kommen - in das Paradies eingehen".
Und als die Kinder an diesem Nachmittag in den Garten gelaufen kamen, fanden sie den Riesen tot auf - er lag unter dem Baum und war über und über mit weißen Blüten bedeckt.
Quelle: (Oskar Wilde)
Die Nachtigall und die Rose
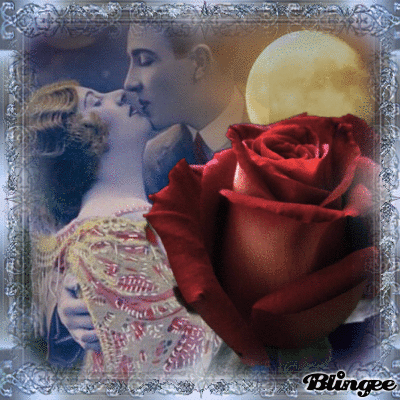
"Sie sagte, sie würde mit mir tanzen, wenn ich ihr rote Rosen brächte", rief der junge Student, "aber in meinem ganzen Garten ist keine rote Rose." In ihrem Nest auf dem Eichbaum hörte ihn die
Nachtigall, guckte durch das Laub und wunderte sich.
"Keine rote Rose in meinem ganzen Garten!" rief er, und seine schönen Augen waren voll Tränen. "Ach, an was für kleinen Dingen das Glück hängt. Alles habe ich gelesen, was weise Männer
geschrieben haben, alle Geheimnisse der Philosophie sind mein, und wegen einer roten Rose ist mein Leben unglücklich und elend."
"Das ist endlich einmal ein treuer Liebhaber", sagte die Nachtigall. "Nacht für Nacht habe ich von ihm gesungen, obgleich ich ihn nicht kannte. Nacht für Nacht habe ich seine Geschichte den
Sternen erzählt, und nun sehe ich ihn. Sein Haar ist dunkel wie die Hyazinthe, und sein Mund ist rot wie die Rose seiner Sehnsucht. Aber Leidenschaft hat sein Gesicht bleich wie Elfenbein
gemacht, und der Kummer hat ihm sein Siegel auf die Stirn gedrückt."
"Der Prinz gibt morgen Nacht einen Ball", sprach der junge Student leise, "und meine Geliebte wird da sein. Wenn ich ihr eine rote Rose bringe, wird sie mit mir tanzen bis zum Morgen. Wenn ich
ihr eine rote Rose bringe, wird sie ihren Kopf an meine Schulter lehnen, und ihre Hand wird in der meinen liegen. Aber in meinem Garten ist keine rote Rose, so werde ich einsam sitzen, und sie
wird an mir vorübergehen. Sie wird meiner nicht achten, und mir wird das Herz brechen."
"Das ist wirklich der treue Liebhaber", sagte die Nachtigall. "Was ich singe, um das leidet er. Was mir Freude ist, das ist ihm Schmerz. Wahrhaftig, die Liebe ist etwas Wundervolles! Kostbarer
ist sie als Smaragde und teurer als feine Opale. Perlen und Granaten können sie nicht kaufen, und auf den Märkten wird sie nicht feilgeboten. Sie kann von den Kaufleuten nicht gehandelt werden
und kann nicht für Gold aufgewogen werden auf der Waage."
"Die Musikanten werden auf ihrer Galerie sitzen", sagte der junge Student, "und auf ihren Instrumenten spielen, und meine Geliebte wird zum Klang der Harfe und der Geige tanzen. So leicht wird
sie tanzen, dass ihre Füße den Boden kaum berühren, und die Höflinge in ihren prächtigen Gewändern werden sich um sie scharen. Aber mit mir wird sie nicht tanzen, denn ich habe keine rote Rose
für sie". Und er warf sich ins Gras, barg sein Gesicht in den Händen und weinte.
"Weshalb weint er?" fragte eine grüne Eidechse, während sie mit dem Schwänzchen in der Luft an ihm vorbeilief. "Ja warum?" fragte ein Schmetterling, der einem Sonnenstrahl nachjagte. "Er weint um
eine rote Rose", sagte die Nachtigall. "Um eine rote Rose?" riefen alle, "wie lächerlich!". Und die kleine Eidechse, die so etwas wie ein Zyniker war, lachte überlaut.
Aber die Nachtigall wusste um des Studenten Kummer und saß schweigend in der Eiche und sann über das Geheimnis der Liebe. Plötzlich breitete sie ihre braunen Flügel aus und flog auf. Wie ein
Schatten huschte sie durch das Gehölz, und wie ein Schatten flog sie über den Garten.
Da stand mitten auf dem Rasen ein wundervoller Rosenstock, und als sie ihn sah, flog sie auf ihn zu und setzte sich auf einen Zweig. "Gib mir eine rote Rose", rief sie, "und ich will dir dafür
mein süßestes Lied singen." Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf. "Meine Rosen sind weiß", antwortete er, "so weiß wie der Meerschaum und weißer als der Schnee auf den Bergen. Aber geh zu
meinem Bruder, der sich um die alte Sonnenuhr rankt, der gibt dir vielleicht, was du verlangst."
So flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch bei der alten Sonnenuhr. "Gib mir eine rote Rose", rief sie, "und ich will dir dafür mein süßestes Lied singen." Aber der Strauch schüttelte
seinen Kopf. "Meine Rosen sind gelb", antwortete er, "so gelb wie das Haar der Seejungfrau, die auf einem Bernsteinthron sitzt, und gelber als die gelbe Narzisse, die auf der Wiese blüht, ehe der
Schnitter mit seiner Sense kommt. Aber geh zu meinem Bruder, der unter des Studenten Fenster blüht, und vielleicht gibt der dir, was du verlangst."
So flog die Nachtigall zum Rosenstrauch unter des Studenten Fenster. "Gib mir eine rote Rose", rief sie, "und ich will dir dafür mein süßestes Lied singen." Aber der Rosenstrauch schüttelte den
Kopf. "Meine Rosen sind rot", antwortete er, "so rot wie die Füße der Taube und röter als die Korallenfächer, die in der Meergrotte fächeln. Aber der Winter ließ meine Adern erstarren, der Frost
hat meine Knospen zerbissen und der Sturm meine Zweige gebrochen, und so habe ich keine Rosen dies ganze Jahr."
"Nur eine einzige rote Rose brauche ich", rief die Nachtigall, "nur eine rote Rose! Gibt es denn nichts, dass ich eine rote Rose bekomme?" "Ein Mittel gibt es", antwortete der Baum, "aber es ist
so schrecklich, dass ich mir es dir nicht zu sagen traue." "Sag es mir", sprach die Nachtigall ohne zu zögern, "ich fürchte mich nicht."
"Wenn du eine rote Rose haben willst", sagte der Baum, "dann musst du sie beim Mondlicht aus Liedern machen und sie färben mit deinem eigenen Herzblut. Du musst für mich singen und deine Brust an
einen Dorn pressen. Die ganze Nacht musst du singen, und der Dorn muss dein Herz durchbohren, und dein Lebensblut muss in meine Adern fließen und mein werden."
"Der Tod ist ein hoher Preis für eine rote Rose", sagte die Nachtigall, "und das Leben ist allen sehr teuer. Es ist lustig, im grünen Wald zu sitzen und die Sonne in ihrem goldenen Wagen zu sehen
und den Mond in seinem Perlenwagen. Süß ist der Duft des Weißdorns, und süß sind die Glockenblumen im Tal und das Heidekraut auf den Hügeln. Aber die Liebe ist besser als das Leben, und was ist
ein Vogelherz gegen ein Menschenherz?"
So breitete sie ihre braunen Flügel und flog auf. Wie ein Schatten schwebte sie über den Garten, und wie ein Schatten huschte sie durch das Gehölz. Da lag noch der junge Student im Gras, wie sie
ihn verlassen hatte, und die Tränen in seinen schönen Augen waren noch nicht getrocknet.
"Freu dich", rief die Nachtigall, "freu dich. Du sollst deine rote Rose haben. Ich will sie beim Mondlicht bilden aus Liedern und färben mit meinem eigenen Herzblut. Alles, was ich von dir dafür
verlange, ist, dass du deiner Liebe treu bleiben sollst. Denn die Liebe ist weiser als die Philosophie, wenn die auch weise ist, und mächtiger als die Gewalt, wenn die auch mächtig ist.
Flammfarben sind ihre Flügel, und flammfarben ist ihr Leib. Ihre Lippen sind süß wie Honig, und ihr Atem ist Weihrauch."
Der Student blickte aus dem Gras auf und horchte. Aber er konnte nicht verstehen, was die Nachtigall zu ihm sprach, denn er verstand nur die Bücher. Aber die Eiche verstand und wurde traurig,
denn sie liebte die kleine Nachtigall sehr, die ihr Nest in ihren Zweigen gebaut hatte. "Sing mir noch ein letztes Lied", flüsterte sie, "ich werd mich sehr einsam fühlen, wenn du fort bist." Und
die Nachtigall sang für die Eiche, und ihre Stimme war wie Wasser, das aus einem silbernen Krug springt.
Als sie ihr Lied beendet hatte, stand der Student auf und nahm ein Notizbuch und eine Bleistift aus der Tasche. Sinnend schaute er vor sich hin. "Sie hat Form", sagte er zu sich, als er aus dem
Gehölz schritt, "Sie hat ein Formtalent, das kann ihr nicht abgesprochen werden. Aber ob sie auch Gefühl hat? Ich fürchte, nein. Sie wird wohl sein wie die meisten Künstler: alles nur Stil und
keine echte Innerlichkeit. Sie würde sich kaum für andere opfern. Sie denkt vor allem an die Musik, und man weiß ja, wie egoistisch die Künste sind. Aber zugeben muss man, sie hat einige schöne
Töne in ihrer Stimme. Schade, dass sie gar keinen Sinn haben, nichts ausdrücken und ohne praktischen Wert sind."
Und er ging auf sein Zimmer und legte sich auf sein schmales Feldbett und fing an, an seine Liebe zu denken. Bald war er eingeschlafen. Und als der Mond in den Himmel schien, flog die Nachtigall
zu dem Rosenstrauch und presste ihre Brust gegen den Dorn. Die ganze Nacht sang sie, die Brust gegen den Dorn gepresst, und der kalte kristallene Mond neigte sich herab und lauschte. Die ganze
Nacht sang sie, und der Dorn drang tiefer und tiefer in ihre Brust, und ihr Lebensblut sickerte weg.
Zuerst sang sie von dem Werden der Liebe in dem Herzen eines Knaben und eines Mädchens. Und an der Spitze des Rosenstrauchs erblühte eine herrliche Rose, Blatt reihte sich an Blatt, wie Lied auf
Lied. Erst war sie bleich wie der Nebel, der über dem Fluss hängt, bleich wie die Füße des Morgens und silbern wie die Flügel des Dämmers. Wie das Schattenbild einer Rose in einem Silberspiegel,
wie das Schattenbild einer Rose im Teich, so war die Rose, die aufblühte an der Spitze des Rosenstocks.
Der aber rief der Nachtigall zu, dass sie sich fester noch gegen den Dorn presse. "Drück fester, kleine Nachtigall", rief er, "sonst bricht der Tag an, bevor die Rose vollendet ist." Und so
drückte die Nachtigall sich fester gegen den Dorn, und lauter und lauter wurde ihr Lied, denn sie sang nun von dem Erwachen der Leidenschaft in der Seele von Mann und Weib. Und ein zartes Rot kam
auf die Blätter der Rose, wie das Erröten auf das Antlitz des Bräutigams, wenn er die Lippen seiner Braut küsst.
Aber der Dorn hatte ihr Herz noch nicht getroffen, und so blieb das Herz der Rose weiß, denn bloß einer Nachtigall Herzblut kann das Herz einer Rose färben. Und der Baum rief der Nachtigall zu,
dass sie sich fester noch gegen den Dorn drücke. "Drück fester, kleine Nachtigall", rief er, "sonst ist es Tag, bevor die Rose vollendet ist." Und so drückte die Nachtigall sich fester gegen den
Dorn, und der Dorn berührte ihr Herz, und ein heftiger Schmerz durchzuckte sie. Bitter, bitter war der Schmerz, und wilder, wilder wurde das Lied, denn sie sang nun von der Liebe, die der Tod
verklärt, von der Liebe, die auch im Grab nicht stirbt. Und die wundervolle Rose färbte sich rot wie die Rose des östlichen Himmels. Rot war der Gürtel ihrer Blätter, und rot wie ein Rubin war
ihr Herz. Aber die Stimme der Nachtigall wurde schwächer, und ihre kleinen Flügel begannen zu flattern, und ein leichter Schleier kam über ihre Augen. Schwächer und schwächer wurde ihr Lied, und
sie fühlte etwas in der Kehle.
Dann schluchzte sie noch einmal auf in letzten Tönen. Der weiße Mond hörte es, und er vergaß unterzugehen und verweilte am Himmel. Die rote Rose hörte es und zitterte ganz vor Wonne und öffnete
ihre Blätter dem kühlen Morgenwind. Das Echo trug es in seine Purpur- höhle in den Bergen und weckte Schläfer aus ihren Träumen. Es schwebte über das Schilf am Fluss, und der trug die Botschaft
dem Meere zu. "Sieh, sieh!" rief der Rosenstrauch, "nun ist die Rose fertig". Aber die Nachtigall gab keine Antwort, denn sie lag tot im hohen Gras, mit dem Dorn im Herzen.
Um Mittag öffnete der Student sein Fenster und blickte hinaus. "Was für ein Wunder und Glück!" rief er, "da ist eine rote Rose! Nie in meinem Leben habe ich eine solche Rose gesehen. Sie ist so
schön, ich bin sicher, sie hat einen langen lateinischen Namen". Und er lehnte sich hinaus und pflückte sie. Dann setzte er seinen Hut auf und lief ins Haus seines Professors, mit der Rose in der
Hand.
Die Tochter des Professors saß in der Einfahrt und wand blaue Seide auf eine Spule, und ihr Hündchen lag ihr zu Füßen. "Ihr sagtet, Ihr würdet mit mir tanzen, wenn ich Euch eine rote Rose
brächte", sagte der Student. "Hier ist die röteste Rose der Welt. Tragt sie heut Abend an Eurem Herzen, und wenn wir zusammen tanzen, wird sie Euch erzählen, wie ich Euch liebe."
Aber das Mädchen verzog den Mund. "Ich fürchte, sie passt nicht zu meinem Kleid", sprach sie, "und dann hat mir auch der Neffe des Kammerherrn echte Juwelen geschickt, und das weiß doch jeder,
dass Juwelen mehr wert sind als Blumen."
"Wahrhaftig, Ihr seid sehr undankbar", rief der Student gereizt. Und er warf die Rose auf die Straße, wo sie in die Gosse fiel, und ein Wagenrad fuhr darüber. "Undankbar?" sagte das Mädchen, "ich
will Euch was sagen: Ihr seid sehr ungezogen - und dann: wer seid Ihr eigentlich? Ein Student, nichts weiter. Ich glaube, Ihr habt nicht einmal Silberschnallen an den Schuhen, wie des Kammerherrn
Neffe." Und sie stand auf und ging ins Haus.
"Wie dumm ist doch die Liebe", sagte sich der Student, als er fort ging, "sie ist nicht halb so nützlich wie die Logik, denn sie beweist gar nichts und spricht einem immer von Dingen, die nicht
geschehen werden, und lässt einen Dinge glauben, die nicht wahr sind. Sie ist wirklich etwas ganz Unpraktisches, und da in unserer Zeit das Praktische alles ist, so gehe ich wieder zur
Philosophie und studiere Metaphysik." So ging er wieder auf sein Zimmer und holte ein großes, staubiges Buch hervor und begann zu lesen.
Quelle: (Oskar Wilde)
Orange und Zitrone
Da waren einmal ein Vater und eine Mutter, und die hatten zwei Töchter, Orange und Zitrone. Die Mutter hatte Zitrone lieber und der Vater Orange. Sobald der Vater den Rücken wandte, ließ die Mutter gewöhnlich Orange alle schmutzige Arbeit tun.
Eines Tages schickte sie sie fort, um die Milch zu holen, und sagte: "Wenn du den Krug zerbrichst, werde ich dich töten." Als Orange zurückkehrte, fiel sie hin und zerbrach den Krug. Und als sie nach Hause kam, verbarg sie sich daher im Hausgang. Die Mutter kam heraus, sie sah den zerbrochenen Krug und das Mädchen und holte sie in das Haus.
Da schrie das Mädchen: "O Mutter, o Mutter! Töte mich nicht!" Die Mutter sagte: "Schließe die Fensterläden." - "O Mutter, o Mutter! Töte mich nicht!" - "Zünde die Kerze an." - "O Mutter, o
Mutter! Töte mich nicht!" - "Setze den Kessel auf." - "O Mutter, o Mutter! Töte mich nicht!" - "Hol den Block, auf dem wir das Holz hacken." - "O Mutter, o Mutter! Töte mich nicht!" - "Bring die
Axt." - "O Mutter, o Mutter! Töte mich nicht!" - "Leg den Kopf auf den Block." - "O Mutter, o Mutter! Töte mich nicht!"
Aber die Mutter hackte ihr den Kopf ab und kochte ihn zum Mittagessen.
Als der Vater nach Hause kam, fragte er, was es zum Essen gäbe. "Schafskopf", antwortete die Mutter. "Wo ist Orange?" - "Noch nicht von der Schule gekommen." - "Ich glaube dir nicht", sagte der Vater. Dann ging er die Treppe hinauf und fand Finger in einem Kasten. Das überwältigte ihn so, dass er die Besinnung verlor.
Der Geist von Orange flog fort zum Laden eines Goldschmieds und sagte:
"Meine Mutter schlug mir's Haupt ab,
mein Vater nagt mein Gebein,
meine kleine Schwester mich begrub
unterm kalten Marmelstein.
Sie sagten: "Wenn du das noch einmal sagst, geben wir dir eine goldene Uhr." Da sagte sie es noch einmal, und sie gaben ihr eine goldene Uhr.
Dann ging sie fort zum Laden eines Schusters und sagte:
"Meine Mutter schlug mir's Haupt ab,
mein Vater nagt mein Gebein,
meine kleine Schwester mich begrub
unterm kalten Marmelstein."
Und sie sagten: "Wenn du das noch einmal sagst, geben wir dir ein Paar Schuhe." Da sagte sie es noch einmal, und sie gaben ihr ein Paar Schuhe.
Dann ging sie zum Steinmetz und sagte:
"Meine Mutter schlug mir's Haupt ab,
mein Vater nagt mein Gebein,
meine kleine Schwester mich begrub
unterm kalten Marmelstein."
Und sie sagten: "Wenn du es noch einmal sagst, geben wir dir ein Stück Marmor, so groß wie dein Kopf." Da sagte sie es noch einmal, und sie gaben ihr ein Marmorstück so groß wie ihr Kopf.
Sie nahm all diese Dinge und flog nach Hause und setzte sich oben auf den Kamin und rief hinunter:
"Vater, Vater, komm zu mir,
und ich zeig dir, was ich schenke dir!" Da kam er, und sie gab ihm die goldene Uhr.
Dann rief sie hinunter:
"Schwester, Schwester! Komm zu mir,
und ich zeig dir, was ich schenke dir!" Da kam sie heraus, und sie gab ihr die Schuhe.
Dann rief sie hinunter:
"Mutter, Mutter! Komm zu mir,
und ich zeig dir, was ich schenke dir!" Die Mutter dachte, die andern haben so hübsche Dinge bekommen, und steckte ihren Kopf gleich in den Kamin und schaute hinauf. Da fiel der große
Marmorbrocken herunter und tötete sie.
Dann kam Orange herunter und lebte mit ihrem Vater und Zitrone glücklich allezeit.
Quelle: (Märchen aus England)
Goldlöckchen und die drei Bären

Es war einmal ein sehr ungezogenes kleines Mädchen, das Goldlöckchen hieß. Eines Tages rief die Mutter nach Goldlöckchen, weil sie wollte, dass das Kind ihr in der Küche helfen sollte. Goldlöckchen aber tat so, als hörte sie nichts, und ging heimlich in den Wald, um einen Spaziergang zu machen. Das tat sie öfter, wenn sie nicht gehorchen wollte.
An diesem Tag nahm sie einen neuen Weg, und bald schon kam sie zu einer gemütlichen kleinen Hütte. Die Tür stand einen Spalt offen, und weil sie neugierig war, trat sie einfach ein. Innen war die Hütte so nett und einladend wie außen. Goldlöckchen ging in die Küche und war sehr erfreut, als sie auf dem Tisch drei Schüsselchen mit Brei entdeckte, denn sie war hungrig nach dem Spaziergang.
Zuerst kostete sie aus der größten Schüssel. "Uh", sagte sie, "das ist viel zu heiß!", und spuckte den Brei einfach wieder aus. Dann versuchte sie es mit der mittelgroßen Schüssel. "Uh", schrie sie, "das ist viel zu kalt". Du kannst dir bestimmt vorstellen, was sie dann tat. Schließlich kostete Goldlöckchen aus der kleinsten Schüssel. Da sagte sie nichts mehr, denn sie war zu beschäftigt damit, alles aufzuessen. Der Brei war nämlich genau richtig.
Als sie fertig war, wollte sie sich ein bisschen hinsetzen. Im Wohnzimmer waren drei Stühle. Zuerst setzte sie sich auf den größten, stand aber gleich wieder auf. "Dieser Stuhl ist viel zu hart!", meckerte sie laut. Dann setzte sie sich auf den mittelgroßen Stuhl, doch auch der passte ihr nicht: "Dieser Stuhl ist viel zu weich!", beklagte sie sich. Schließlich setzte sich das Mädchen auf den kleinsten Stuhl, und darauf fühlte sie sich rundum wohl.
Doch dann knackste es und krachte es, und mit einem kräftigen Plumps landete Goldlöckchen unsanft auf dem Boden. Sie war viel zu schwer für den kleinen Stuhl, deshalb war er einfach zusammengebrochen. "Jetzt muss ich mich aber ausruhen", murmelte Goldlöckchen und stieg die Treppe hoch ins Schlafzimmer. Dort standen drei Betten mit einladendem Bettzeug.
Zuerst stieg Goldlöckchen ins größte Bett und sprang auf der Matratze auf und ab. "Dieses Bett taugt nichts!", rief sie. "Es ist zu hart zum Springen und zu hart zum Schlafen." Das mittlere Bett gefiel ihr ebenfalls nicht, denn es war zu weich. Schließlich versuchte Goldlöckchen es mit dem kleinsten Bett, und es war einfach perfekt. Bevor sie über etwas meckern konnte, war sie schon tief eingeschlafen.
Die drei Bären aber, denen die gemütliche Hütte gehörte, hatten sie nur kurz verlassen, um vor dem Frühstück einen kleinen Spaziergang zu machen. Als sie heimkehrten, gingen sie zuerst in die Küche und sahen gleich, dass hier etwas nicht stimmte. "Wer hat meinen Brei gegessen?", brummte Vater Bär mit tiefer Stimme. "Wer hat meinen Brei gegessen?", fragte Mutter Bär ärgerlich. "Und wer hat meinen Brei gegessen?", quiekte Baby Bär mit seinem hohen Stimmchen. "Es ist nichts mehr da!"
Verärgert gingen die drei Bären ins Wohnzimmer. "Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen!", brummte Vater Bär bedrohlich. "Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen!", bemerkte Mutter Bär. "Auf meinem Stuhl hat jemand gesessen und hat ihn gleich ganz kaputt gemacht"', weinte Baby Bär.
"Kommt mit!", befahl Vater Bär entschlossen und schlich auf Zehenspitzen die Treppe hinauf. "Wie ich es mir gedacht habe", sagte er, "jemand ist auf meinem Bett herumgesprungen!" "Auf meinem Bett auch", sagte Mutter Bär. "In meinem Bett hat jemand geschlafen!", quiekte Baby Bär, "und schaut mal, er ist immer noch drin!"
In diesem Augenblick wachte Goldlöckchen auf.
Sie sah, dass drei sehr ärgerliche Bärengesichter auf sie herabblickten, und sprang aus dem Bett. Schwuppdiwupp war sie die Treppe hinunter, zu Tür hinaus und in den Wald gerannt, noch bevor jemand "Wer ist denn das?" fragen konnte.
Natürlich wagte sich Goldlöckchen nie wieder in die Nähe der Bärenhütte. Einige Leute sagen, dass sie danach ein braves kleines Mädchen geworden sei, aber ich bin da nicht so sicher. Du vielleicht?
Quelle: (Märchen aus England)
Dermot mit dem Liebesfleck
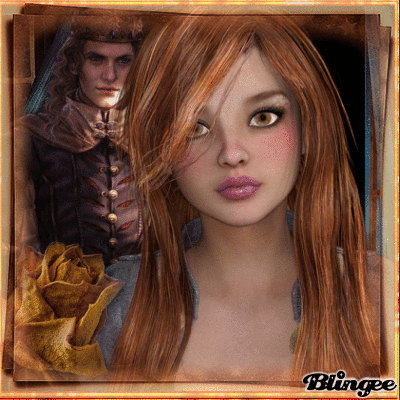
Da waren einst vier Gefährten: Dermot O'Dyna, Conan, Osgar und Goll. Sie waren stark und klug und kampferprobt, und alle vier gehörten zur Fianna, zu den Männern des großen Fin McCool.
Einmal waren die vier auf der Jagd. Sie jagten, bis es dunkel wurde, dann fing es auch noch zu regnen an. Nun mochten sie nicht die ganze Nacht trübsinnig unter triefenden Bäumen hocken, also
sahen sie sich um, ob nicht in der Nähe ein Strohdach auf sie wartete.
So kamen sie in ein schmales Tal, das keiner von ihnen je betreten hatte, dort sahen sie Rauch aufsteigen aus dem Schornstein einer einsamen Hütte. Dermot stieß den Ruf der Freundschaft aus, um den Bewohnern der Hütte zu zeigen, dass sie nicht in böser Absicht kämen. Da trat ein alter Mann aus der Hütte, er begrüßte die Männer freundlich und hieß sie willkommen für die Nacht. So traten sie über die Schwelle ans hell lodernde Feuer.
Der Alte wohnte nicht allein in der Hütte. Bei ihm war ein junges Mädchen, kupferrot war ihr Haar, rund und schön waren ihre Brüste, und auf ihren Lippen lag ein Lächeln, zärtlich und lockend, das ließ die Männer die Augenbrauen heben. Und ein mächtiger Hammel lag ruhig und schwer in einer Ecke und glotzte die Gäste aus großen dummen Augen an. Und eine schwarze Katze lag zufrieden schnurrend an der Feuerstelle.
Das Mädchen hängte nun einen großen Kessel übers Feuer, stellte vier hölzerne Schalen auf den weißgescheuerten Tisch in der Mitte des Raumes und legte vier Löffel dazu. Die Männer setzten sich um den Tisch, das Mädchen brachte den Topf mit der würzigen dampfenden Bohnensuppe. «Greift zu», sagte sie, dann ging sie mit dem Alten in den Nebenraum, um dort das Nachtlager zu richten. Doch gerade wie die Männer Suppe schöpfen wollten, sprang der Hammel mit einem Satz mitten auf den Tisch, aber so geschickt, dass er weder Topf noch Teller umstieß, und sein scharfer Geruch war stärker als der Duft der Suppe.
Ärgerlich wollten die Gefährten den Hammel vom Tisch herunterstoßen, doch der wehrte sich, stieß um sich und schlug so kräftig aus, dass die Männer taumelten und zu Boden fielen. Endlich glückte es Goll, das Tier vom Tisch zu werfen, aber das sollte den Gefährten schlecht bekommen. Denn bis jetzt hatte der Hammel nur mit ihnen gespielt. Nun aber wurde er böse und teilte so harte Stöße aus, dass die vier stolzen Fianna-Helden im Handumdrehen auf dem Rücken lagen.
Und dann stellte der Hammel dem Goll auch noch die Vorderbeine auf die Brust. Da kam der Alte aus dem Nebenraum. «O weh,» sagte er, «wie ich sehe, ist es euch schlecht ergangen. Katze, warum hast du das zugelassen? Komm, binde den dummen Hammel fest, dass er kein Unheil mehr anrichten kann.» Da sprang die Katze, die wie schlafend am Kamin gelegen hatte, mit einem Satz dem Hammel ins Genick, krallte sich fest in sein Ohr und lenkte ihn in seinen Winkel zurück, dort band sie einen Strick um seine Hörner, so dass er sich nicht mehr rühren konnte.
Die Männer erhoben sich stöhnend, ächzend und fluchend. «Wir können nicht länger bei Euch bleiben,» sagte Dermot. «Noch nie sind wir so erniedrigt worden - und das vor den Augen eines schönen Mädchens. Habt Dank für eure Gastfreundschaft. Doch Euer Haus muss verhext sein. Und wir sind wohl nicht Manns genug, diesen Zauber zu brechen. Lieber schlafen wir draußen in Nacht und Nässe, als dass wir uns noch einmal so demütigen lassen!»
Der Alte hob die Hand und lachte leise: «Ihr braucht euch nicht zu schämen, Männer. Kein gewöhnlicher Hammel hat euch zu Boden geworfen, und auch die Katze, die ihn zähmte, was euch nicht gelang, ist kein gewöhnliches Tier. Bleibt also, das wird eurem Ruf nicht schaden.» «Ja, bleibt», sagte auch das Mädchen, und sie blickte Dermot mit ihren Sternenaugen an. Dermot senkte den Kopf. Der Macht dieser Augen war so schwer zu widerstehen wie dem Hammel.
Doch Goll blieb zornig: «Nein, nein, mit ein paar guten Worten und einem schönen Blick ist unsere Schande nicht getilgt. Wir müssen wissen, wer das ist, vor dem unsere Kraft so erbärmlich versagt hat!» «Nun, lieber hätte ich es euch verschwiegen », sagte der Alte, «aber wenn ihr so schwer gekränkt seid. Nur hoffe ich, dass euch die Wahrheit nicht noch mehr erschreckt.
Der Hammel, dem selbst vier Fianna-Helden nicht widerstehen können - das ist die Welt. Ihr unterlegen zu sein, dafür muss sich niemand schämen. Die Katze freilich ist noch stärker als die ganze Welt; die Katze nämlich ist - der Tod.» «Der Tod!?» rief Dermot, «schnell, Männer, lasst uns gehn!» «Fürchtet euch nicht», sagte der Alte, «nirgends seid ihr sicherer vor dem Tod als in meinem Haus. Solange ihr unter diesem Dach seid, schläft der Tod. Also kommt, es ist spät, ich zeige euch euer Lager.
Es gibt nur drei Räume unter diesem Dach. Dort hinten stehen die Schafe. Hier, am großen Feuer, schlafe ich, der Herr des Hauses. Wir haben euch im dritten Raum ein Strohlager bereitet, da, wo auch das Bett meiner Tochter steht. Vier stolzen Fianna-Helden kann ich gewiss die Ehre eines jungen Mädchens anvertrauen. Kommt jetzt, ihr werdet müde sein.»
Da legten sich die vier Gefährten ins Stroh, doch keiner von ihnen schlief ein. Was wären das auch für Männer gewesen, wenn sie die Nähe eines schönen Mädchens nicht wachgehalten hätte. Als dann das Mädchen ins nachtschwarze Zimmer trat und ihre Kleider ablegte, da ging ein weiches Licht von ihr aus. Die Männer hielten sich ganz still, jeder hoffte, dass die andern bald einschlafen würden.
Goll war der erste, der dem Verlangen nicht mehr widerstehen konnte. Leise schlich er zum Bett des Mädchens und flüsterte in ihr Ohr: «Lass mich zu dir, schöner Glanz. Ich will, dass du mein wirst. Ohne deine Liebe finde ich keinen Schlaf.» Das Mädchen sah ihn an mit ihren weichen lockenden Augen: «Einmal habe ich dir gehört, Goll, doch nie nie wieder wird es geschehn. Leg dich wieder hin.» Zähneknirrschend tappte Goll zurück und grub sich ins Stroh.
Eine Weile war es still, dann versuchte Osgar sein Glück. Doch kaum war er an das Bett des Mädchens gekommen, da hörte er ihre Stimme: «Auch dich kann ich nicht lieben, Osgar. Einmal bin ich deine Liebste gewesen. Aber das ist vorbei und kommt nie wieder.» Nicht lange, dann schlich auch Conan an ihr Bett: «Schönste Feenprinzessin,» flüsterte er, «niemand belauscht uns. Und du bist schön wie eine Wolke, die die Morgensonne rötet. Sei mein, und ich werde dein Lob bis an mein Lebensende singen!»
Aber sie wies auch ihn ab: «Conan, dein Lob brauch' ich nicht. Ich bin wie ich bin, ob du mich lobst oder nicht. Doch nachdem ich dir einmal gehört habe, mag ich dich nicht mehr.» Verwirrt kroch Conan zurück zu seinem sein Lager. Was sonst sollte er auch tun? Liebe lässt sich nicht erzwingen. Dermot war auch noch wach und hatte alles gehört. Wenn sie die andern abgewiesen hat, dachte er, so kann ich mir vielleicht Hoffnung machen.
Er schlich zu ihrem Bett, und was er dort sah, verschlug ihm den Atem: das Mädchen hatte sich aufgerichtet, um ihren Leib war nichts als kupferrotes Haar, im Dunkeln leuchtete ihre helle Haut, und sie streckte ihre Arme nach ihm aus: «Dermot, mein Liebster, mein Schönster. Wie sehr hab' ich auf dich gewartet, wie gern schliefe ich mit dir. Doch auch dir kann ich nicht gehören, niemals kehre ich zu dem zurück, der mich einmal besessen hat. Denn ich bin die Jugend. Aber dich liebe ich, Dermot, und es fällt mir schwer, dich wegzuschicken. Du sollst nicht gehen ohne ein Zeichen meiner Liebe. Komm, neig' dich herab zu mir.»
Dermot gehorchte, da strich das Mädchen ihm zärtlich über die Stirn: «Nun habe ich dich gezeichnet, Liebster. Nun wird dich kein Mädchen, keine Frau mehr ansehen können ohne dich zu lieben. Und jetzt geh, Dermot, und lass mich allein.» Sie beugte sich zurück, ihr Licht erlosch und Dermot tastete sich durch das Dunkel zurück zu seinem Lager.
Doch er fand keinen Schlaf mehr in dieser Nacht. Fortan aber konnte kein Mädchen, keine Frau dem Dermot widerstehen. Wenn er die Mädchen nur ansah, so fielen sie ihm zu so wie das Gras vor der Sichel fällt. Und darum hieß Dermot O'Dyna seit jener Nacht «der mit dem Liebesfleck».
Quelle: (Frederik Hetmann: Irischer Zaubergarten. Märchen, Sagen und Geschichten von der grünen Insel)
Der Robbenfänger und die Meerleute

An der Nordküste von Schottland lebte in einer kleinen Hütte ein Mann, der Fischfang trieb, vor allem aber Robben fing. Deren Felle wurden ihm gut bezahlt. Die Tiere kamen in großer Zahl aus dem Meere und legten sich auf die Felsen bei seinem Hause in die Sonne. So war es nicht schwer, ihnen beizukommen. Einige darunter fielen durch ihre Größe auf, und manche meinten, das seien überhaupt keine Robben, sondern Wassermänner und Meerfrauen, die auf dem Grunde der See wohnten. Aber der Robbenfänger lachte nur darüber und sagte, gerade damit mache man das beste Geschäft: je größer die Tiere, desto größer die Felle und um so höher die Preise.
Eines Tages hatte er beim Jagen ein Missgeschick. Das Tier, nach dem er stieß, entglitt ihm mit lautem Geheul ins Wasser mitsamt dem Jagdmesser, das in ihm steckte. Als er verdrießlich nach Hause ging, kam ein Fremder daher geritten, der noch ein zweites Pferd mit sich führte. Er hielt den Robbenfänger an und sagte, er sei von jemand abgeschickt, der mit ihm einen Handel über eine Anzahl Seehundsfelle schließen wolle, und ob er mit ihm zu dem Auftraggeber gehe: es müsse aber sofort sein. Der Robbenfänger freute sich. Da war ein guter Handel in Aussicht, der konnte den Verlust mehr als wett machen. Er willigte also ein, bestieg das zweite Pferd, und der Fremde ritt mit ihm so geschwind los, dass der Wind, der, wie der Fischer wusste, doch vom Rücken her kam, ihm ins Gesicht zu blasen schien. Mit einemmal hielt der Fremde an, sie standen an einem Felsenhang, der in die See hineinragte und steil abstürzte.
"Hier ist es", sagte der Führer, packte dabei den Fischer mit übernatürlicher Kraft und stürzte sich ohne weiteres mit ihm gerade ins Meer hinein. Der Robbenfänger dachte schon, jetzt sei es aus mit ihm, da merkte er zu seinem Erstaunen, dass sich etwas mit ihm verändert hatte. Mitten im Wasser konnte er ganz leicht atmen, und dabei sanken sie immer tiefer und so schnell, wie sie vorher zu Land durch die Luft gesaust waren. Sie waren - er wusste nicht wie tief - hinab getaucht, da kamen sie auf dem Grunde an ein großes gewölbtes Tor, das schien aus rosenroten Korallen gemacht und war besetzt mit Herzmuscheln. Es öffnete sich von selbst, und sie traten in einen großen Saal, dessen Wände aus Perlmutt waren und dessen Boden aus glattem, festem Seesand bestand.
Der Saal war voll von Gästen, lauter Robben, aber sie sprachen und zeigten an ihrem gebaren, dass sie wie Menschen empfanden. Sie schienen alle sehr traurig zu sein, bewegten sich lautlos durch den Saal, sprachen leise miteinander oder lagen schwermütig auf dem Sandboden und wischten sich mit ihren weichen felligen Flossen große Tränen aus den Augen.
Der Robbenfänger wandte sich zu seinem Begleiter und wollte ihn fragen, was das alles bedeutete - da sah er zu seinem Schrecken, dass der ebenfalls die Gestalt eines Seehundes angenommen hatte.
Noch mehr entsetzte er sich aber, als er nun gewahr wurde, dass auch er selber nicht mehr den Menschen ähnlich, sondern in einen Seehund verwandelt war. Ganz benommen und verzweifelt war er bei
dem Gedanken, dass er nun sein Leben lang in dieser schauderhaften Gestalt bleiben müsse.
Jetzt zeigte ihm sein Führer plötzlich ein langes Messer und fragte ihn: "Hast du das schon einmal gesehen?" Er erkannte sein eigenes, womit er am Morgen den Seehund getroffen hatte. Er erschrak so sehr, dass er auf sein Gesicht fiel und um Gnade bat. Er dachte nicht anders, als dass sie Rache an ihm nehmen und ihm ans Leben gehen wollten. Statt dessen aber umringten sie ihn und rieben ihre weichen Nasen an seinem Fell, um ihm zu zeigen, wie gut sie es mit ihm meinten, und baten ihn gar sehr, er solle nur ruhig sein; es würde ihm nichts geschehen und sie würden ihn ihr ganzes Leben lang lieben, wenn er nur täte, was sie von ihm verlangten. Sein Führer brachte ihn in einen Nebenraum. Da lag ein großer brauner Seehund auf einem Lager von blassrotem Seetang mit einer klaffenden Wunde an der Seite.
"Es war mein Vater", sagte sein Führer, "den Du heute morgen verwundet hast. Ich habe Dich hierher gebracht, damit du ihm die Wunde verbindest. Denn keine andere Hand als die deinige kann ihn
gesund machen."
"Ich verstehe zwar nicht viel von der Heilkunst", sagte der Robbenfänger und war erstaunt über die Nachricht dieser seltsamen Geschöpfe, denen er solches Unrecht getan hatte, "aber ich will ihn
verbinden, so gut ich nur kann. Es tut mir von Herzen leid, dass meine Hand ihm die Wunde schlug."
Er ging zu dem Bett, wusch und besorgte den Kranken, so gut er nur konnte. Kaum war er damit fertig, da schien sich die Wunde schon zu schließen und zu heilen. Nur eine Narbe blieb, und der alte Seehund sprang, so munter wie je. Da verwandelte sich die Trauer in allgemeine Lust und Freude, im ganzen Robbenpalast lachten sie, schwätzten sie, küssten sich in ihrer sonderbaren Weise, scharten sich um den Alten, rieben ihre Nasen gegen seine, als wollten sie ihm zeigen, wie glücklich sie über seine schnelle Heilung wären.
Der Robbenfänger stand die ganze Zeit in einer Ecke, bedrängt von finsteren Gedanken. Er sah wohl, sie wollten ihn nicht töten - aber sollte er nun sein ganzes übriges Leben lang als Seehund hier klaftertief unter dem Meere bleiben? Da nahte sich zu seiner großen Freude wieder sein Führer und sagte: "Nun steht es dir frei, zu Weib und Kindern heimzukehren. Ich will dich zu ihnen bringen, aber nur unter einer Bedingung." - "Und welche wäre das?" fragte der Robbenfänger begierig und war ganz außer sich vor Freude bei dem Gedanken, unversehrt wieder in die Oberwelt und zu seiner Familie zurückkehren zu dürfen. "Dass du einen feierlichen Eid schwören willst, nie wieder einen Seehund zu verwunden."
Das wollte er gern tun. Wenn er damit auch den Robbenfang, seinen bisherigen Lebensberuf, aufgeben musste, so wusste er doch, nur so würde er seine richtige Gestalt wiedergewinnen können. Schließlich konnte er sich ja dann später auf irgendeine andere Art sein Brot verdienen. So legte er den geforderten Eid mit aller Feierlichkeit ab, hielt seine Flosse hoch zum Schwur, und alle die anderen Robben stellten sich neben ihn als Zeugen. Ein Seufzer der Erleichterung ging durch die Säle, als die Worte gesprochen waren: denn er war der tüchtigste Robbenfänger im Norden gewesen.
Dann sagte er der seltsamen Gesellschaft Lebewohl. Mit seinem Führer zog er wieder durch das äußere Korallentor und hoch durch das schattenhafte grüne Wasser, bis es anfing immer lichter zu werden und sie zuletzt auftauchten im Sonnenschein der Erde. Mit einem Sprung waren sie oben auf der Klippe, wo die beiden schwarzen Rosse schon auf sie warteten und ruhig das grüne Gras abknabberten.Als sie das Wasser verließen, fiel ihre seltsame Verkleidung von ihnen ab, und sie waren gerade so wie vorher, ehe sie ins Wasser hinabgetaucht waren: ein einfacher Robbenfänger und ein hochgewachsener gutgekleideter Mann im Reitanzug. Dann geschah alles wie vorher, die Pferde sausten dahin, und es dauerte nicht lange, da stand der Robbenfänger wieder wohlbehalten vor seinem Haus.
Wie er dem Fremden die Hand hinhielt, um Lebewohl zu sagen, zog der einen großen Beutel Goldes heraus und reichte ihn hin: "Du hast deine Pflicht bei dem Handel erfüllt - wir müssen es ebenso machen", sagte er. "Man soll nie sagen dürfen, wir hätten eines ehrlichen Mannes Arbeit beansprucht, ohne uns erkenntlich zu zeigen." Damit verschwand er. Als der Robbenfänger in seiner Hütte den Beutel auf dem Tisch ausleerte, war es so viel, dass er nicht bedauern brauchte, seinem Handwerk entsagt zu haben.
Quelle: (Schottisches Märchen)
Binnorie
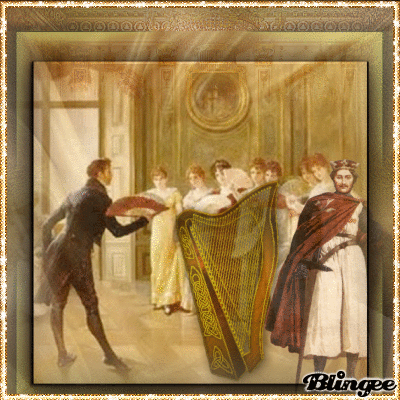
Es war einmal..., da lebten in einem Schloß nahe der prächtigen Mühlendämme von Binnorie zwei Königstöchter. Die ältere Schwester wurde schon längere Zeit von Ritter William umworben. Er gewann ihre Liebe und schwörte ihr ewige Treue, aber, wie das so ist, bald interessierte er sich auch für die Jüngere der Schwestern, die hatte goldenes Haar und Wangen, so rot wie Kirschen. Und schon besuchte er nur noch die jüngere Prinzessin, die ältere hatte er bald vergessen. Das machte die ältere sehr zornig und der Hass und die Eifersucht auf ihre Schwester wuchs und wuchs und sie schmiedete einen Plan, wie sie die Jüngere loswerden konnte.
Eines schönen Morgens, es war klar und sonnig, sprach die Ältere: „Komm Schwester, wir wollen spazieren gehen und nachschauen, ob unseres Vaters Schiffe schon den Mühlenkanal bei Bionnorie heraufkommen. Und Hand in Hand gingen sie zum Fluss. Am Ufer angekommen, stellte sich die Jüngere auf einen Stein am Ufer, um nach der Landung der königlichen Schiffe ausschauzuhalten, da packte sie die Ältere von hinten und warf sie in das reissende Wasser.
„Oh, liebe Schwester, reich mir deine Hand“, rief die Jüngere in Todesangst, als sie davontrieb, „ und du sollst von allem, was ich besitze und besitzen werde die Hälfte abbekommen!“ „Oh nein, Schande über mich, wenn ich Dir meine Hand reichen und dich retten würde, wo Du mir meinen Liebsten genommen hast. Und deinen Besitz erbe ich ohnehin.
„Oh Schwester, liebe Schwester“, wenn Du mir nicht die Hand reichen willst, dann doch wenigstens deinen Handschuh“, rief sie, während sie stromabwärts trieb, „und du sollst auch deinen Liebsten,
William, wiederhaben!“
„Nein, weder Hand noch Handschuh werde ich Dir reichen und wenn du erst ertrunken und gestorben bist, wird der schöne William ohnehin ganz mir gehören!“. Sprachs, drehte sich um und ging zurück
zum Schloss.
Manchmal schwimmend, manchmal sinkend trieb nun der Körper der toten Prinzessin den Fluss entlang bis er vom Sog eines Mühlstromes ergriffen wurde. Es war um die Mittagszeit, als die Tochter des Müllers am Fluss Wasser zum Kochen holen wollte. Da sah sie etwas Weisses im Wasser zwischen den Mühldämmen treiben. Sogleich rief sie: „Vater, Vater, schliess die Schleusentore, da schwimmt etwas weisses, wie ein Schwan oder ein Mädchen. Der Müller eilte sofort zum Mühldamm und stoppte das Mühlrad.
Dann zogen sie den Körper der toten Prinzessin mit vereinten Kräften aus dem Wasser. Und schön war sie noch im Tode, wie sie da lag, lilienweiss mit ihrem langen goldenen Haar, den Perlen und Edelsteinen, dem goldenen Gürtel und dem langen weissen Kleid.
Und wie sie da lag in all ihrer Schönheit, kam ein berühmter Harfner des Weges. Er schaute in das blasse Gesicht der Prinzessin und konnte es seit dem nicht mehr vergessen, obwohl er weit reiste und vieles zu sehen bekam. Nach einiger Zeit kehrte er zurück an den Mühldamm von Binnorie, an die Stelle, wo man die tote Prinzessin begraben hatte. Aber alles, was von der Prinzessin noch übrig war waren Knochen und ihr goldenes Haar. Sodann baute er sich aus ihrem Brustbein eine Harfe und aus dem Haar der Prinzessin spann der Harfner die Saiten. Dann zog er weiter, den Hügel bergan zum Schloss des Königs.
An diesem Abend war der ganze Hofstaat zusammengekommen: König, Königin, die Tochter und Sir William, der Schwiegersohn. Alle wollten sie der Kunst des berühmten Harfners lauschen. Zuerst sang und spielte er auf seiner alten Harfe, dabei hatte er das Talent, mit seiner Musik ganz nach seinem Belieben alle fröh und glücklich, oder aber auch traurig stimmen zu können. Später am Abend wollte der Harfner auch auf der neuen Harfe spielen, die er am Nachmittage gebaut hatte, doch wie er sie auspackte, begann sie, völlig von selbst mit klarem dunklen Ton zu singen:
„Dort drüben sitzt mein Vater, der König,
Binnorie, oh Binnorie;
Und dort sitz meine Mutter, die Königin;
bei den Mühldämmen von Binnorie;“
„Und dort steht mein Bruder Hugh,
Binnorie, oh Binnorie
Bei ihm William, mein Liebster“, mal ehrlich, mal verlogen;
bei den Mühldämmen von Binnorie;“
Alle waren erschrocken und der Harfner musste die ganze Geschichte erzählen, wie er die ertrunkene Prinzessin am Ufer des Mühldammes von Binnorie liegen sah, wie er aus ihren Gebeinen die Harfe baute und aus dem Haar ihre Saiten fertigte. Und gerade als er mit der Geschichte endete sang die Harfe laut und klar:
„Und dort sitzt meine Schwester, die mich ertränkte,
bei den Mühldämmen von Binnorie.“
Doch kaum war der letzte Ton verklungen, da krachte es und die Harfe zerbrach in Stücke und gab nie wieder einen Ton von sich.
(Joseph Jacobs – England)
Magdalenchen und Kati
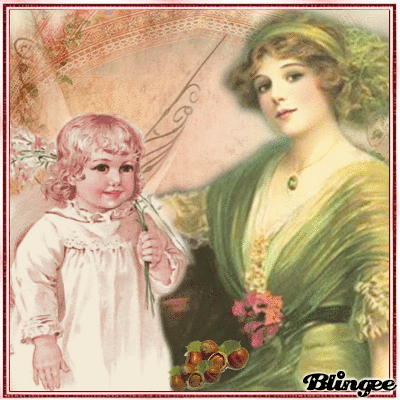
Es war einmal ein König, dessen Frau war gestorben, und sie hatte ihm eine einzige Tochter hinterlassen, die er zärtlich liebte. Die kleine Prinzessin hieß Magdalenchen, und sie war so gut und so mild und herzig, daß sie alle Untertanen gern mochten. Aber da der König meist mit Staatsgeschäften zu tun hatte, führte das Mädel ein recht einsames Leben und wünschte sich oft, es hätte ein Schwesterchen, mit dem es spielen und das ihm Gesellschaft leisten könnte. Da der König das vernahm, entschloß er sich, eine Gräfin von mittleren Jahren zu heiraten, die er an einem benachbarten Fürstenhofe getroffen hatte. Sie hatte nämlich eine Tochter Kati, die grad ein wenig jünger als Magdalenchen war. Er glaubte, das gäbe eine Spielgesellin für seine Tochter.
So geschah nun alles, und in jeder Hinsicht lief der Plan auch recht gut aus; denn die beiden Mädchen liebten sich innig und pflegten alles miteinander zu teilen, als ob sie wirklich Schwestern wären. Aber nach der anderen Seite schlug es sehr bös aus, denn die neue Königin war eine grausame und ehrgeizige Frau, und sie wollte, ihre eigene Tochter sollte es einmal ebenso haben wie sie, eine prunkvolle Hochzeit feiern und vielleicht ebenfalls Königin werden. Als sie aber sah, daß Magdalenchen zu einem sehr schönen jungen Mädchen heranwuchs – bei weitem schöner als ihre eigene Tochter -, da stieg in ihr Haß auf, und sie wünschte, jene verlöre auf irgendeine Weise ihre Schönheit. Denn, so dachte sie bei sich, welcher Freier wird sich um meine Tochter kümmern, solange ihr die Stiefschwester zur Seite steht?
Nun war aber unter den Dienern und Gefolgsleuten in ihres Mannes Schloß ein altes Hühnerweib, von dem die Leute glaubten, es sei mit den bösen Luftgeistern im Bunde und es sei geschult in der Bereitung von Zaubermitteln, Säften und Liebestränken. Vielleicht kann es mir bei meinen Absichten behilflich sein, sagte sich die böse Königin; und eines Nachts, als es schon schummrig wurde, hüllte sie sich in einen weiten Mantel und machte sich auf den Weg zur Hütte des alten Hühnerweibes. „Schick mir die Dirne morgen früh, bevor sie gefrühstückt hat“, erwiderte die Alte, als sie erfuhr, was ihre Besucherin von ihr wollte. „Ich will schon ein Mittel finden, ihrer Schönheit eins auszuwischen!“ Und die böse Königin ging befriedigt wieder heim.
Am nächsten Morgen in der Frühe ging sie ins Zimmer der Prinzessin, die gerade beim Anziehen war, und gab ihr den Auftrag, noch vor dem Frühstück loszugehen und die Eier zu holen, welche die Hühnerfrau gesammelt. „Und sieh zu“, so mahnte sie nochmals, „daß du vor dem Weggehen keinen Bissen issest, denn nichts malt die Wangen eines jungen Mädchens rosiger, als wenn es einen Fastengang in die frische Morgenluft hinaus unternimmt." Prinzessin Magdalenchen versprach, alles getreulich zu befolgen und die Eier zu holen, wie ihr geheißen war. Aber da sie nie gern aus der Tür ging ohne einen Happen zu essen, und da sie außerdem befürchtete, ihre Stiefmutter könnte einen arglistigen Grund für den ungewöhnlichen Rat haben – schlüpfte sie erst noch in die Speisekammer treppabwärts und versah sich mit einem großen Stück Kuchen.
Als sie es aufgegessen hatt, machte sie sich auf den Weg zur Hütte der alten Hühnerfrau und fragte nach den Eiern. „Hebt einmal den Deckel von jenem Topf dort auf, Eure Hoheit, und Ihr werdet sie dann sehen“, sagte die alte Frau und wies auf einen breitbauchigen Topf in der Ecke, in dem sie sonst ihr Hühnerfleisch kochte. Die Prinzessin tat es und fand einen Haufen Eier darin liegen, die sie in ihren Korb tat, während die alte Frau sie mit seltsamem Lächeln beobachtete. „Geh heim zu deiner Frau Mutter, mein Honigkind“, sagte sie schließlich, „und bestelle ihr von mir, sie solle die Schranktür besser verwahren.“
Die Prinzessin ging heim und richtete ihrer Stiefmutter die sonderbare Botschaft aus; sie war selbst neugierig, was das wohl bedeuten mochte. Aber wenn sie die Worte der Hühnerfrau nicht verstand, die Königin verstand sie nur zu gut. Denn sie entnahm daraus, daß die Prinzessin den Zauber der alten Hexe umgangen hatte. So schickte sie am nächsten Morgen ihre Stieftochter noch einmal mit dem gleichen Auftrag fort, begleitete sie aber persönlich bis zum Schlosstor, so daß das arme Mädchen keine Gelegenheit mehr fand für einen Besuch in der Speisekammer.
Aber als sie auf der Landstraße, die zur Hütte führte, dahinging, spürte sie solchen Hunger, daß sie beim Vorübergehen ein paar Landleute, die am Wegrande Erbsen pflückten, um eine Handvoll bat. Das taten sie auch, und sie aß die Erbsen, daß schließlich dasselbe geschah wie gestern. Die Hühnerfrau ließ sie nach den Eiern schauen; aber sie vermochte mit ihrem Zauber nichts auszurichten, weil sie ihr Fasten gebrochen hatte. So ließ die alte Frau sie wieder heimgehen und gab der Königin die gleiche Botschaft mit.
Als die Königin das vernahm, wurde sie sehr ärgerlich, denn sie fühlte, daß das Mädchen sie durch diese Unfolgsamkeiten überlistete. Sie beschloß also, obwohl sie kein Freund des Frühaufstehens war, sie am nächsten Morgen persönlich zu begleiten, um sich zu vergewissern, daß sie unterwegs nichts zu essen bekam. So lief sie am nächsten Morgen mit der Prinzessin zur Hütte des Hühnerweibes, und wie zweimal zuvor schickte die Alte die Königstochter an den Topf in der Ecke, damit sie den Deckel abnähme und die Eier herausholte.
In demselben Augenblick aber, als das die Prinzessin befolgte, sprang ihr das liebliche Haupt vom Halse, und ein grober Schafskopf setzte sich an dessen Stelle. Dann dankte die böse Königin der grausamen alten Hexe für den Dienst, den sie geleistet hatte, und ging nach Haus, hoch erfreut über das glückliche Gelingen ihres Anschlages. Indes hob die arme Prinzessin ihr eigen Haupt vom Boden auf und legte es mit den Eiern zusammen in ihren Korb und ging weinend heim. Sie verbarg sich unterwegs überall hinter den Hecken, so sehr schämte sie sich über ihren Schafskopf, und war ängstlich darum besorgt, daß sie nur ja niemand sah. Nun erzählte ich schon, wie sehr die Stiefschwester der Prinzessin, Kati, sie liebte, und als sie sah, was für eine grausame Tat gegen sie verübt worden war, war sie so erregt, daß sie erklärte, sie würde keine Stunde mehr in dem Schlosse bleiben.
Sie sagte: „Wenn meine hohe Mutter eine solche Tat vollführen lassen kann, was sollte sie daran hindern, eine andere folgen zu lassen. Daher dünkt mich, es ist es besser für uns beide, dahin zu gehen, wo sie uns nicht erreichen kann." So wickelte sie ein schönes Tuch ihrer armen Stiefschwester um den Kopf, daß niemand mehr erkennen konnte, wie er aussah, legte den rechten Kopf in den Korb, nahm sie bei der Hand, und so machten sich beide auf, ihr Glück zu versuchen.
Sie wanderten und wanderten, bis sie einen strahlenden Palast erreichten, und als sie herangekommen waren, wollte Kati gleich beherzt hinaufgehen und an das Tor pochen. „Vielleicht finde ich hier Arbeit“, erklärte sie, „und verdiene Geld genug, um uns beide sorgenfrei zu stellen.“ Am liebsten hätte die arme Prinzessin sie zurückgehalten. „Sie werden nichts von dir wissen wollen“, flüsterte sie, „wenn sie sehen, du hast eine Stiefschwester mit einem Schafskopf.“ „Und wer sollte das erfahren, daß du einen Schafskopf hast?“ fragte Katharina. „Nur mußt du deinen Mund halten und dir das Tuch dicht um den Kopf wickeln, das übrige kannst du mir überlassen!“ So stieg sie hinauf und pochte an die Küchentür, und als die Hausmeisterin kam, um nachzusehen, fragte sie, ob sie nicht irgendeine Arbeit für sie hätte.
„Denn ich habe“, so sagte sie, „eine kranke Schwester, die arg von Kopfschmerzen geplagt wird, und ich würde gern ein ruhiges Unterkommen für sie finden, wo sie zur Nacht bleiben kann.“ „Verstehst du etwas von Krankheiten?“ fragte die Hausmeisterin, die recht betroffen war über Katis sanfte Stimme und edle Art. „Gewiß“, erwiderte Kati, „denn wenn man eine Schwester hat, die von Kopfschmerzen geplagt wird, dann lernt man leise auftreten und jeden Lärm vermeiden.“
Nun wollte es der Zufall, daß des Königs ältester Sohn, der Kronprinz, im Palast an einer seltsamen Krankheit daniederlag, die sein Gehirn in Mitleidenschaft gezogen zu haben schien. Denn er war so aufgeregt, besonders des Nachts, daß immer jemand bei ihm Wache halten mußte, damit er sich kein Leid antat. Und dieser Zustand hatte schon so lange angehalten, daß jedermann ganz erschöpft war. Und die alte Hausmeisterin dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, wieder zu ruhigem Nachtschlaf zu kommen, wenn man diese Fremde mit der Wache beim Prinzen betrauen könne. Sie ließ sie also an der Tür stehen und ging zum König, um sich Rat zu holen. Und der König kam heraus und sprach mit Kati.
Auch er freute sich über ihre Stimme und ihr Auftreten und gab deshalb die Anweisung, es sollte für sie und ihre kranke Schwester im Schlosse ein abgelegenes Zimmer hergerichtet werden. Dazu versprach er ihr für den nächsten Morgen als Belohnung einen Beutel voll Silbertaler, wenn sie in der Nacht beim Prinzen Wache halten und ihn vor allem Harm schützen wolle. Katharina willigte gern in den Handel ein. Denn, dachte sie, wenigstens ist’s ein Unterkommen zur Nacht für die Prinzessin; und außerdem, einen Beutel voll Silbergeld bekommt man nicht alle Tage. So ging die Prinzessin schlafen in dem schmucken Zimmer, das für sie hergerichtet war, und Katharina bereitete sich zur Nachtwache bei dem kranken Prinzen.
Es war ein hübscher, stattlicher Jüngling, der in einer Art Fieber zu liegen schien. Denn sein Geist war nicht ganz klar, und er warf und wälzte sich von einer Seite auf die andere. Dabei starrte er ängstlich vor sich hin und streckte die Hände aus, als ob er etwas greifen wolle. Und um zwölf Uhr mitternachts, gerade als Katharina glaubte, er würde nun in den erfrischenden Schlaf verfallen, erhob er sich zu ihrem größten Schrecken aus dem Bett, kleidete sich eilends an, öffnete die Tür und schlüpfte die Treppe hinunter, als ob er nach jemand Ausschau halten wolle. „Das muß etwas Seltsames sein“, sagte sich das Mädchen. „Mir scheint, ich tue gut daran, ihm zu folgen, um zu sehen, was geschieht.“
So stahl sie sich aus dem Zimmer, und heimlich folgte sie dem Prinzen unbehelligt treppabwärts. Wie groß war aber ihr Erstaunen, als sie entdeckte, daß er augenscheinlich einen weiteren Weg vorhatte. Denn er griff zu Hut und Reitrock, schloß die Tür auf, wandte sich über den Hof zum Stalle und begann, sein Pferd zu satteln. Als er damit fertig war, führte er es heraus, stieg auf, pfiff leise nach dem Hunde, der in der Ecke schlief, und machte sich auf, davonzureiten. „Ich muß auch mitgehen und das Weitere beobachten“, sagte Katharina mutigen Herzens, „denn es scheint mir, er ist verhext. Ein Kranker vermag das nicht.“
Also, da das Pferd gerade lostraben wollte, schwang sie sich leicht auf seinen Rücken und richtete sich ganz behaglich hinter dem Reiter ein, der sie gar nicht bemerkt hatte. Dann ritt das seltsame Paar fort durch die Wälder, und unterwegs pflückte Katharina die Haselnüsse, die in dichten Stauden ihr Gesicht streiften. Denn, sagte sie sich, weiß der Himmel, wo ich wieder etwas zu essen bekomme. Weiter und weiter ritten sie, bis sie den grünen Wald hinter sich ließen und an ein offenes Moorgelände kamen. Alsbald erreichten sie einen Hügel, und dort zog der Prinz die Zügel an, sprang herab und rief in einem seltsamen, unheimlichen Flüsterton:
„Grüner Hügel, tu dich auf, tu dich auf und laß uns ein, den Prinzen, Pferd und Hund.“ „Und“, flüsterte Katharina schnell hinterher, „laß auch seine Frau hinter ihm ein.“ Zu ihrer großen Verwunderung schien sich der Gipfel des Erdhügels im Nu aufzukippen, und es blieb für die kleine Gesellschaft eine genügend große Öffnung zum Eintreten. Dann schloß er sich wieder allmählich hinter ihnen.
Sie befanden sich in einer prächtigen weiten Halle, und Hunderte von strahlenden Kerzen steckten in Leuchtern an den Wänden. In der Mitte des Gemaches stand eine Gruppe der schönsten Mädchen, die Katja jemals in ihrem Leben gesehen hatte. Alle waren in schimmernde Ballgewänder gekleidet und trugen Kränze aus Rosen und Veilchen im Haar. Auch waren da muntere Herren, die mit diesen schönen Mädchen zum Takt einer feenhaften Musik getanzt hatten. Als die Mädchen den Prinzen sahen, rannten sie ihm entgegen und führten ihn mitten in ihre Lustbarkeiten. Und an ihren Händen schien sogleich seine Schwermut zu schwinden, er wurde der heiterste in der ganzen Schar und lachte und tanzte und sang, als ob er nie gewußt, was Krankheit heißt.
Da sich niemand um Katharina kümmerte, setze sie sich ruhig auf einen Felsenvorsprung und wartete, was geschähe. Und als sie so wartete, gewahrte sie ein ganz kleines Kindchen, das dicht vor ihren Füßen mit einer zierlichen Rute spielte. Es war ein herziges, kleines Kind, und gerad dachte sie daran, mit ihm sich anzufreunden, da kam eins von den schönen Mädchen vorüber, und als es die Rute sah, sagte es behutsam zu seinem Gefährten: „Drei Streiche mit jener Rute geben jedem ein hübsches Gesicht.“ Das war aber eine Botschaft! Katharina atmete schwer und hastig, mit zitternden Fingern holte sie ein paar Nüsse aus ihrer Tasche und rollte sie unabsichtlich dem Kinde zu.
Das schien nicht oft Nüsse zu bekommen; denn sofort ließ es seine kleine Rute los und streckte die zierlichen Händchen nach den Nüssen aus. Eben das hatte sie erwartet. Sie ließ sich von ihrem Sitz auf den Boden herabgleiten und rückte ein wenig näher heran. Dann warf sie wieder ein oder zwei Nüsse ihm in den Weg, und als das Kind aufsammelte, brachte sie es fertig, die Rute unbemerkt zu entwenden und unter ihrer Schürze zu verbergen. Danach kroch sie vorsichtig wieder an ihren Platz zurück.
Und das war auch nicht einen Augenblick zu früh; denn gerade krähte der Hahn, und bei dem Geschrei verschwanden sämtliche Tänzer – alle außer dem Prinzen, der schleunigst zu seinen Pferden eilte und es so eilig mit dem Aufbruch hatte, daß Kati sich alle Mühe geben mußte, hinter ihm aufzusitzen, bevor sich der Hügel auseinandertat, und schleunigst ritt er wieder in die Welt draußen hinein. Während sie im grauen Morgenlicht heimwärts ritten, knackte sie ihre Nüsse und aß sie gierig auf, denn ihr Abenteuer hatte sie erstaunlich hungrig gemacht. Als sie mit ihrem seltsamen Patienten wieder das Schloß erreicht hatte, wartete sie noch, bis er zu Bett ging und sich wieder zu wälzen und werfen begann wie vorher; dann aber stürzte sie zu ihrer Stiefschwester ins Zimmer und fand sie in tiefsten Schlafe. Ihr armer missgestalteter Kopf ruhte friedlich auf dem Kissen.
Sie versetzte ihm nun drei kleine Schläge mit der Feenrute; und seht und schaut: der Schafskopf war verschwunden, und dafür hatte die Prinzessin ihr eigenes schönes Antlitz wieder. Am Morgen kamen der König und die alte Hausmeisterin, um nachzuforschen, wie der Prinz die Nacht verbracht hätte. Kati berichtete, er hätte eine treffliche Nacht gehabt. Denn sie war ängstlich darauf bedacht, noch länger bei ihm zu bleiben. Hatte sie nun herausgefunden, daß die Elfenmädchen in dem Grünen Hügel einen Zauber über ihn verhängt hatten, so war sie auch entschlossen; herauszufinden, wie der Zauber zu brechen war.
Und das Glück war günstig: der König war erfreut darüber, daß er eine so treffliche Wärterin für den Prinzen gefunden hatte, und er war auch von den holden Blicken ihrer Stiefschwester gebannt, die so blank und hehr wie in alten Tagen aus ihrer Kammer trat und erklärte, ihr Kopfschmerz sei nun ganz gewichen, und auch sie täte jetzt gern jede Arbeit, die ihr die Hausmeisterin aufgäbe, so daß er Kati inständig bat, noch ein wenig länger bei seinem Sohn zu verweilen. Er fügte hinzu, wenn sie dazu willens sei, würde er ihr einen Beutel voll goldener Dukaten schenken. Gern war Kati bereit. Und in der Nacht wachte sie wieder beim Prinzen wie zuvor.
Und um zwölf Uhr stand er auf, kleidete sich an und ritt zu dem Feenhügel, gerade wie sie erwartet hatte, denn sie war sich nun dessen ganz gewiß, daß der Jüngling verzaubert war und nicht am Fieber litt, wie alle anderen dachten. Und seid gewiß, sie begleitete ihn wieder, ritt unbemerkt hinter ihm mit und pflückte sich Nüsse unterwegs. Als sie den Feenhügel erreichten, sprach er die gleichen Worte wie in der Nacht zuvor: „Grüner Hügel, tu dich auf, und laß uns ein, den Prinzen, Pferd und Hund!“ Und da sich der Grüne Hügel öffnete, fügte Kati leise hinzu: „Laß auch seine Frau hinter ihm ein.“ So kamen sie alle zusammen hinein.
Kati setzte sich auf einen Stein und schaute um sich. Dieselben Lustbarkeiten wie in der Vornacht huben an, und der Prinz war bald im tollsten Betriebe, er tanzte und lachte wild. Das Mädchen beobachtete ihn scharf, voller Erwartung ob sie herausbekommen könnte, wie man ihn wieder zu gesunden Sinnen brächte. Und wie sie ihn so beobachtete, kam wieder das Kindchen, das mit der Zauberrute gespielt hatte, zu ihr. Nun spielte es diesmal mit einem Vögelchen. Und wie es damit spielte, kam eine der Tänzerinnen vorüber, wandte sich zu ihrem Gefährten und sagte leichthin: „Drei Bissen von jenem Vögelchen würden dem Prinzen die Krankheit nehmen und ihn so munter machen, wie er jemals war.“ Dann kehrten sie wieder in das Getriebe der Tanzenden zurück.
Kati aber saß hochaufgerichtet auf dem Steine und bebte vor Erregung. Wenn sie nur des Vogels habhaft werden konnte, dann war der Prinz geheilt! Ganz vorsichtig schüttete sie wieder einige Nüsse aus ihrer Tasche und rollte sie über den Boden dem Kinde zu. Das hob sie eifrig auf und ließ dabei den Vogel fahren; blitzschnell hatte ihn Kati gefaßt und verbarg ihn unter ihrer Schürze. Nicht lange danach krähte der Hahn, und sie und der Prinz machten sich auf den Heimritt. Aber an diesem Morgen knackte sie keine Nüsse, sondern tötete und rupfte den Vogel, dessen Federn sie über die Straße verstreute, und sowie sie das Zimmer des Prinzen erreicht hatte und ihn wohlbehalten im Bett wußte, steckte sie den Vogel über dem Feuer auf einen Spieß und briet ihn.
Und alsbald begann er zu brutzeln und braun zu werden und köstlich zu duften, so daß der Prinz in seinem Bett in der Ecke die Augen aufschlug und schwach ihr zuraunte:
„Wie sehr wünschte ich, ein Stückchen von jenem Vogel zu bekommen!“ Als Katharina diese Worte hörte, hüpfte ihr Herz vor Freuden, und sobald der Vogel gebraten war, schnitt sie ein Stückchen von seiner Brust und steckte es dem Prinzen in den Mund. Als er es gegessen hatte, schien ein wenig seiner alten Kraft zurückzukehren, denn er stützte sich auf den Ellenbogen und sah seine Pflegerin an. „Oh, hätte ich doch noch ein Stückchen von dem Vogel!“ sagte er. Und seine Stimme klang schon kräftiger.
So gab ihm Kati ein zweites Stück, und als er es gegessen hatte, saß er aufrecht in seinem Bett. „Oh, hätte ich doch nur noch ein drittes Stück von dem Vogel“ rief er. Und nun kehrte seine Gesichtsfarbe zurück, und seine Augen fingen an zu leuchten. Diesmal brachte ihm Kati alles übrige von dem Vogel. Und gierig aß er es auf und löste mit den Fingern auch den letzten Fetzen Fleisch von dem Knochen. Als er fertig war, sprang er aus dem Bette, kleidete sich an und setzte sich ans Feuer. Und als morgens der König und hinter ihm die alte Hausmeisterin kamen, um zu sehen, wie es um den Prinzen stünde, fanden sie ihn, wie zusammen mit seiner Pflegerin Nüsse knackte, denn Kati hatte in ihrer Schürzentasche noch eine ganze Menge mitgebracht.
Der König war so voll Freude über die Heilung seines Sohnes, so daß er Kati die höchsten Ehren angedeihen ließ und sofort Order gab, daß der Prinz sie heiraten sollte. „Denn“, so schloß er, „ein Mädchen, das so gut zu pflegen versteht, wird auch eine gute Königin abgeben.“ Der Prinz war ganz willens, nach dem Befehl seines Vaters zu tun. Und während sie miteinander plauderten, kam sein jüngerer Bruder herein; er führte Prinzessin Magdalenchen bei der Hand, deren Bekanntschaft er erst gestern gemacht hat, und erklärte: „Ich bin so verliebt in sie, daß ich sie sofort heiraten will! So ging daß alles bestens aus, und jedermann war voll Freuden.
Die beiden Hochzeiten fanden sogleich statt, und wenn die beiden Paare noch nicht gestorben sind, so leben sie heute noch.
Märchen aus Schottland
Die blaue Mütze
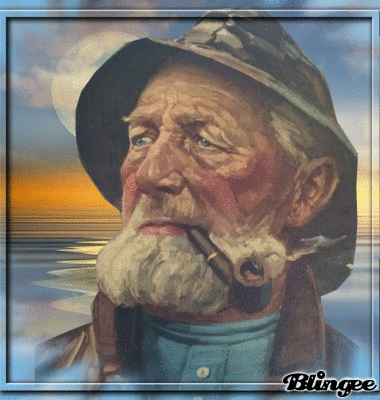
Es war einmal ein Fischer in Kyntyre, der hieß Ian MacRea. An einem Wintertag, als es keinen Zweck hatte, zum Fang auszufahren, weil die See zu stürmisch war, wollte Ian einen neuen Kiel für sein Boot anfertigen, und er ging in die Wälder zwischen Totaig und Glenelg, um einen großen Stamm dafür auszusuchen. Er hatte kaum damit begonnen, sich umzusehen, als dichter weißer Nebel von den Bergen herabkam und zwischen die Bäume kroch.
Nun befand sich Ian ziemlich weit von seinem Haus entfernt, und als der Nebel fiel, war er vor allem darum bekümmert, so rasch wie möglich heimzukommen, hatte er doch keine Lust, sich zu verlaufen und eine kalte Nacht im Freien zu verbringen. Er folgte also dem Pfad, den er gerade noch erkennen konnte und von dem er annahm, er werde ihn zurück nach Ardelve bringen. Aber bald sah er, daß er sich getäuscht hatte, denn der Pfad führte aus dem Wald heraus in eine seltsame Landschaft. Und als die Dunkelheit fiel, sah er sich hoffnungslos am Gebirgsbach verlaufen. Er wollte sich gerade in sein Plaid hüllen und unter einen Heidestrauch kriechen, als er in der Ferne schwaches Licht schimmern sah.
Er ging forsch darauf zu, und als er näher kam, erkannte er, daß der Lichtschein aus dem Fenster eines Steinunterstandes kam, wie ihn die Bauern benutzten, wenn sie bei ihren Herden auf den Sommerweiden bleiben. „Hier werde ich ein Lager für die Nacht bekommen, und ein gutes Torffeuer dürfte es wohl auch geben“, dachte Ian und klopfte an die Tür. Zu seinem Erstaunen öffnete niemand. „Es muß doch aber jemand da drinnen sein“, überlegte er, „eine Kerze zündet sich schließlich nicht von allein an.“ Er klopfte ein zweites Mal an die Tür. Wieder kam keine Antwort, obwohl er von drinnen Stimmen hörte. Darüber wurde Ian zornig und er rief: „Was seid ihr nur für seltsame Leute, daß ihr einen wegmüden Fremden in einer Winternacht keine Zuflucht geben wollt?“
Da hörte er Füße schlürfen, und die Tür wurde gerade so weit geöffnet, um eine Katze hereinzulassen. In dem Spalt aber zeigte sich eine alte Frau, die ihn scharf musterte. „Ich denke, du kannst die Nacht hierbleiben“, sagte sie nicht sehr freundlich, es gibt kein anderes Haus weit und breit. Also komm herein und leg dich vor den Herd.“ Sie öffnete die Tür etwas weiter. Ian betrat den kleinen Unterstand, und sofort schlug sie hinter ihm die Tür wieder zu. Auf dem Herd brannte ein gutes Torffeuer, und zu beiden Seiten davon saß noch je eine alte Frau.
Die drei Alten sagten kein Wort zu Ian, aber jene, die ihm die Tür aufgemacht hatte, führte ihn zum Herd, wo er sich in seinen Plaid rollte. Er konnte nicht einschlafen, denn es kam ihm unheimlich vor in dem kleinen Unterstand, und er dachte: Besser du hälst deine Augen auf. Nach einer Weile erhob sich eine der alten Frauen. Offenbar glaubte sie, der unerbetener Gast sei inzwischen eingeschlafen. Sie ging zu einer großen hölzernen Kiste, die in einer Ecke des Raumes stand. Ian hielt den Atem an und sah, wie sie den schweren Deckel hochklappte, und eine blaue Mütze herausnahm und sie aufsetzte.
Dann rief sie laut mit knarrender Stimme: „Carlisle!“ Und zu Ians Erstaunen war sie darauf verschwunden. So ging das auch bei den beiden anderen alten Weibern. Ein jedes stand auf, holte eine blaue Mütze aus der Kiste, rief „Carlisle!“ und hatte sich im nächsten Augenblick in Luft aufgelöst. Sobald er ganz allein war, stand Ian auf und ging zu der Kiste. Drinnen fand er noch eine weitere blaue Mütze, die genauso aussah wie die anderen, und da er neugierig war zu erfahren, in welche Welt die drei Hexen davongefahren waren, zog er die Mütze an und rief laut, wie er es von ihnen gehört hatte: „Carlisle!“ Sofort wichen die Steinmauern des elenden Unterstands zur Seite, und es war Ian, als schieße er mit großer Geschwindigkeit durch die Luft.
Dann stürzte er mit einem Bumms zu Boden, und als er sich umschaute, sah er, daß er in einem riesigen Weinkeller stand, wo die drei Weiber ausgelassen zechten. Als sie aber Ian sahen, hörten sie
sofort auf und riefen: Kintail, Kintail wieder zurück!
Sofort waren sie verschwunden. Ian spürte kein Verlangen, ihnen auch diesmal wieder zu folgen, denn in dieser Umgebung gefiel es ihm. Er betrachtete alle Krucken und Flaschen sorgfältig, nahm
hier und dort einen Schluck, bis er in eine Ecke schwankte und in tiefen Schlaf fiel. Nun war es aber so, daß der Weinkeller, in den Ian auf so geheimnisvolle Weise gelangt war, dem Bischof von
Carlisle gehörte und unter dessen Palast in England lag.
Am Morgen kamen die Diener des Bischofs in den Keller hinunter und erschraken, als sie die leeren Flaschen sahen, die am Boden herumlagen. „Es haben schon öfter Flaschen aus den Regalen gefehlt“, sagte der Steward, „aber so schandbar hat sich der Dieb hier unten noch nie aufgeführt.“ Dann entdeckten die Diener Ian, der immer noch in der Ecke lag und schlief, und immer noch hatte er die blaue Mütze auf dem Kopf. „Da ist der Dieb. Da ist der Dieb!“ riefen sie. Ian wachte auf, sie banden ihm die Arme auf den Rücken, legten ihm an den Fußknöcheln Fesseln an und zerrten ihn fort wie eine Gans, die auf den Schlachtklotz soll. Der Gefangene wurde vor den Bischof gebracht, und ehe man ihn vor den Thron des hohen Herrn führte, riß man ihm die Mütze vom Kopf, denn es war ein Zeichen der Missachtung, wenn ein Mann mit einer Mütze den Palast betrat. Ian wurde verhört und dem bischöflichen Gericht vorgeführt, das ihn zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilte.
Auf dem Marktplatz von Carlisle häufte man einen großen Holzstoß und band den armen Sünder darauf fest. Und viel Volk versammelte sich, um zu sehen, wie der Mann durch das Feuer kam. Ian hatte sich schon in sein schlimmes Schicksal gefügt, als er plötzlich einen guten Einfall hatte. „Eine letzte Bitte!“ rief er, „ich will nicht ohne meine blaue Mütze in die Ewigkeit eingehen.“ Seine Bitte wurde ihm gewährt, man setzte ihm die blaue Mütze auf den Kopf. Kaum aber fühlte Ian, daß man sie ihm aufgesetzt hatte, da warf er einen verzweifelten Blick auf die Flammen, die schon unter seinen Zehenspitzen züngelten, und rief, so laut er konnte: Kintail! Kintail! wieder zurück! Und zum großen Erstauen der guten Leute von Carlisle waren Ian und der Holzstoß in eben diesem Augenblick verschwunden und wurden in England nie mehr gesehen.
Als Ian wieder zu sich kam, befand er sich in den Wäldern zwischen Totaig und Glenelg, aber von dem alten Unterstand, in dem die drei Hexen gesessen hatten, war keine Spur mehr zu sehen. Es war ein schöner Tag nach einer Nacht mit Nebel, und Ian sah einen alten Bauern auf ihn zukommen. „Würdest du mich von diesem elenden Holzstoß losbinden?“, bat Ian den alten Mann. „Aber wie in aller Welt ist es dazu gekommen, daß man dich da festgebunden hat?“, fragte er dann. Ian betrachtete den Stoß schuldbewusst, aber dann sah er, daß es kein festes Holz war, und es fiel ihm plötzlich wieder ein, weshalb er von zu Haus fortgegangen war.
„Ach, das ist eine Lage Holz, die ich zusammengetragen habe, um einen neuen Kiel für mein Fischerboot zu machen“, erwiderte er, „der Bischof von Carlisle selbst hat es mir gegeben.“ Und als der Bauer ihm den rechten Weg nach Ardelve gewiesen hatte, ging Ian fröhlich pfeifend heim.
Märchen aus Schottland
Der Königssohn und der Tod

Ein mächtiger König saß in seinem Reiche; er hatte Güter aller Art und erlesene Berater, weltliche Ehre und unermeßlichen Reichtum an Gold und Edelsteinen, und seinen Stolz setzte er darein, in seiner Halle Männer zu haben, die man Philosophen nennt, das heißt hochgelehrte Weise.
Nun geschah es, daß ihm die Königin einen Sohn gebar, und der wuchs heran, wie es einem Königskinde geziemt, hold und freundlich, beständig und trefflich, männlichen Sinnes ohne Falsch und Hehl. Und als er so alt war, daß an seine Unterweisung gedacht werden mußte, stand eines Tages, als der König an seiner Tafel saß, der weiseste Meister auf, der in der Halle war, trat vor den Hochsitz und sagte: „Herr, wir glauben, Euer Sohn ist von Gott gegeben, auf daß er dereinst auf Eurem Throne sitze, und darum erbiete ich mich, ihn in jeglicher Wissenschaft zu unterweisen.“ Der König aber sagte mit gar zorniger Miene: „Was könntest du meinen Sohn lehren? Dein Wissen ist mehr wert als die Possen fahrender Leute und das Spiel der Kinder. Und mein Sohn soll nicht zu deinen Füßen sitzen, sondern er soll ohne Unterricht bleiben, oder er soll den Meister erhalten, der ihn unbekannte Weisheit lehren kann, von der ihr nie etwas gehört habt.“
Nach einigen Tagen, als der König wieder bei Tische saß, wurde leise an die Tür gepocht, und als die Wächter nachsahen, stand draußen ein Mann mit dem Gehaben eines Weisen, und der verlangte, vor den König geführt zu werden. Der König erlaubte es, und der Mann kam herein; er trug einen großen Filzhut, so daß man sein Gesicht nicht genau sehen konnte, rückte auch zum Gruße nur wenig an der Krempe und sagte: „Heil Euch, Herr!“ Und er fuhr fort: „Ihr seht, Herr, daß ich ein Weiser bin, und da mir ein Wort von Euch wegen des Unterrichts Eures Sohnes zu Ohren gekommen ist, das Euren Räten etwas hochfahrend erschien, so bin ich gekommen, um ihm mit meinem Wissen zu dienen; denn was ich ihn lehren kann, wird, hoffe ich, keinem lebenden Menschen bekannt sein. Da ich aber alt und schrullig bin, so mag ich nicht dem Lärm der Welt ausgesetzt sein, und darum laßt für uns in dem Walde zwei Meilen vor der Stadt ein Haus errichten und Unterhalt für ein ganzes Jahr hinschaffen; denn ich will, daß uns dort niemand störe.“
Dieser Rede war der König froh, und er ließ schleunigst alles so herrichten. Und als der Meister und der Königssohn das Haus bezogen hatten, da setzte sich der Meister, wie es ihm zukam, auf den Hochsitz, und der Königssohn setzte sich ihm zu Füßen, so demütig, wie ein Kind geringen Standes. Und so saßen sie am ersten Tag und schwiegen, und den zweiten und den dritten, und kein Wort wurde laut. Um es kurz zu machen, das ganze Jahr diente der Königssohn früh bis spät dem Meister und saß schweigend zu seinen Füßen. Und als das Jahr zu Ende war, sagte der Meister: „Morgen, mein Sohn, wird man uns holen und vor den König führen. Er wird dich um den Unterricht fragen, und du magst ihm antworten, du dürftest von deiner Belehrung nichts sagen, du wissest aber, daß dergleichen noch nie ein menschliches Ohr vernommen habe. Und dein Vater wird fragen, ob du noch weiter bei mir bleiben willst, ich gebe dir keinen Rat.“ Und so geschah es, wie der Meister gesagt hatte, und der Königssohn sagte, er gehe gern in das Haus am Walde zurück.
Das zweite Jahr verlief wie das erste, und wieder entschloß sich der Königssohn, in der Einsamkeit zu verharren, und das dritte Jahr verging in demselben Schweigen. Als aber auch dieses Jahr zu Ende war, sagte der Meister: „Mein Sohn, nun sollst du den Lohn für dein Schweigen, deine Geduld und deine Treue erhalten; denn du bist der Lehre würdig, die noch keinem Wesen zuteil geworden ist. Wisse, ich bin kein Mensch, sondern ich bin der Tod, und die Weisheit, die ich dir geben will, soll dich berühmt machen durch alle Lande, und nun gib wohl acht: Wenn ein Mensch in der Stadt krank wird, so gehe zu ihm, und du wirst mich bei ihm sitzen sehen, und du mußt beachten, wo ich sitze. Sitze ich bei seinen Füßen, so sollst du, wie es auch eintreffen wird, sagen, daß er lange, aber nicht sehr schwer krank sei und davonkommen wird; sitze ich ihm zur Seite, so wird die Krankheit schwerer, aber kürzer sein und ihr Genesung folgen; sitze ich aber zu seinen Häupten, so ist der Tod gewiß, mag die Qual länger oder kürzer währen. Und erkranken deine Freunde oder angesehene Leute, die du erfreuen oder deren Freundschaft du erwerben willst, oder willst du Geld oder Ehre von ihnen erlangen, so nimm den Vogel Karadius: sitze ich nicht am Kopfende des Kranken, so halte ihm den Vogel ins Gesicht, denn der Vogel hat die Eigentümlichkeit, die Krankheit aufzusaugen und aufzunehmen, und dann laß ihn los, und er fliegt mit der Krankheit hoch in die Luft und nahe zur Sonne und bläst die Krankheit in sie hinein, und sie nimmt sie auf und zerstört sie in ihrer Hitze. Und damit ist meine Lehre zu Ende und unser erstes Zusammensein; wir werden uns zwar wiedertreffen, aber das Widersehen wird dir keine Freude bringen.“ Damit schloß der Tod seine Rede.
Und es kam der Tag, wo sie beide vor den König gerufen wurden, und der Königssohn stellte dem Meister ein Zeugnis des Lobes aus, und der Meister erntete von dem König reichen Dank und das Angebot von Gaben und Ehrenbezeigungungen; er aber schlug alles aus und bat nur um Urlaub. Die Weisheit des Königssohnes wurde zunächst nicht gar hoch angeschlagen, aber mit der Zeit gewann er Ansehen, und das wuchs immer mehr, und schließlich war es das allgemeine Urteil, seinesgleichen sei noch nie geboren gewesen. Und bald waren gleichsam alle Länder in Bewegung ihn aufzusuchen, und er macht weite Reisen zu vornehmen Leuten, um ihre Krankheiten zu untersuchen. Und dann starb sein Vater, und als er den Thron bestiegen hatte, besuchte er nur noch die seine Freunde und die Mächtigen des Landes. Aber trotz seiner Gabe war er nicht hochmütig, sondern blieb herablassend und sanft und mild, so daß ihm jedes Kind von Herzen hold war. So vergingen seine Tage in Ruhm und Glück, und als er hundert erreicht hatte, war er noch ein rüstiger Mann.
Da kam eine heftige Krankheit über ihn, die wenig Aussicht zur Rettung ließ, und als er da einmal aus einer Ohnmacht erwachte, sah er, daß sein alter Meister mit dem breiten Filzhut gekommen war, und der saß dicht bei seinem Haupte. Und er sagte zu ihm: „Meister, warum bist du so bald gekommen!“ Und er Tod antwortete: „Einmal muß es sein.“ Und der König sagte: „Damals als ich, ein Königskind, drei Jahre lang schweigend zu deinen Füßen saß, hätte ich nicht gedacht, daß du mich wegreißen werdest aus der Fülle des Glücks und der königlichen Ehren und obwohl ich noch rüstig bin und zur Regierung wohl tauglich.“ Der Tod aber sagte, der König müsse durchaus mit ihm gehen; da sagte dieser: „So viel Frist wirst du mir aber doch gewähren, daß ich noch ein Vaterunser sprechen kann“, und der Tod gewährte die Frist eines Vaterunser. Und der König sprach die ersten vier Bitten des Vaterunsers; als er aber zu der Stelle gekommen war: „Vergib uns unsere Schuld“, schwieg er still. Der Meister wartete lange, aber er blieb stumm. Endlich sagte der Meister: „Warum, mein Sohn, betest du nicht weiter?“ Und der König antwortete: „Ich will nicht. Du hast mir gewährt, daß ich noch ein Vaterunser sprechen darf, und den Schluß werde ich nicht ehr beten, als bis ich gelebt habe, solange es mein Herz begehrt, und dann werde ich das Gebet freiwillig beenden.“
Und er Tod sagte: „Es ist deiner List gelungen, mich zu betrügen, und so wiest du für diesmal deinen Willen behaupten.“ Und er schied, und mit dem Könige wurde es so rasch besser, daß es allen ein Wunder schien, wie die Krankheit wich. Und er lebte in seinen Ehren ein zweites Jahrhundert; dann aber hatte ihn das Alter so gebeugt und gelähmt, daß ihm das Leben zur Last ward. Er berief alle Großen seines Landes, und sie kamen allesamt, und der Königsstuhl wurde aufgestellt, und seine Mannen führten ihn hin. Und er traf Bestimmungen über das Reich und die Königswürde und erteilte seinem Volke guten Rat und väterliche Ermahnung, Gott zu fürchten und die Rechte des Landes nach den alten Satzungen guter Fürsten zu gewahren.
Dann legt er sich bei hellem Tage zu Bett und gebot den Geistlichen, ihn auf die letzte Stunde vorzubereiten. Und das geschah, und dann erzählte er seinen Vertrauten alles, was sich zwischen ihm und dem Tod zugetragen hatte, und endlich sagte er: „Nun komm, Meister, und höre, wie ich mein Gebet beende; ich bin bereit.“ Und der Meister kam, und der König begann: „Vergib uns unsere Schuld“, und in dem Augenblicke, wo er das Amen sprach, schied er aus seinem Leben.
Und er wurde, obgleich er alt war, sehr beweint, und damit hat diese Geschichte ein Ende.
Märchen aus Schottland
Tom der Reimer
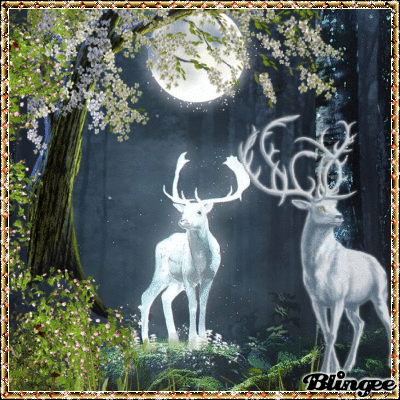
Unter alle den jungen Kämpen in Schottland war im 13. Jahrhundert keiner liebenswürdiger und gewinnender als Thomas Learmont, Herr des Schlosses von Ercildoune in Berwickshire. An einem sonnigen Maitage geschah es nun, dass Thomas die Feste Ercildoune verließ und in die Wälder wanderte, die sich am Huntly Burn entlangziehen, einem kleinen Wasser, das von den Eildon-Bergen herunterrauschte.
Es war ein lieblicher Morgen, frisch und strahlend und warm, und alles war so schön wie im Paradies. Thomas fühlte sich so glücklich inmitten der Heiterkeit, dass er sich an einer Baumwurzel auf den Boden streckte um alles Leben in seiner Nähe zu beobachten. Als er nun so lag, hörte er das Hufgetrappel eines Pferdes, das sich einen Weg durch die Büsche bahnte. Und da er hinschaute, sah er, wie die schönste Dame, die er je erblickte, auf einem grauen Zelter zu ihm herangeritten kam.
Sie trug ein Jagdgewand aus schimmernder Seide, grün wie das Frühlingsgras, und von ihren Schultern hing ein Mantel aus Samt, der aufs beste zu dem Samtrock paßte. Ihr gelbes Haar wie rieselnd Gold hing ihr lose um die Schultern, und auf ihrem Haupte funkelte ein Schmuck von kostbaren Steinen, die wie Feuer im Sonnenlicht blitzten. Ihr Sattel war aus reinem Elfenbein und ihre Decke aus blutrotem Atlas, die Gurte aus gerippter Seide und die Steigbügel aus geschliffenem Kristall. Die Zügel ihres Pferdes waren aus gehämmertem Golde, und kleine Silberglocken ließen beim Reiten die zarteste Feenmusik erklingen. Gewiß war sie auf der Jagd: Denn sie hielt ein Horn und ein Bündel Pfeile, und sie führte sieben Windhunde daher in der Koppel, während ebensoviel Spürhunde frei neben ihrem Pferde liefen. Als sie die Schlucht herunterritt, trällerte sie ein Stück aus dem alten schottischen Liede vor sich hin.
Sie trug sich mit einer so königlichen Anmut, und ihr Kleid war so herrlich, dass Thomas am Wegrand knien und sie verehren mochte, da er meinte, es wäre die Heilige Jungfrau selbst. Aber als die Reiterin auf ihn zukam und seine Absicht merkte, schüttelte sie traurig den Kopf: „Ich bin nicht die heilige Frau, wie du glaubst. Sie nennen mich Königin des Feenreiches und nicht die Himmelskönigin.“
Und sie schien recht zu haben; denn von dem Augenblick an war ein Zauber über Tom gekommen, der ihn alle Klugheit, Vorsicht und Vernunft vergessen ließ. Er wusste wohl, wie gefährlich es für die Sterblichen ist, sich mit der Fee einzulassen; aber er war so gebannt von der Schönheit der Dame, dass er sie um einen Kuß bat. Das gerade hatte sie sich gewünscht; sie wusste, küsste er sie erst einmal, so hatte sie ihn ganz in der Gewalt.
Zu des Jünglings Entsetzen kam eine schlimme Veränderung über sie, als er ihre Lippen berührte. Ihr kostbarer Mantel und seiden Reitgewand fingen an dahinzuwelken und ließen ihr nur eine lange graue Hülle, fahl wie die Asche. Ihre Schönheit schien ebenso zu vergehen, und sie wurde alt und bleich, und noch schlimmer, gar viel von ihrem reichen goldenen Haar wurde vor seinen Augen grau und stumpf. Sie bemerkte sein Erstaunen und seinen Schrecken und brach in Hohngelächter aus: „Nicht mehr bin ich so schön anzuschaun wie zuerst; aber das macht wenig aus. Du hast dich verkauft, Tom, mir sieben Jahre zu dienen. Denn wer die Feenkönigin küsst, muß ihr folgen ins Feenland und ihr dort dienen, bis die Zeit vorüber ist!
Als der arme Thomas diese Worte hörte, fiel er auf die Knie und bat um Gnade. Aber sie wurde ihm nicht gewährt. Die Elfenkönigin lachte ihm nur ins Gesicht und lenkte ihren grauscheckigen Zelter dicht an ihn heran. „Nein, nein“, hielt sie seinen Bitten entgegen, „du hast den Kuß begehrt, und nun musst du auch den Preis bezahlen. So zögere nicht länger, steige hinter mir auf; denn es ist hohe Zeit für mich zu gehen.“
So stieg Thomas mit manchem Seufzer und Schauer hinter ihr zu Pferde, und kaum saß er, so zog sie den Zügel an, und das graue Roß jagte davon. Immer weiter und weiter ging es, schneller als der Wind, sie hatten das Land der Lebenden hinter sich gelassen und kamen an den Rand einer großen Einöde, die sich vor ihnen dürr und kahl und verlassen bis zum Saum des Himmels ausdehnte. Wenigstens schien es so den müden Augen des Thomas von Ercildoune, und er sann, ob er und seine seltsame Gefährtin wohl auch durch diese Wüste müssten und ob es da ein Zurück ins Land des Lebens gäbe.
Aber die Feenkönigin straffte plötzlich die Zügel, und der graue Zelter hielt ein in seinem wilden Gang. „Nun musst du absteigen, Thomas“, sagte die Dame und schaute über die Schulter nach ihrem unglücklichen Gefangenen, „dich niederbeugen und dein Haupt auf mein Knie legen, so will ich dir verborgene Dinge zeigen, die sterbliche Blicke nicht gewahren.“ Tom stieg herunter, beugte sich nieder und lehnte sein Haupt auf das Knie der Feenkönigin, und siehe, da er wieder über die Wüste blickte, schien alles verändert. Denn er sah jetzt drei Straßen quer hindurchführen, die er vorher nicht bemerkt, und jede dieser Straßen war verschieden.
Eine von ihnen war breit, eben und gleichmäßig und verlief geradeaus durch den Sand, so dass man auf seiner Reise nicht den Weg verlieren konnte. Die zweite Straße war von der ersten so verschieden, wie sie nur sein konnte. Sie war schmal, gewunden und lang und da war ein Dornstrauch auf der einen und eine Rosenhecke auf der andern Seite, und diese Hecken waren so hoch gewachsen und ihre Zweige so wild und verflochten, dass der Reisende seine größte Mühe gehabt hätte, überhaupt seinen Weg fortzusetzen. Und die dritte Straße war wiederum keiner der beiden anderen verwandt. Es war eine wunderschöne Straße, und sie schlängelte sich aufwärts zwischen Farnen und Heidekraut und goldgelben Ginsterbüschen und sah so aus, als möchte es ein herrlich Reisen sein auf diesem Weg.
„Nun“, sagte die Feenkönigin, „wenn du willst, so werde ich dir sagen, wohin diese drei Straßen gehen. Die erste Straße ist, wie du siehst, breit und eben und mühelos, und gar viele werden sie wählen. Aber es mag auch eine gute Straße sein, sie führt doch zu einem bösen Ende, und wer sie wählt, bereut seine Wahl für immer. Und die enge Straße, die so verstrickt und verwachsen ist durch Dornen und Rosen, wird nur von wenigen gewählt und betreten werden. Wüßten sie es genau, sie würden wohl in größerer Zahl auf ihr wandeln; denn es ist die Straße der Rechtschaffenheit. Ist sie auch beschwerlich und lästig, endet sie doch in einer ruhmreichen Stadt, die da heißt die Stadt des Großen Königs.
Und dann die dritte Straße, die wunderschöne Straße, die hügelaufwärts zwischen den Farnkräutern läuft und dahin führt, wo kein Sterblicher je war, wohl weiß ich, wohin sie geht, Thomas; denn sie führt ins holde Elfenland – das ist die Straße, die wir wählen. Und merk dir, Thomas, wenn du deine Feste Ercildoune jemals wiedersehen willst, dann hüte deine Zunge, bis wir das Ende unserer Reise erreicht haben, und sprich kein einzig Wort zu irgendeinem außer mir, denn der Sterbliche, der unbesonnen im Land der Feen seine Lippen öffnet, muß dort für immer bleiben.“ Dann hieß sie ihn wieder ihren Zelter besteigen, und weiter ritten sie.
Der Weg zwischen den Farnen war allerdings nicht so einladend wie im Anfang. Denn sie waren noch nicht sehr weit geritten, als er sie in einen schmalen Hohlweg führte, der gerade unter die Erde zu gehen schien, wo ihnen kein Lichtstrahl den Pfad wies und die Luft feucht und schwer war. Überall hörte man Wasser rauschen, und schließlich geriet die graue Mähre auch mitten hinein. Und das Wasser kroch empor, kalt und frostig, zuerst an Thomas Füßen und dann über seine Knie. Sein Mut war allmählich immer mehr gesunken, seitdem sie das Tageslicht verlassen; aber jetzt gab er sich ganz verloren. Denn es schien ihm gewiß, dass seine seltsame Gefährtin mit ihm niemals wohlbehalten an das Ziel gelangen würde.
Er fiel nach vorn in tiefer Ohnmacht. Und hätte er nicht das graue Gewand der Fee fest angepackt, so wäre er sicher von seinem Sitz gerutscht und ertrunken. Aber alles, sei es gut oder böse, hat seine Zeit, und schließlich begann sich die Dunkelheit zu lichten, und die Helligkeit wurde stärker, bis sie wieder im vollen Sonnenscheine standen. Da faßte Thomas Mut und schaute auf. Und siehe, sie ritten durch einen üppigen Garten, wo Äpfel und Birnen, Datteln und Feigen und Weinbeeren in großer Fülle wuchsen. Seine Zunge war so ausgedörrt und trocken, und er fühlte sich so schwach, dass er nach einer der Früchte begehrte, um sich zu erholen.
Er reckte seine Hand, um sich eine zu pflücken, aber seine Gefährtin im Sattel wandte sich um und verbot es ihm: „ Nur einen Apfel darfst du essen, den ich dir gleich geben werde. Wenn du etwas anderes berührst, musst du für immer im Feenland bleiben.“ Der arme Thomas bezwang sich, so gut er konnte, und sie ritten langsam weiter, bis sie an ein niedriges Bäumchen kamen, das war über und über mit roten Äpfeln bedeckt. Die Feenkönigin beugte sich herab, pflückte einen und reichte ihn ihrem Gespielen.
„Diesen kann ich dir geben“, sagte sie, „und ich tue es gern; denn es sind die Äpfel der Wahrheit, und wer von ihnen isset, dessen Lippen werden nie mehr eine Lüge tun.“ Thomas nahm den Apfel und aß ihn, und für immer blieb die Gnade der Wahrheit auf seinen Lippen; darum nannte man ihn noch in späteren Jahren Tom den Wahren. Sie hatten nur noch ein kleines Stück Weges zurückzulegen, bis sie ein prächtiges Schloß erblickten, das auf einem Hügel ragte.
„Drüben ist mein Reich“, sagte die Königin und wies stolz hinüber. „Dort wohnt mein Herr und alle Vornehmen seines Hofes, und da mein Herr ein ungleich Gemüt besitzt und einem fremden Kämpen, den er in meiner Gesellschaft sieht, nicht sonderlich freundlich ist, bitte ich dich um deinet und meinetwillen, mit niemand ein Wort zu wechseln, der zu dir redet. Und sollte mich jemand fragen, war oder was du seist, so will ich ihm sagen, du wärest stumm. So wirst du unauffällig durch die Menge kommen! Mit diesen Worten setzt die Dame ihr Jagdhorn an und blies. Dabei ging ein merkwürdiger Wandel mit ihr vor: Ihr hässliches Aschengewand fiel von ihr, das graue Haar verschwand, und sie erschien wieder im grünen Reitrock und Mantel, und ihr Gesicht war jung und schön. Aber auch Thomas hatte sich wunderbar verändert: Da er zufällig heruntersah, merkte er, seine groben Kleider vom Lande hatten sich verzaubert in ein Gewand von schönem braunen Tuch, und an seinen Füßen trug er Atlasschuhe.
Sobald der Hornruf verklungen war, flogen die Tore des Palastes auf, und der König eilte der Königin entgegen in Begleitung einer großen Schar von Rittern und Damen, Sängern und Pagen; Thomas, der vom Zelter abgestiegen war, hatte keine Mühe, ihren Wünschen zu folgen und unbemerkt ins Schloß zu kommen. Jedermann schien froh, die Königin zurückzusehen, und sie versammelten sich in ihrem Gefolge im Großen Saal, und sie sprach freundlich mit ihnen allen und reichte ihnen ihre Hand zum Kuß. Dann wandte sie sich mit ihrem Gatten zu einem Hochsitz am Ende des ausgedehnten Raumes, wo zwei Thronsessel standen; darauf ließ sich das königliche Paar nieder und schaute den beginnenden Festlichkeiten zu.
Der arme Thomas stand indessen weit ab am anderen Ende des Saales, er fühlte sich sehr einsam und doch ergriffen von dem ungewöhnlichen Schauspiel, dessen Zeuge er jetzt wurde. Denn obwohl all die schönen Damen, Hofleute und Ritter in einem Teile des Schlosses tanzten, sah man in einem anderen Jäger kommen und gehen, die brachten große Hirschgeweihe, die sie auf der Jagd geschossen, und warfen sie übereinander auf den Boden. Zu Seiten der toten Tiere standen aber ganze Reihen von Köchen, schnitten sie zurecht und trugen die Stücke zum Braten fort. Das alles war ein seltsames phantastisches Bild, dass Thomas nicht darauf achtete, wie die Zeit verstrich, sondern nur stand und zusah und gaffte, ohne mit jemand ein Wort zu wechseln.
Das ging drei lange Tage so weiter, da erhob sich die Königin von ihrem Thron, schritt vom Hochsitz herunter und ging durch den Saal auf ihn zu. „Nun ist es Zeit zu satteln und zu reiten, Tom“, sagte sie, “wenn du jemals das schöne Schloß Ercildoune wiedersehen möchtest.“ Thomas blickte sie verwundert an: „Ihr spracht von sieben langen Jahren, hohe Frau, und ich bin doch erst drei Tage hier." Die Königin lächelte: „Schnell vergeht die Rast im Feenland, mein Freund. Du meinst nur drei Tage hier gewesen zu sein. Sieben Jahre ist es her, seit wir uns trafen. Und so ist es Zeit für dich zu gehen. Gern hätte ich dich noch länger bei mir gehabt, aber ich wage es nicht um deiner selbst willen. Denn in jedem siebten Jahr kommt ein böser Geist aus den Gebieten der Nacht herab zu uns und nimmt einen unserer Gefährten mit fort, wen er gerade fasst. Und da du ein stattlicher Bursche bist, könnte er am Ende gar auf dich verfallen. Es täte mir leid, wenn dir etwas zustieße, und so will ich dich schon heute nacht in dein Land zurückbringen.“
Wieder wurde der graue Zelter herbeigeführt, Thomas und die Königin stiegen auf, und wie sie gekommen waren, kehrten sie zurück zum Eildon-Baum am Huntleybach. Dann sagte die Königin Thomas Lebewohl, und als Abschiedsgabe erbat er sich etwas, an dem die Leute erkennen sollten, dass er wirklich im Feenland gewesen. „Ich habe dir schon die Gabe der Wahrheit gereicht“, erwiderte sie. „Ich will dir nun die Gaben der Verkündigungen und Dichtkunst verleihen, so dass du die Zukunft vorauszusehen und wohlklingende Verse zu schreiben vermagst. Und außer diesen unsichtbaren Gaben gehöre dir diese, den Augen der Sterblichen sichtbar. Eine Harfe, die im Feenland geschaffen. Zieh hin, mein Freund. Eines Tages werde ich vielleicht dich wiedersehen.“ Mit diesen Worten verschwand die Dame, und Thomas blieb allein; er fühlte sich, offen gesagt, ein wenig unglücklich, da er von dem strahlenden Wesen Abschied nahm und in die gewöhnlichen Gründe der Menschen sich wandte.
Danach lebte er manch langes Jahr in seinem Schlosse Ercildoune, und der Ruhm seiner Dichtung und seiner Verkündigung verbreitete sich über das ganze Land, so dass ihn die Leute Thomas den Wahren und Tom der Reimer nannten. Vierzehn Jahre gingen vorüber, und die Leute hatten schon fast vergessen, dass Thomas der Reimer je im Elfenland gewesen. Da nahte aber eine Zeit, in der Schottland und England im Kriege lagen und das schottische Heer an den Ufern des Tweed sich lagerte, nicht weit von der Festung Ercildoune. Und der Herr des Schlosses entschied sich, ein Fest zu veranstalten und alle Edlen und Herren, die das Heer führten, zu einem großen Essen einzuladen. Noch lange blieb dieses Fest in Erinnerung. Denn der Lord von Ercildoune achtete darauf, dass alles so großartig war, stand von seinem Sitze auf, nahm seine Elfenharfe und sang den versammelten Gästen ein Lied nach dem andern aus längst vergangenen Tagen. Die Gäste lauschten atemlos; denn sie ahnten, dass sie so wunderbare Musik nie wieder hören würden. Und so geschah es auch.
In der selben Nacht, als alle Edlen zu ihren Zelten zurückgekehrt waren, sah ein Soldat auf Wache im Mondlicht einen schneeweißen Hirsch und eine Hindin die Straße herabziehen, die über das Lager hinausging. So seltsam schienen die Tiere, dass er seinen Offizier herbeirief, um zuzuschauen. Und der Offizier holte seine Kameraden, und bald folgte eine ganze Schar vorsichtig den stummen Wesen, die feierlich weiterzogen, als ob sie im Maße einer irdischen Ohren nicht vernehmbaren Musik einherschritten. „Das hat Unheimliches zu bedeuten“, sagte schließlich einer der Soldaten, „wir wollen doch nach Thomas von Ercildoune schicken; vielleicht kann er uns sagen, was es auf sich hat.“ „Ja, holen wir Thomas von Ercildoune“, stimmte jeder mit ein.
So wurde eilig ein kleiner Page in die Feste gesandt, um Thomas aus seinem Schlummer zu scheuchen. Als er des Knaben Botschaft hörte, wurde des Sehers Antlitz ernst und sinnend. „Das ist ein Zeichen“, sagte er leise, „ein Zeichen von der Feenkönigin. Lange habe ich darauf gewartet, nun ist es doch eingetroffen.“ Als er hinausging, gesellte er sich nicht zu der kleinen Schar der Wartenden, sondern folgte stracks dem schneeweißen Hirsch und der Hindin. Sobald er sie erreicht hatte, hielten sie einen Augenblick ein, als ob sie ihn grüßten.
Dann stiegen alle drei langsam ein steiles Ufer hinab, dass sich am kleinen Flusse Leader hinzog, und verschwanden in seinen schäumenden Fluten; denn der Strom führte Hochwasser. Obwohl man überall sorgsam nachforschte, fand man doch keine Spur mehr von Thomas von Ercildoune. Und bis zum heutigen Tag glauben die Leute auf dem Lande, dass der Hirsch und die Hindin Boten der Elfenbeinkönigin gewesen und er mit ihnen ins Feenland zurückgekehrt.
Märchen aus Schottland
Die drei Witwen
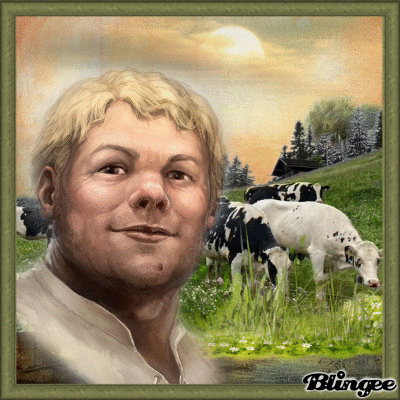
Es waren einmal drei Witwen, und jede von ihnen hatte einen Sohn. Domhnull hieß einer dieser Söhne. Er hatte vier junge Ochsen, und die beiden anderen hatten jeder nur zwei. Immer stritten sie sich darüber; man warf ihm vor, er hätte mehr Gras als die anderen. In einer finsteren Nacht gingen sie hinaus auf die Weide, griffen zu Domhnulls Ochsen und töteten sie. Als Domhnull wach wurde und nach seinem Ochsen sehen wollte, fand er sie dort tot daliegen. Da zog er ihnen die Haut ab, salzte sie ein und nahm eins der Felle mit in die große Stadt, um es zu verkaufen.
Der Weg war so lang, dass ihn die Nacht überraschte, bevor er die Stadt erreicht hatte. Er schlug sich seitwärts in einen Wald und deckte sich das Fell über den Kopf. Da kam ein Schwarm Vögel und setzte sich auf das Fell. Er streckte seine Hand aus und griff einen von ihnen. Bei Tagesdämmerung ging er weiter. Er begab sich zu dem Hause eines begüterten Mannes. Der Mann kam an die Tür und fragte ihn, was er denn da in seinem Ochsenfell hätte. Er antwortete, er hätte einen Wahrsager darin. „Was kann er denn prophezeien?“ „Alles, was ihr wollt!" , sagte Domhnull. „Dann laß ihn mal wahrsagen“, meinter der Mann.
Er ging hin und drückte den Vogel, und der zirpte schrill auf. „Was sagt er?“, fragte der Mann. „Er sagt, du wolltest ihn kaufen und zweihundert Pfund dafür zahlen“, sagte Domhnull. „Allerdings, das stimmt ohne Zweifel. Und wenn er wirklich wahrsagen kann, dann will ich das schon für ihn zahlen“, sagte der Mann. So kaufte also der Mann Domhnull den Vogel ab und gab ihm zweihundert Pfund dafür. „Aber verkauft ihn ja nicht weiter; es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich selbst ihn mir einmal wieder hole, Ich würde ihn Euch nicht für dreitausend Pfund lassen, wenn ich nicht gerade in großer Not wäre.“ Domhnull ging heim; der Vogel weissagte fortan aber keinen Pfifferling mehr.
Als er sich an sein Mahl machte, fing er an, sein Geld zu zählen. Wer sah da zu? Die, welche die Ochsen getötet hatten. Sie traten ein.
„Ah, Domhnull“, staunten sie, „wie bist du zu alledem Geld gekommen, das hier liegt?“ „Auf eine Weise, die es euch auch leicht machen würde. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr meine Ochsen umgebracht habt“, sagte er. „Drum schlachtet auch eure Ochsen, zieht sie ab und nehmt die Felle mit in die große Stadt und ruft aus: „Wer will ein Ochsenfell kaufen?“, und ihr werdet das Geld nur so scheffeln.“ Sie schlugen ihre Ochsen tot und zogen sie ab. Sie begaben sich mit den Fellen in die große Stadt und riefen aus: „Wer will einen Ochsen kaufen?“ Sie trieben dies Geschäft den ganzen Tag lang. Als aber die Leute müde wurden, sich über sie lustig zu machen, kehrten sie heim. Nun wussten sie nicht, was sie angeben sollten. Sie waren ärgerlich wegen der Ochsen, die sie geschlachtet hatten.
Da sahen sie Domhnulls Mutter zum Brunnen gehen, fielen über sie her und erwürgten sie. Als Domhnull sich sorgte, weil seine Mutter so lange ausblieb, sah er sich nach ihr um und suchte sie. Er machte sich auf zum Brunnen und fand sie dort tot vor. Er wusste nicht, was er tun sollte. Dann schleppte er sie mit ins Haus. Am Morgen steckte er sie in die besten Kleider, die sie besaß, und nahm sie mit in die große Stadt. Er ging hinaus bis zum Hause des Königs und trug sie vor sich hin. Dort kam er an einen großen Brunnen.
Dann steckte er seinen Stock am Brunnenrand und stellte sie mit der Brust gegen den Stock. Er ging nun an die Pforte, klopfte an, und die Magd eilte herunter. „Sage dem König“, richtete er aus, „da unten steht eine ehrwürdige Frau und möchte mit ihm verhandeln.“ Die Magd bestellte es dem König. „Sage ihm, er soll sie herüberholen“, meinte der König: „Der König trägt dir auf, du sollst sie herüberholen“, sagte die Magd zu Domhnull. „Ich gehe nicht hin. Geh nur selbst, ich bin zu müde!“ Die Magd ging noch einmal zum König, um ihm zu sagen, dass der Mann sich nicht im geringsten rühren wolle. „Dann geh eben selbst“, erwiderte der König.
„Wenn sie dir nicht antworten will, musst du sie anstoßen; sie ist krank“, sagte Domhnull zu der Magd. Die kam bei der Alten an. „Gute Frau“, so redete die Magd sie an, „der König heißt Euch herüberkommen.“ Sie rührte sich nicht. Das Mädchen stieß sie an, aber sie sprach kein Wort. Domhnull sah, wie es herging. „Nehmt ihr den Stab vom Leibe“, sagte Domhnull, „sie ist wohl eingeschlafen.“ Die Magd tat es, und die Alte polterte kopfüber in den Brunnen. Da schrie er los: „O bei meinem Vieh! Meine Mutter ist im Brunnen ertrunken! Was soll ich nun tun?“ Dann schlug er die Hände gegeneinander und stimmte solch ein Geheule an, dass man es drei Meilen im Umkreise vernehmen konnte.
Der König kam heraus. „Oh, mein Junge, sei nur still von der Sache, dann will ich dir auch deine Mutter bezahlen. Wieviel verlangst du denn für sie?“ „Fünfhundert Pfund“, sagte Domhnull. „Du hast sie in einer Minute“, versicherte der König. Domhnull bekam seine fünfhundert Pfund. Er ging dahin, wo seine Mutter war. Er zog ihr die Kleider ab, die sie anhatte, und warf sie dann in den Brunnen.
Als er nach Haus kam, zählte er sein Geld. Sie stellten sich auch wieder ein, die beiden andern, und wollten sehen, ob er seine Mutter beweinte. „Wo hast du denn all das Geld her?“ „Ich hab es da bekommen, wo ihr es auch bekommen könnt, wenn ihr den Mut dazu habt“, sagte er. „wie sollen wir das machen?“ "Bringt eure Mütter um und nehmt sie dann mit in die große Stadt und ruft aus: „Wer will tote alte Weiber kaufen?“ Und ihr werdet ein Vermögen zusammenhäufen.“ Als sie das hörten, gingen sie heim, und jeder von ihnen schlug mit einem Stein in einem Strumpf so lange auf seine Mutter los, bis sie tot war.
Am anderen Morgen zogen sie in die große Stadt. Sie riefen auch wirklich: „Wer will tote alte Weiber kaufen!“ Aber da fand sich niemand, der so etwas haben wollte. Und als die Leute müde wurden, sich über sie lustig zu machen, hetzten sie ihre Hunde auf sie und jagten sie nach Hause. Als sie in der Nacht heimkamen, legten sie sich hin und schliefen. Am nächsten Morgen aber, da sie erwacht, gingen sie zu Domhnull, packten ihn und steckte ihn in ein Faß. Das nahmen sie dann mit, um es von einer Felsspitze hinabzustürzen. Sie machten sich daran und brauchten dazu eine recht lange Zeit.
Da sagte der eine zum andern: „Der Weg war so lang und das Wetter war so heiß, da sollten wir erst einen Schnaps trinken.“ Sie kehrten ein und ließen ihn in seinem Faß draußen auf der Landstraße. Da hörte er ein Trippeltrappeln herannahen, und wer sollte das sein, wenn nicht der Schäfer mit hundert Schafen. Da machte er sich flugs daran und blies ein Stückchen auf der Maultrommel, die er bei sich hatte, in seinem Faß. Der Schäfer schlug mit seinem Stock gegen das Faß. „Wer ist denn da drin“, rief er. „Ich bin’s“, sagte Domhnull. „Was machst du denn da drin?“, meinte der Schäfer. „Ich mache mein Glück“, frohlockte Domhnull, und nie hat man mehr Gold und Silber an einem Fleck gesehen. Ich habe schon tausend Börsen vollgestopft, und mein Glück ist beinah vollkommen.“
„Es ist aber schade“, sagte der Schäfer, „dass du mich nicht auch ein Weilchen hereinlassen willst.“ „Nein, das tue ich nicht. Ich brauche alles für mich!“ „Willst du mich denn wirklich nicht hereinlassen? Nicht eine Minute lang? Du hättest doch trotzdem genug!“ „Bei der Schrift, armer Mann, da es dir schlecht geht, will ich dich einlassen. Hebe mal den Deckel vom Faß herunter und komm her. Aber lange darfst du nicht drinbleiben“, sagte Domhnull. Der Schäfer nahm den Deckel ab, und er schlüpfte heraus. Er packte den Schäfer an den Beinen und steckte ihn mit dem kopf voran in das Faß. „Hier ist weder Gold noch Silber“, wandte der Schäfer ein. „Du wirst auch erst dann etwas sehen, wenn der Deckel auf dem Faß ist“, sagte Domhnull. „Ich sehe auch nicht den leisesten Schatten hier drin“, jammerte der Schäfer. „Wenn du nichts siehst, so ist das deine Sache“, erwiderte Domhnull.
Damit ging er von dannen, legte den Umhang an, den der Schäfer gehabt hatte, und da er das getan, folgte ihm auch der Hund. Da kamen die anderen aus der Wirtschaft, griffen das Faß an und hoben es auf ihre Schultern. Dann zogen sie los. Der Schäfer stammelte nun jede Minute: „Ich bin drin – ich bin’s ja!“ „Gewiß, du Schurke; gewiß bist du’s!“, höhnten sie. Sie erreichten die Felsspitze und ließen das Faß mit dem Schäfer hinunterrollen.
Als sie sich umwandten, wen sahen sie da? Domhnull mit Umhang und Hund und inmitten einer Herde von hundert Schafen. Sie gingen zu ihm hinüber. „Oh, Domhnull“, riefen sie, „wie bist du denn hierhergekommen?“ „Grad so, wie ihr hierherkommen könnt, wenn ihr’s versuchen wollt! Als ich nämlich da drüben angelangt war, sagte man mir, ich hätte noch genügend Zeit, und brachte mich wieder hier rüber und gab mir hundert Schafe dazu, damit ich mein Glück machen könnte.“ „Und würde man uns das gleiche tun, wenn wir hingingen?“, sagten sie. „Das täte man. Ja ganz gewiß täte man’s!“ stimmte Domhnull zu. „Aber wie könnten wir da hingelangen?“, meinten sie. „Grad auf dem gleichen Wege, wie ihr mich hinübergeschickt“, sagte er.
Sie gingen also und trieben zwei Fässer auf und stiegen hinan. Oben aber kroch der eine hinein, und der andere schickte ihn den Fels hinunter. Jener aber brüllte auf, als er sich unten das Gehirn
zerschlug. Der andere fragte Domhnull, was der gerufen habe. Er rief: „Rinder und Schafe, Geld und Gut“, sagte Domnhull. „Dann runter mit mir, runter mit mir!“, eiferte der andere. Er kroch nicht
einmal in das Faß hinein. Er schoß kopfüber nach unten und brach sich den Schädel.
Domhnull aber kehrte heim und behielt nun ihr Land für sich.
Märchen aus Schottland
Pwyll, Prinz von Dyved

Pwyll, Prinz von Dyved, war Herrscher über sieben Cantrevs von Dyved. Nun geschah es einst, daß er sich in seinem wichtigsten Schloß zu Arberth aufhielt und ihn die Lust ankam, zu jagen. Jener Teil seines Reiches aber, wo es ihm zu jagen gefiel, hieß Glynn Cuch. Er brach am Abend von Arberth auf und ritt bis nach Penn Llwyn auf Bwya. In dieser Nacht verweilte er dort. Zeitig am Morgen stand er auf und kam nach Glynn Cuch. Dort hieß er die Hunde losmachen und das Horn blasen. Die Jagd begann.
Als er nun den Hunden folgte, wurde er von seinen Gefährten getrennt. Als er dem Bellen seiner Koppel aufhorchte, hörte er, daß noch andere Hunde anschlugen. Sie kamen offenbar aus der entgegengesetzten Richtung. Er befand sich auf einer Lichtung im Wald, und als seine Meute den Rand dieser Lichtung erreichte, sah er die anderen Hunde, die einen Rehbock verfolgten. Und sieh an, etwa in der Mitte der Lichtung holte die andere Koppel den Rehbock ein und warf ihn zu Boden. Pwyll fiel die Farbe der Hunde ins Auge. Auf den Rehbock achtete er nicht weiter. Die Hunde hatten glänzendes Fell und rote Ohren, und beide Farben leuchteten weithin. Er ritt nun heran, jagte die fremden Hunde von dem Wild fort und hetzte die seinen darauf.
Da kam ein Reiter auf ihn zu. Er ritt eine hellgraue Stute, hatte ein Jagdhorn um den Hals und trug Kleider aus grauer Wolle, in der Art, wie man sie zur Jagd anlegt. Der Reiter ritt nahe an ihn heran, und sprach: „Häuptling, ich weiß nicht, wer Ihr seid, aber grüßen will ich Euch nicht.“ „Nun“, erwiderte Pwyll, „Ihr seht so würdig aus. Ihr solltet auch so handeln.“ „Wahrlich, es ist nicht mein Rang, der mich hindert.“ „Aber was ist es denn, Häuptling?“ fragte Pwyll, „seid Ihr so unwissend, oder kennt Ihr keine Höflichkeit?“ „Beim Himmel“, sagte der Fremde, „Eure Grobheit und Eure Unhöflichkeit sind die Ursache.“ „Welcher Unhöflichkeit habe ich mich denn schuldig gemacht?“ „Ist es nicht etwa unhöflich, meine Meute fortzuscheuchen, damit das Fleisch Euren Hunden zur Beute wird? Ich werde keine Rache nehmen, aber ihr seid in Unehre, und müsste sie beziffert werden, so ginge es um den Wert von hundert Rehböcken.“
„Häuptling“ sprach Pwyll, „wenn ich Euch gekränkt habe, so verzeiht mir bitte. Ich will versuchen, Eure Freundschaft zu gewinnen.“ „Und wie wollt Ihr Eure Verfehlung wiedergutmachen?“ „Vielleicht gemäß dem Rang, den ihr bekleidet...nur ich weiß nicht, wer Ihr seid.“ „Ich bin in meinem Land ein ungekrönter König.“ „Herr, möge Euer Tag angenehm vergehen“, sprach Pwyll, „aber nun sagt doch, aus welchem Land Ihr kommt?“ „Aus Annwvyn“, antworte er, „ich bin Arawn, ein König in Annwvynn.“ „Und wie Herr, kann ich Eure Freundschaft gewinnen?“
„Es gibt da einen Mann, Havgan, König in Annwvynn, dessen Reich dem meinen gegenüber liegt, und der führt ständig Krieg gegen mich. Wenn du den Gewalttaten, die er mir zufügt, ein Ende machst, hast du meine Freundschaft gewonnen.“ „Das will ich mit Freuden tun“, sagte Pwyll, „zeigt mir wie das geschehen kann,“ „Hör zu“, sagte Arawn, „wir werden einen starken Freundschaftspakt miteinander abschließen, und ich werde dich an meiner Statt nach Annwvynn schicken. Ich werde dir die schönste Frau zur Seite tun, die du je gesehen hast. Ich will dir meine Gestalt und mein Aussehen geben und zwar genau so, daß kein Kammerdiener, kein Rat und kein Ritter merken wird, daß nicht ich es bin, der mit ihnen umgeht, sondern du. All dies soll gelten für ein Jahr von morgen an.“
„Gut und schön“, sagte Pwyll, „aber ich wenn ich mich in deinem Land aufhalte, wie werde ich den Mann finden, von dem du sprichst?“ „In einem Jahr von heute an“, sprach Arawn, „wollen er und ich uns an dieser Furt treffen. Reite du an meiner Stelle hin. Versetzte ihm einen Hieb. Er wird davon tödlich getroffen werden. Aber wenn er dich darum bittet, ihm noch einen Schlag zu versetzen, so laß dich nicht darauf ein, was immer er dir verspricht. Mich hat er dazu gebracht, und am nächsten Tag war er im Kampf so kräftig wie zuvor.“ „Nun gut“, sagte Pwyll, „aber was soll mit meinem Königreich geschehen?“ Sprach Arawn: „Ich werde es so einrichten zu wissen, daß kein Mann oder Weib herausfindet, daß nicht du es bist, sondern ich, der dort regiert.“
„Dann will ich gerne gehen“, sagte Pwyll. „Möge deine Reise frei von Mühen sein.
Nichts soll sich dir in den Weg stellen, wenn du in mein Reich reitest. Ich selbst werde dich geleiten.“ Und Arawn führte dann Pwyll bis zu einer Stelle, von der aus man das Schloß und die
dazugehörigen Gebäude sehen konnte. „Sieh“, sagte er, „der Hof und das Königreich sind in deine Gewalt gegeben. Jeder dort wird auf deine Befehle hören, und wenn du dir ein wenig Mühe gibst,
wirst du bald mit den Sitten und Gewohnheiten der Leute vertraut sein.“
Pwyll ritt also gegen das Schloß hin, und als er drinnen war, fand er Wohnungen, Hallen und Kammern, so schön und bequem, wie er sie nie zuvor gesehen hatte. Er betrat die Halle und dachte daran, sich umzukleiden. Pagen und Diener erschienen, zogen ihm die Stiefel aus, und alle grüßten ihn. Zwei Ritter kamen und nahmen ihm die Jagdkleidung ab und brachten bequeme Hauskleidung aus Brokat. Dann wurde die Halle gerichtet. Er sah die Angestellten des Hofes und die Soldaten hereinmarschieren. Es waren die besten Truppen, die er je gesehen hatte. Und mit ihnen erschien die Königin. Eine schönere Frau war ihm nie zu Gesicht gekommen. Sie trug ein Kleid aus glänzender gelber Seide. Alle wuschen sich und setzten sich, und die Königin saß ihm zur Seite, und ein Graf hatte auf der anderen Seite Platz genommen.
Pwyll begann mit der Königin zu reden, und von allen Frauen, mit denen er sich unterhalten hatte, besaß sie die natürlichsten Umgangsformen. Sie war liebenswürdig und geistreich im Gespräch. So verging die Zeit mit Essen, Trinken, Singen und Feiern, und von allen Höfen, die er je gesehen hatte, gab es an diesem die meisten goldenen Teller und die kostbarsten Juwelen. Als es nun Zeit wurde, schlafen zu gehen, legte sich Pwyll und die Königin ins Bett. Sobald sie aber beieinander lagen, wandte er sein Gesicht zur Bettkante und ihr den Rücken zu und sprach mit ihr kein einziges Wort, bis zum nächsten Morgen. Bei Tag war er wieder freundlich und zuvorkommend mit ihr. Wie freundlich er aber auch bei Tag war, in den Nächten, die folgten, verhielt sich Pwyll nie anders als in jener ersten Nacht.
Das Jahr verging mit Jagen, singen und Festen mit Freunden und unter angenehmen Gesprächen mit den Rittern bei Hofe, bis jene Nacht des Treffens kam, an die sich selbst die Leute in entlegensten Teilen des Landes zu erinnern wissen. Pwyll wurde von den Adligen des Landes begleitet, und als sie an die Furt kamen, zeigte sich dort ein Ritter, der sprach also: „Ihr Edlen, hört gut zu. Dieser Kampf soll ausgetragen werden im Kampf der zwei Könige, Mann gegen Mann, denn jeder von ihnen beansprucht, das Reich und die Herrschaft. Deshalb trete jeder andere nun beiseite.“ Darauf ritten die beiden Könige an und trafen sich in der Mitte der Furt.
Beim ersten Angriff schlug der Mann, der an Arawns Stelle focht, Havgans Schild in zwei Hälften; Havgans Rüstung barst, und er selbst wurde eine – Arm- und Speerlänge weit über das Hinterteil eines Pferdes fort zu Boden geschleudert und blieb dort tödlich verwundet liegen. „O Häuptling“, sagte Havgan, „was für ein Recht hast du, mich zu töten? Ich habe dir kein Leid zugefügt, noch wüsste ich sonst keinen Grund, weshalb du mich töten solltest. Aber um der Liebe des Himmels, da wir diesen Kampf nun einmal begonnen haben, mach ein Ende mit mir.“ „Häuptling“, antwortete Pwyll, „wenn ich so handle, könnte ich es bereuen. Erschlage dich, wer da will. Ich werde es nicht tun.“
„Meine Getreuen“, rief Havgan, „tragt mich jetzt fort, denn mein Ende ist nun gewiß. Ich kann nicht länger euer Schutzherr sein.“ „Ihr Herren“, rief darauf jener, der an Arawns Stelle kämpfte, „besprecht euch und überlegt, ob ihr nicht zu mir übertreten wollt.“ Und sie antworteten: „Das wollen wir. Es gibt keinen König außer euch in Annwvyn.“ „Gut denn“, antwortete er, „jene, die sich unterwerfen, sollen mir willkommen sein. Jene aber, die sich weigern, sollen mit dem Schwert dazu gezwungen werden.“ Da huldigten ihm diese Männer, und er begann in dieses Land einzudringen, und am Mittag des folgenden Tages waren beide Reiche vereinigt unter seiner Herrschaft. Sein Versprechen hielt er und kam darauf nach Glynn Cuch.
Als er nun dort hin kam, wartete Arawn schon auf ihn, und beide freuten sich wiederzusehen.„Wahrlich“, sprach Arawn, „möge dich der Himmel für deinen Freundesdienst an mir belohnen. Ich habe von allem gehört. Wenn du in dein Reich kommst, wirst du sehen, was ich für dich getan habe.“ „was immer du getan hast“, erwiderte Pwyll, „möge der Himmel es dir lohnen.“ Dann gab Arawn durch Zauber Pwyll seine rechte Gestalt und sein Aussehen wieder und nahm seinerseits seine ursprüngliche Gestalt an, und Arawn brach auf zum Hof von Annwvyn. Freude überkam ihn, als er sein Heer und sein Haushalt wieder vor sich sah. Alle hatte er so lange nicht gesehen, aber sie hatten von seiner Abwesenheit nichts bemerkt und waren von seiner Ankunft nicht erstaunter als gewöhnlich.
Er verbrachte den Tag in Gesprächen mit seinem Weib und seinen Rittern, und als es Zeit wurde, dem Trinken und Vergnügen ein Ende zu machen, ging er zu Bett. Da kam seine Frau zu ihm und sogleich begann er mit ihr zu reden, nahm sie in die Arme....Das war in dem vergangenen Jahr nie geschehen und sie dachte: „Herr im Himmel, wie anders ist er doch heute als in der ganzen Zeit zuvor.“ Sie dachte lange darüber nach. Er schlief mit ihr, und danach sprach er zu ihr, aber sie gab keine Antwort....! Warum antwortest du mir nicht?“ fragte er, worauf sie sprach: „Mann kann doch wohl auch das Antworten verlernen. Du hast ein ganzes Jahr im Bett nicht mit mir gesprochen.“ „Ach was“, sagte er, „wir haben uns doch immer im Bett unterhalten.“ „Schande über mich, wenn seit einem Jahr in diesem Bett zwischen uns ein Wort gewechselt worden ist oder du mich in der ganzen langen Zeit auch nur ein einziges Mal berührt hast. In all den Nächten hast du stets mit abgewandten Gesicht geschlafen und meine Augen durften sich an deinem Rücken erfreuen.“
Da dachte Arawn bei sich: „Herr im Himmel, was für einen treuen Freund habe ich doch mit diesem Mann gewonnen.“ Und er sprach zu seinem Weib: „Liebste, zürne mir nicht, denn das ganze Jahr habe ich nicht bei dir gelegen, noch bei dir geschlafen.“ Er erklärte ihr, was sich zugetragen hatte, und sie sagte: „Dies sprech ich vor Gott, wahrlich, du musst einen starken Pakt mit diesem Mann geschlossen haben, denn dieser Mann, der an deiner Stelle hier lag, ist nie den Versuchungen erlegen. Vielmehr hat er dir unbedingt die Treue gehalten. „Weib“, sprach er darauf, „dies waren auch meine Gedanken, als ich eben schwieg.“
Unterdessen war Pwyll, Herr von Dyved in seinem Land und Königreich angekommen, und er begann, seine Ritter zu befragen, wie sie mit seiner Regierung im vergangenen Jahr im Vergleich mit anderen Jahren zuvor, zufrieden gewesen seien. „Herr“, antworteten sie, „nie war deine Klugheit ersichtlicher, nie warst du so freundlich zu uns, nie zuvor hast du großzügig so viele Geschenke an uns ausgeteilt.“ „Beim Himmel“, sprach Pwyll, „ihr sollt dafür, jenem Mann danken, der statt meiner bei euch war.“ Und er erzählte ihnen, was sich zugetragen hatte. „Danken wir Gott“, sprachen sie, „daß Ihr einen solchen Freund gewonnen habt. Denn an der Art zu regieren, wie wir im vergangenem Jahr kennengelernt haben, werdet Ihr hoffentlich auch in Zukunft nichts ändern.“ „Zwischen mir und Gott“, sagte Pwyll, „das werde ich wahrlich nicht.“
Und von da an hielten sie gute feste Freundschaft, und jeder schickte dem anderen Pferde, Windhunde und Falken und solche Schätze, von denen er annahm, daß der andere daran seine Freude hätte. Und weil er ein Jahr auf Annwvyn verbracht, das Land glücklich regiert und durch seinen Mut beide Königreiche innerhalb eines Tages vereinigt hatte, ging nun der Name Pwyll, Prinz von Dyved unter, und er wurde Pwyll, Oberhaupt von Annwvyn genannt. Einmal nun befand sich Pwyll in Arberth, seinem wichtigsten Schloß, wo ein Fest für ihn ausgerichtet war, und bei ihm war eine große Schar von Männern. Als sie sich nun von der Festtafel erhoben, unternahmen sie ein Spaziergang. Sie stiegen auf einen Hügel hinter dem Schloß, der Gorsedd Arberth genannt wird.
Da sprach einer der Männer zu Pwyll: „Herr, das hier ist ein merkwürdiger Hügel. Denn wenn jemand sich auf ihm niedersetzt, empfängt er entweder Schwertstreiche und trägt Wunden davon oder er sieht ein Wunder.“ „Nun, mit so vielen guten Rittern aus meinem Gefolge um mich“, sprach Pwyll lachend, „werden mich wohl keine Schläge treffen, und ich werde auch keine Wunde davontragen. Was aber ein Wunder angeht, so hätte ich nichts dagegen einzuwenden, eines zu erleben. Also will ich mich hinsetzen.“ Das tat er. Und als er nun da saß, sah er eine Frau auf einem großen reinweißen Pferd mit Kleidern aus leuchtendem Gold auf der Straße, die am Fuße des Hügels verläuft, vorbeireiten. Ein jeder der sie sah, meinte, das Pferd bewege sich ganz langsam fort. „Männer“, sprach Pwyll, „kennt jemand unter euch diese Frau?“ „Nein, Herr“, antworteten sie. „Dann soll einer von euch hinabsteigen und herausfinden, wer sie ist!“
Ein Mann stand auf, aber als er zur Straße kam, war die Frau schon verschwunden. Er folgte ihr zu Fuß, so rasch er konnte. Er sah sie wieder vor sich. Aber je schneller er lief, desto weiter entfernte sie sich von ihm, und als er einsah, daß es vergebliche Mühe war zu versuchen, sie noch einzuholen, kehrte er wieder um und sagte, als er vor Pwyll stand: „Herr, es ist müßig, ihr zu Fuß folgen zu wollen.“ „Nun gut“, erwiderte Pwyll, „Dann hol dir rasch ein Pferd und setz ihr nach.“
Er holte also ein Pferd und ritt ihr hinterher. Er kam auf eine offene Ebene und gab dem Tier die Sporen, aber je mehr er es antrieb, desto größer wurde der Abstand zwischen ihm und der Reiterin, obgleich ihr Pferd offenbar nicht schneller lief als zuvor. Sein Pferd wurde müde, und als es schließlich nur noch im Schritt ging, wendete er und kehrte zu der Stelle zurück, an der Pwyll wartete. „Herr“, sprach er, „es hat keinen Zweck, dieser Frau zu folgen. Ich ritt das schnellste Pferd aus unserem Stall, und es war mir damit nicht möglich, sie einzuholen.“ „Nun gut“, sprach Pwyll, „es wird wohl irgendeine verborgene Bewandtnis damit haben, lasst uns ins Schloß zurückkehren.“ So geschah es, und sie verbrachten den Tag dort und den nächsten Tag auch, bis es Zeit wurde, das Fleischgericht zu essen.
Nach dem ersten Gang sagte Pwyll: „Nun sollen alle, die gestern auch mit dabei waren, mich zum Hügel begleiten. Und du“, sagte er zu einem jungen Burschen, „hol das schnellste Pferd von der Weide.“ Das tat der junge Mann. Sie bestiegen den Hügel und führten das Pferd mit sich, und als sie oben saßen, sahen sie wider die Frau auf dem selben Pferd und im selben Gewand auf der Landstraße daherreiten. „Schau an“, sagte Pwyll, „da ist sie wieder. Mach dich bereit, Junge, und finde heraus, wer sie ist.“ „Gern, Herr“, rief der Junge. Die Frau ritt unmittelbar am Fuße des Hügels dahin, etwa auf der gleichen Höhe mit ihnen. Der Junge sprang in den Sattel, aber ehe er anreiten konnte, lag schon wieder ein beträchtlicher Abstand zwischen der Gruppe der Männer auf dem Hügel und der Reiterin. Zuerst trieb er sein Pferd nicht übermäßig an, denn es schien ganz leicht, sie einzuholen. Aber das war eine Täuschung.
Als er aber nun rasch ritt, kam er ihr auch nicht näher, als wenn er ihr zu Fuß gefolgt wäre. Da machte er kehrt, kam vor Pwyll und sprach: „Herr, dieses Pferd, auf dem ich sitze, ist ausgezeichnet gegangen, aber es ist sinnlos, Die Reiterin vermag niemand einzuholen. „Seltsam“, sagte Pwyll, „mir kommt es so vor, als wolle sie uns auf sich aufmerksam machen. Laßt uns ins Schloß zurückkehren.“ Das taten sie und verbrachten die Nacht mit Singen, Erzählen und Gesprächen und fuhren fort damit am nächsten Tag, und als sie beim Essen das Fleisch verzehrt hatten, sagte Pwyll: „Wo sind die Männer, die gestern und am Tag zuvor mit auf dem Hügel gewesen sind?“ „Hier sind wir, Herr!“ „Dann lasst uns jetzt nocheinmal hinaufsteigen und uns dort hinsetzen. Und du“, sagte Pwyll zu dem Stallburschen, sattle mir mein Pferd, halt es am Rand der Landstraße bereit und bring auch die Sporen mit.“ Das tat der Junge. Die Männer aber erklommen den Hügel, setzten sich und sahen kurz darauf die Reiterin auf der Landstraße herankommen, in derselben Kleidung und in derselben Gangart reitend wie an den Tagen davor. „Junge“, rief Pwyll, „jetzt gilt es. Rasch, mein Pferd.“
Er rannte den Abhang hinunter, schwang sich in den Sattel, aber kaum saß er auf dem Rücken des Pferdes, da war die Frau auch schon bei ihm vorbei. Er trieb sein Pferd an und setzte ihr nach, und es schien ihm, als könne er sie auf kurz oder lang überholen. Doch der Abstand zwischen ihr und ihm verringerte sich nicht. Er gab seinem Pferd die Sporen, und nun merkte er, daß der Abstand sogar noch größer wurde...Da rief er: „Mädchen, im Namen dessen, den Ihr am meisten liebt, wartet auf mich.“ „Ich habe einen Auftrag“, sagte sie, „und ich bin froh, daß ich Euch treffe.“ Das Mädchen hielt inne, und sie hob den Schleier, der vor ihrem Gesicht hing. „Ich heiße Euch willkommen“, sagte Pwyll und es kam ihm vor, als habe er nie ein schöneres Mädchen oder eine schönere Frau zu Gesicht bekommen.
„Erzählt mir von Eurem Anliegen.“ „Zwischen mir und Gott. Mein wichtigstes Anliegen war, Euch zu treffen.“ „Das ist Euch gelungen. Sagt mir bitte Euren Namen?“ „Auch das will ich gerne tun“, sagte sie, „ich bin Rhiannon, die Tochter des Heveydd Hen, und sie versuchten, mir einen Gatten wider Willen aufzuzwingen. Aber ich will ihn nicht zum Manne, weil ich Euch liebe. Und wenn Ihr mich abweist, will ich gar keines Mannes Weib werden. Um Eure Antwort zu hören, bin ich hergekommen.“ „Beim Himmel“, sagte Pwyll, „hier ist meine Antwort. Könnte ich unter allen Mädchen und Frauen der Welt wählen, ich würde mich für Euch entscheiden.“ „Nun, wenn so Euer Sinn steht“, erwiderte sie, „dann gebt mir Euer Wort, mich zu treffen, ehe ich an einen anderen gegeben werde.“ „Je früher desto besser“, sagte Pwyll, „und den Ort, an dem ich Euch treffen soll, mögt Ihr selbst festsetzen.“ „Gut, kommt heute in einem Jahr in Heveydds Palast. Ich will dafür sorgen, daß zu Eurem Empfang ein Fest ausgerichtet wird.“ „Frohen Herzens will ich diese Verabredung einhalten“, sagte Pwyll. „Lebt wohl, mein Herr, und vergißt nicht, was Ihr versprochen habt. Ich muß jetzt fort.“ So schieden sie, und er kehrte zurück zu den Rittern und den Männern seines Gefolges.
Wann immer aber jemand nach dieser Frau fragte, verstand er es, das Gespräch auf etwas zu bringen. Das Jahr verging, und als die rechte Zeit da war, hieß er hundert Ritter sich wappnen, und ihn zum Palast Heveydd Hen folgen. Dort wurden sie mit großer Freude empfangen. Die Vorbereitungen für das Fest waren alle getroffen. Die Halle war gerichtet. Sie traten ein und setzten sich. Heveydd saß auf der einen Seite und Pwyll und Rhiannon auf der anderen, und alle bekamen einen Platz gemäß ihrem Rang. Sie aßen und tranken, und unterhielten sich, und als sie nach dem ersten Gang zu zechen begannen, sahen sie einen großgewachsenen Mann mit kastanienbraunes Haar in Seidenkleidern die Halle betreten. Er kam zum oberen Ende der Tafel und begrüßte dort Pwyll und seine Gefährten.
„Gottes Gnade mit Euch, Freund“, rief Pwyll ihm zu, „kommt, setzt Euch zu uns.“„Das werde ich nicht tun, denn ich bin ein Freier und habe einen Auftrag.“ „Dann sprecht nur offen heraus“, sagte Pwyll. „Nun, Herr, mein Auftrag betrifft Euch. Ich erbitte, daß ihr Euch zu etwas verpflichtet.“ „Was immer Ihr auch bittet, sofern es in meiner Macht liegt, soll Euer Wunsch erfüllt werden.“ „Ach, wie konntet Ihr nur so leichtsinnig sein“, rief Rhiannon dazwischen. „Alle hier an der Tafel haben gehört, daß mir ein Wunsch zusteht“, rief der junge Mann. „Bei meiner Seele“, also was verlangt Ihr?“ „Die Frau, die ich vor allen anderen liebe, soll Euch heute Abend zur Braut gegeben werden. Ich wünsche mir, daß Ihr sie an mich abtretet.“ Pwyll hatte es die Sprache verschlagen. „Ja, schweigt nur so lange Ihr wollt“, sagte Rhiannon, „nie machte ein Mann schlechteren Gebrauch von seinem Verstand als Ihr.“ „Frau“, erwiderte Pwyll, „ich wusste nicht, wer er war.“
„Dann wißt jetzt, das dies der Mann ist, den ich gegen meinen Willen heiraten soll. Er heißt Gwawl, Sohn des Clud, eines mächtigen Fürsten, der über alle Ritter gebietet. Da Ihr ihm Euer Wort gegeben habt, muß ich nun wohl oder übel in die Hochzeit einwilligen, wenn nicht Schande über Euch kommen soll.“ „Frau“, sagte er, „ich begreife nicht, wie Ihr so reden könnt. Nie werde ich zulassen, was Ihr da vorschlagt.“ Sagt ihm nur zu“, sprach sie, „ich will es schon einzurichten wissen, daß ich nie sein werde.“ „Aber wie sollte das zugehen?“ fragte Pwyll. „Ich werde Euch einen kleinen Sack geben, den Ihr immer behalten müsst. Der Mann wird Euch bitten, das Fest auszurichten, aber eben das steht nicht in Eurer Macht. Ihr könnt es ihm nicht versprechen, denn es ist Sitte, daß die Braut das Bankett ausrichtet. In diesem Sinn müsst Ihr ihm antworten. Ich aber will ihm versprechen, seine Braut zu werden, auf den Abend genau in zwölf Monaten.
Am Ende dieses Jahres müsst auch Ihr zur Stelle sein. Bringt auch diesen Sack mit und hundert Ritter, die laßt ihm Obstgarten hinter der Halle warten. Wenn Gwawl mitten beim Essen und Zechen ist, müsst Ihr in schäbigen Kleidern mit dem Sack in der Hand eintreten und ihn bitten, Euch diesen Sack mit Speisen zu füllen. Ich will aber durch Zauber dafür sorgen, daß er niemals voll wird, und würde man alle Speisen und Getränke aus sieben Cantrevs zusammengetragen. Nachdem schon viel hineingefüllt ist, wird Gwawl Euch fragen, ob denn dieser verdammte Sack niemals voll werde. Dann müßt Ihr ihm erklären, daß ein Mann von edler Herkunft in den Sack steigen und die Speisen mit beiden Füßen herunterdücken müsse. Und dabei soll er sagen: „Jetzt ist es genug, Sack!“
Ich werde Gwawl überreden, dieses Gebot zu erfüllen. Kommt er nun, um die Bedingung zu erfüllen, so streift Ihr ihm den Sack rasch über den Kopf und bindet ihn oben ab. Ihr müsst ein Jagdhorn bei Euch tragen. Und ist Gwawl erst im Sack geschnürt, so gebt Ihr damit den Rittern draußen ein Zeichen. Darauf stürmen sie in den Saal und hauen auf den Sack solange ein, bis Gwawl um Gnade bittet oder aber zu Tode kommt.“ „Herr“, sprach Gwawl, meint Ihr auch, daß es längst an der Zeit wäre, auf meine Bitte zu antworten?“ Pwyll sprach: „Von dem, was du erbeten hast, soll das geschehen, was in meiner Macht steht.“ „Freund“, sagte Rhiannon, „was dieses Fest betrifft, so ist es zu Ehren der Männer aus Dyved veranstaltet worden. Somit kann es auch niemand anderem gewidmet sein als ihnen. Aber in einem Jahr, auf den Abend genau, will ich an diesem Hof ein Fest für Euch, mein Freund, ausrichten, und danach will ich Eure Braut werden.“
Gwawl zog fort, in das Land, das er besaß, und Pwyll kehrte nach Dyved zurück, und beide verbrachten sie das ganze Jahr damit, ungeduldig auf das Fest von Heveydd, dem Alten, zu warten. Gwawl, Sohn des Clud, brach zu dem versprochenen Fest auf, und als er am Hof eintraf, wurde er freundlich empfangen. Pwyll aber kam in den Obstgarten mit seinen hundert Rittern und seinem Sack, gerade so, wie ihn Rhiannon geheißen hatte. Er trug schäbige Kleider und zerfetzte Stiefel an den Füßen. Als er nun hörte, daß die da drinnen den ersten Gang schon verspeist hatten, betrat er die Halle, ging zum oberen Ende der Tafel und begrüßte Gwawl und dessen Begleiter. „Gott mit dir“, sagte Gwawl, „seinen Segen auf dich.“ „Gott soll Euch danken“, sprach Pwyll, „ich bin ein Bettler.“
„Deine Bitte soll erfüllt werden, wenn sie nicht gar zu unbescheiden ist.“ „Ganz und gar nicht unbescheiden, Herr. Laßt nur diesen kleinen Sack hier für mich mit Nahrung füllen.“
„Wirklich eine bescheidene Bitte. Ich will sie gern erfüllen. Bringt Speisen!“ rief Gwawl. Zahlreiche Diener eilten herbei und fingen an, den Sack zu füllen, aber wie viel sie immer auch hineinwarfen, er wurde nicht voll. „Bettler, was hast du für einen seltsamen Sack?“ fragte Gwawl.“ Zwischen mir und Gott, er füllt sich immer nur dann, wenn ein Mann, der auch Land besitzt, die Speisen mit beiden Füßen niedertritt und spricht: „Jetzt ist es genug Sack!“ „Tut doch das, Freund“, forderte Rhiannon Gwawl auf, „damit wir endlich mit dieser Sache zu Ende kommen.“ „Ei, warum denn nicht“, sagte Gwawl und stand auf.
Sofort aber warf ihm Pwyll den Sack über den Sack, und band ihn oben zu und blies in sein Jagdhorn. Da stürzten seine Ritter aus dem Obstgarten herein und ergriffen alle Krieger, die mit Gwawl gekommen waren, während Pwyll seine zerlumpten Kleider fortwarf und seine zerrissenen Stiefel auch.
Im Hereinstürmen aber schlug jeder von Pwylls Männer auf den verknoteten Sack und fragte: „Was ist das nur?“ „Ein Dachs“, antworteten die anderen. Und die hinterdreinkamen hielten es für ein Spiel. Jeder Mann trat mit den Fußsohlen auf den Sack oder hieb mit einem Knüppel darauf, und während er es tat, fragte er: „Was ist das für ein neues Spiel, das hier gespielt wird?“ Die anderen antworteten dann: „Das ist das Spiel vom Dachs und dem Sack.“ „Herr rief Gwawl unter dem Sacktuch hervor, „wenn Ihr mir nur einen Augenblick Gehör schenken wolltest. In einem Sack den Tod zu finden, will mir als ein gar zu schmähliches Ende vorkommen.“
„Das stimmt“, sagte Heveydd, der Alte, „ich meine, auf so jämmerliche Weise zu sterben – das hat er nicht verdient.“ „Was soll ich tun?“ fragte Pwyll zögernd, denn er wollte nicht noch einmal überlistet werden. Rhiannon aber riet ihm: „Laß Gwawl frei, aber besteht darauf, daß er zuvor jeden Anspruch auf mich abschwört. Und lasst ihn auch schwören, daß er keine Rache üben wird.“ „Dazu bin ich bereit“, rief der Mann mit dem Sack über dem Kopf. „Nun gut denn“, sagte Pwyll, „einen Rat, den Heveydd noch an Pwyll geben, nehme ich gerne an.“ Also tat Gwawl Verzicht auf das Mädchen und beschwor, keine Rache zu üben, weder an Heveydd noch an Pwyll und Rhiannon. Und als dies geschehen war, brachten sie ihn in ein heilkräftiges Bad, damit seine Wunden sich schlossen. Darauf stellte er Geiseln und ritt in sein Königshaus.
Dann wurde die Halle für Pwyll und seine Gefährten und für die Männer Heveydd hergerichtet. Sie kamen herein und setzten sich so, wie sie vor einem Jahr an der Tafel beisammengesessen haben. Sie aßen und zechten, und als es Schlafenszeit war, nahm Pwyll Rhiannon, führte sie in ihre Kammer. Am anderen Morgen sprach Rhiannon: „Herr, steh jetzt auf und teile Gaben aus unter den Fahrenden Sängern und verweigere niemanden, was er sich wünscht, und tu dies als Zeichen, daß ich gern dein Weib bin.“ „Mit Freuden“, sagte Pwyll, „und so soll es sein heute und alle Tage, so lange das Fest währt.“ Als dies geschehen war, ging das Fest weiter und weiter, und solange es währte, wurde niemand abgewiesen, der sich etwas erbat. Als das Feiern dann ein Ende hatte, sprach Pwyll zu Heveydd: „Mit Euerer Erlaubnis, Herr, morgen will ich nach nach Dyved davonziehen.“ „Gott leite dich“, erwiderte Heyeydd, „und ich will eine Zeit setzen, nach deren Verlauf Rhiannon dir folgen soll.“ „Zwischen Gott und mir, wir reisen zusammen.“ * „Ist das wirklich dein Wille?“ „Zwischen mir und Gott: so muß es sein, sind wir doch Mann und Frau.“
Am nächsten Tag reisten sie ab und hielten Hof zu Arberth, wo ebenfalls ein Fest für sie ausgerichtet wurde. Alle wichtigen Männer und Frauen des Reiches kamen, und keiner, auch nicht ein einziger, ging, ohne von Rhiannon ein Geschenk erhalten zu haben – eine Brosche, einen Ring oder einen kostbaren Stein. Pwyll und Rhiannon regierten glücklich im ersten Jahr und im zweiten. Im dritten Jahr jedoch begannen sich die Männer von Dyved Gedanken darüber zu machen, daß der Mann, den sie als ihren Herrscher anerkannten, immer noch ohne Nachkommen war. Also erbaten sie von Pwyll eine Unterredung. „Herr“, sprachen sie, „wir wissen wohl, daß du noch nicht eigentlich alt bist, aber wir fürchten, daß dein Weib keine Kinder gebären wird. Nimm eine andere Frau, damit du einen Erben bekommst. Du wirst nicht ewig leben. Und es muß sichergestellt sein, daß auch dann jemand mit Vernunft und Stärke über das Land herrscht.“
„Nun“, sprach Pwyll, „bedenkt doch, daß Rhiannon und ich noch gar nicht so lange miteinander sind, und was nicht ist, kann noch werden. Gebt mir noch ein Jahr. Dann wollen wir wieder zusammenkommen. Dann will ich wieder euren Rat suchen.“ So setzten sie eine Frist, aber ehe das Jahr um war, gebar Rhiannon in Arberth einen Sohn. In der Nacht der Geburt kamen Frauen in die Kammer, um nach der Mutter und dem Kind zu schauen, und Rhiannon schlief tief und fest. Sechs Frauen wachten in der Kammer, aber ehe es Mitternacht war, schliefen auch sie alle und wachten erst bei Morgengrauen wieder auf.
Als sie nun die Augen aufschlugen und sich umblickten, war nirgends eine Spur des Neugeborenen. Es schien verschwunden. „O weh! Der Junge ist verloren!“ rief eine Frau. O weh!, rief eine andere, „gewiß wird man uns wegen unserer Unachtsamkeit bestrafen.“ „Gibt es denn für uns keine Hoffnung?“ „Doch, doch hört, ich habe einen guten Plan.“ Und der wäre?“ fragten die anderen. „Es gibt einen Rehpinscher hier, und die Hündin hat Junge. Wir werden einige davon töten und Rhiannons Hände und ihr Gesicht heimlich mit Blut beschmieren, damit es so aussieht, als habe sie ihr eigenes Kind umgebracht. Wenn es hart auf hart kommt, steht ihr Wort gegen das von uns sechs.“ Alle stimmten zu, diesen Plan in die Tat umzusetzen.
Und als es hell wurde, erwachte Rhiannon und fragte: „Frauen, wo ist mein Kind?“ „Liebe Herrin“, antworteten sie, „uns darf man nach dem Kind nicht fragen. Wir sind voller Beulen und Kratzer, so hat man uns zugesetzt. Noch nie zuvor haben wir es mit einer Wöchnerin zu tun gehabt, die solche Kräfte hatte. Aber es war alles umsonst.“ „Was soll das heißen“, sagte Rhiannon, „ihr armen Seelen: bei Gott dem Herrn, der um alle Dinge weiß, redet nicht falsch Zeugnis wider mich. Gott weiß, daß ihr die Unwahrheit sprecht. Wenn ihr Angst habt, so sagt es. Ich werde euch schützen.“ „Gott weiß, daß wir nie darauf kämen, die Unwahrheit zu sprechen“, erwiderten die Frauen heuchlerisch. „“Ihr armen Seelen...euch wird man keinen Vorwurf machen. Dafür verbürge ich mich!“ Aber wie eifrig sie auch den Frauen zuredete, sie blieben bei ihrer Behauptung, Rhiannon habe ihren eigen Sohn umgebracht, trotz aller Anstrengungen hätten sie sie nicht daran hindern können.
Um diese Zeit stand Pwyll auf, und der Vorfall blieb vor ihm nicht geheim. Die Geschichte sprach sich im Land herum. Die Edlen und Ritter hörten davon. Sie versammelten sich, schickten Boten zu Pwyll und verlangten von ihm, sich von seiner unmenschlichen Frau zu trennen. Pwyll ließ ihnen antworten: „Ihr habt keinen Anlaß, dies von mir zu verlangen, es sei denn, meine Ehe bliebe kinderlos. Aber da mein Weib ein Kind geboren hat, will ich nicht von ihr lassen. Hat sie Böses getan, so soll sie dafür bestraft werden.“ Rhiannon rief Lehrer und weise Männer und befragte sie, aber auch diese vermochten das Verschwinden des Kindes nicht aufzuklären.
Da sie es überdrüssig war, weiter mit den Weibern, die bei ihr gewacht hatten, zu streiten, verbüßte sie eine Strafe. Sie mußte sieben Jahre auf dem Hof von Arberth bleiben und jeden Morgen auf dem Stein sitzen, an dem man die Pferde anband; und jedem, der es nicht schon wusste, mußte sie erzählen, was geschehen war. Auch mußte sie Fremden und Besuchern anbieten, sie auf ihrem Rücken in den Hof hinein zu tragen. Es kam allerdings selten vor, daß jemand von diesem Angebot Gebrauch machte. Ein Jahr verging.
Um diese Zeit war der Herr-Unter-Den Wäldern in Gwent Teirnon Twrvliant, der beste Mann auf der irdischen Welt. Teirnon aber besaß eine Stute in seinem Haus, und es war das schönste Pferd im ganzen Reich. In jeder Walburgisnacht fohlte sie, aber nie bekam das Fohlen zu Gesicht. Immer schleppte es jemand fort. Eines Abends sprach Teirnon zu seinem Weib: „Frau, was sind wir doch für Narren. Jedes Jahr verlieren wir das Fohlen, das das Tier wirft.“ „Aber was lässt sich da tun?“ „Heute ist Walpurgisnacht“, sagte Teirnon, „Gott soll es an mir rächen, wenn ich nicht herausfinde, was mit dem Fohlen geschieht.“ Also ließ er die Stute hereinbringen, während er sich bewaffnete, und darauf hielt er bei ihr Wache.
Als es Nacht wurde, fohlte die Stute und brachte ein großes Fohlen ohne Fehl zur Welt. Teirnon fiel auf, wie groß das Tier war, aber als er sich aufrichtete, vernahm er einen fürchterlichen Lärm. Eine gewaltige Klaue griff durch das Fenster und packte das Fohlen. Teirnon zog sein Schwert und hieb dem, der das Tier offensichtlich stehlen wollte, den Arm bis zum Ellenbogen ab, so daß das Fohlen und ein Teil des Armes zurück ins Zimmer fielen. Wieder erhob sich ein großer Lärm, und zugleich hörte er einen Schrei. Er stieß die Tür auf und sprang in Richtung auf das Geräusch hin, aber die Nacht war stockdunkel, so daß er nichts zu erkennen vermochte.
Er wollte weiterlaufen und das Diebesgesindel verfolgen, als er sich daran erinnerte, daß er die Tür aufgelassen hatte, und als er deswegen umkehrte, fand er auf der Schwelle einen kleinen Jungen in lose Tücher und seidenen Mantel gehüllt. Teirnon nahm das Kind und stellte fest, daß es für sein Alter recht kräftig war. Er schloß die Haustür und ging zur Kammer seiner Frau. „Weib, schläfst du?“ „Nein, Herr. Ich habe geschlafen, aber als du hereinkamst, bin ich aufgewacht.“ „Hier ist ein Kind für dich, wenn du es annehmen magst, denn wir hatten ja nie eines.“ „Herr, was ist das für eine Geschichte“, sagte sie, und er erzählte, was er erlebt hatte. „Sieh nur, in was für feines Tuch der Junge eingehüllt ist.“ „In einen Mantel aus Seide!“ „Dann muß es der Sohn reicher Leute sein, Herr. Und vielleicht wächst uns daraus Trost und Freude. Ich will ein paar Frauen ins Vertrauen ziehen. Wir werden sagen, ich sei schwanger gewesen.“ „Tu, wie du meinst“, sagte Teirnon.
Der Junge wurde getauft, so wie es damals üblich war, und er erhielt den Namen Gwri Goldhaar, weil sein Haupthaar die Farbe von Gold hatte. Er wurde aufgezogen am Hof. Ehe er ein Jahr alt war,
konnte er schon laufen und war so kräftig wie ein gesunder Dreijähriger. Am Ende des zweiten Jahres war er so groß wie ein sechsjähriger Junge, und als er vier war, stritt er sich mit dem
Stalljungen darum, wer von beiden das Wasser für die Pferde holen solle. „Herr“, sprach Teirnons Weib, „wo ist das Fohlen, das in jener Nacht zur Welt kam, als du den Jungen gefunden hast?“ „Ich
habe es dem Stallburschen zur Pflege übergeben“, antwortete Teirnon. „Wäre es nicht gut, wenn man es zureiten und dem Jungen geben würde, den wir in der Nacht, als das Fohlen zur Welt kam, auf
der Türschwelle fanden?“ „Das ist ein guter Vorschlag. Er soll das Pferd bekommen.“
So erhielt der Junge das Pferd, und Teirnons Frau ging zu den Stallburschen und Kutschern und hieß diese das Pferd zureiten.
Unterdessen hatten sie von Rhiannons Missgeschick und ihrer Bestrafung gehört, und da er Mitleid empfand, dachte Teirnon über all das nach und betrachtete das Kind, das sie gefunden hatten, genau. Da fiel ihm auf, daß der Junge Pwyll erstaunlich ähnlich sah. Pwylls Aussehen war Teirnon wohlbekannt, denn er war einer seiner Ritter gewesen. Darauf überkam Teirnon große Furcht. Er sagte sich, es sei ungerecht, ein Kind zu behalten, das eines anderen Mannes Sohn sei. Als sie allein waren, sprach er mit seiner Frau darüber, und sie war es, die ihm riet, Gwri zu Pwyll zu schicken. „Wir können nur gewinnen dabei“, meinte die Frau, „nämlich auf dreifache Weise: Segen, weil wir Rhiannon von ihrer ungerechten Strafe erlösen. Dank von Pwyll, der sich freuen wird, nun doch einen Sohn zu haben und Dank auch von dem Jungen selbst. Und wenn er einmal groß ist, wer weiß, vielleicht kehrt er dann zu uns als Ziehsohn zurück.“
Also beschlossen sie, den Jungen zurückzugeben. Am nächsten Tag schon ritt Teirnon mit drei Gefährten und dem Jungen nach Arberth. Als sie den Hof erreichten, sahen sie Rhiannon, die auf dem Schandstein saß,und als sie nahe herankamen, redete sie sie an: „Häuptling, kommt, wenn Ihr wollt, werde ich Euch in den Hof tragen. Dies ist als Strafe über mich verhängt, weil ich angeblich meinen eigenen Sohn umgebracht habe.“ „Liebe Frau“, antwortete Teirnon, „keiner von uns will sich von Euch tragen lassen.“ „Mag sich tragen lassen, wer will. Ich jedenfalls nicht“, rief der Junge.
Als sie in den Hof kamen, war große Freude über ihren Besuch. Ein Fest wurde ausgerichtet. Pwyll selbst war gerade von einem Rundritt von Dyved zurückgenommen. Alle wuschen sich vor dem Mahl. Pwyll war froh, Teirnon einmal wiederzusehen. Nach dem ersten Gang des Essens, begannen sie zu schwatzen und zu zechen, und Teirnon erzählte seine Geschichte von der Stute und dem Kind, und wie er dieses seiner Frau in Obhut gegeben hatte. Und dann sprach er zu Rhiannon: „Liebe Frau, seht dort, das ist Euer Sohn, und wer anderes behauptet, der hat wahrlich gelogen. Als ich von Eurem Kummer hörte, ergriff mich Furcht. Ich denke, keiner hier am Tisch wird bestreiten wollen, daß dieser Junge Pwylls Sohn ist.“
„Nach dem was wir gehört haben, steht das außer Zweifel“, sagten alle. „Zwischen mir und Gott“, sagte Rhiannon, „welche Last wäre von mir genommen, wenn das was wir gehört haben, wahr wäre.“ „Frau, Ihr habt Euren Sohn recht benannt“, sprach Pwyll, „Pryderi ist ein Name, der zu ihm paßt.“ Rhiannon antwortete: „Fragt ihn, ob ihm nicht sein jetziger Name besser gefällt.“ „Wie wird er denn gerufen?“ fragte Pwyll. „Wir rufen ihn Gwri Goldhaar.“ „Dann soll sein Name doch Pryderi sein“, sagte Pwyll, „denn er paßt zu ihm und zu dem, was seine Mutter sagte, als sie die gute Nachricht empfing. Und weiter sprach Pwyll: „Dir Gottes Dank, Teirnon, daß du den Jungen die ganze Zeit über großgezogen hast. Wenn aus ihm ein guter Mann wird, so ist das auch dein Verdienst.“
„Herr, meine Frau, hat den Jungen großgezogen, und niemand grämt sich mehr über den Verlust, den wir nun erleiden, als sie. Um ihretwillen soll er daran denken, was wir für ihn getan haben.“ „Zwischen mir und Gott“, sagte Pwyll, „ich will für euch beide sorgen, so lange ich lebe, und wenn meine Ritter einverstanden sind, so soll Pryderi zu Penderan Dyved geschickt werden und bei diesem als Ziehsohn aufwachsen.“ Damit waren alle einverstanden, und so geschah es . Pryderi, Sohn von Pwyll, wurde mit Sorgfalt erzogen, wie es recht ist. Er war ein hübscher Bursche und war auf jedem Fest des Königreiches zu sehen.
Die Jahre vergingen. Pwylls Leben neigte sich dem Ende entgegen, und schließlich starb er. Pryderi regierte die sieben Cantrevs von Dyved mit Geschick. Alle mochten ihn gern. Er eroberte drei Cantrevs von Ystead Tywi und fügte sie seinem Königreich hinzu, und bald darauf nahm er auch die vier Cantrevs von Keridgyawn in Besitz. Er focht im Feld, bis es Zeit wurde, ein Weib zu nehmen. Dann heiratete er Kigva, die Tochter der Gwynn. Und damit endet der erste Zweig der Mabinogi.
Märchen des Wales von Mabinogion
Einion und die Dame vom Grünen Wald
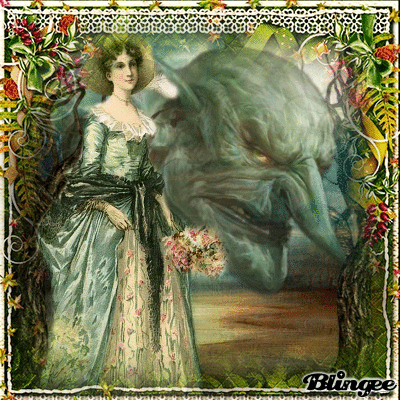
Einion, der Sohn des Gwalchmei, ging an einem schönen Sommertag durch die Wälder von Trefeilir. Da begegnete er einer schlanken schönen Frau. Ihre Haut übertraf an Schönheit das Weiß des Schnees auf dem hohen Gebirge und das Rot der Morgendämmerung. Da überfiel ihn im Herzen große Liebe. Er grüßte sie. Sie erwiderte seinen Gruß, und die Art, in der sie zu ihm redete, bewies ihm, daß ihr seine Gesellschaft nicht unangenehm war.
Er war höflich zu ihr, und sie war höflich zu ihm. Aber als er näher trat, sah er, daß sie statt Füßen Hufe hatte. Sie aber warf Glanz über ihn und sprach: „Du musst mir folgen, wohin immer ich auch gehe.“ Sie hatte ihn verzaubert. Er versprach ihr, bis ans Ende der Welt zu folgen. Zuvor aber bat er sie, sich noch von seiner Frau Angharad verabschieden zu dürfen. Damit war die Dame vom Grünen Wald einverstanden. „Aber“ sagte sie, „ich werde dabei sein, unsichtbar für alle, außer für dich.“ Also ging er heim und der Gobelin ging mit ihm. Als er Angharad, seine Frau nun sah, erschien sie ihm wie eine häßliche Alte, aber er erinnerte sich an frühere Zeiten und fühlte immer noch etwas Liebe zu ihr. Doch von dem Zauber konnte er sich nicht befreien. „Es ist nicht nötig für mich“ , sprach er, „daß ich dich für eine gewisse Zeit verlasse. Ich weiß nicht, für wie lange.“ Sie weinten zusammen und zerbrachen einen goldenen Ring zwischen sich. Er behielt die eine Hälfte, Angharad die andere. Dann nahmen sie Abschied voneinander, und er folgte der schönen Dame aus dem grünen Wald. Wohin sie gingen, wusste er nicht, denn es lag ein mächtiger Zauber auf ihm, und er sah keinen Ort und keine Person in ihrer wahren Gestalt. Nur die Hälfte des Ringes nahm er unverstellt so wahr, wie sie auch in Wirklichkeit aussah.
Nachdem er lange Zeit – er wusste nicht, wie lange – bei der schönen Dame vom grünen Wald gewesen war, schaute er eines Morgens, als die Sonne aufging, auf die eine Hälfte des Ringes und überlegte, an welchem sicheren Platz er sie verstecken könne. Schließlich schob er sie unter sein Augenlid. Als er das getan hatte, sah er einen Mann in einem weißen Gewand auf einem schneeweißen Pferd auf sich zukommen. Der Reiter fragte ihn, was er hier zu suchen habe. Einion erwiderte, er habe sich eben an seine Frau Angharad erinnert. „Möchtest du sie sehen?“ fragte der Mann in Weiß. „O ja“, erwiderte Einion, „mehr als nach irgend etwas anderem auf der Welt, verlangt es mich danach.“ „Nun dann“, sagte der Mann, „steige hinter mir auf mein Pferd.“ Einion tat, wie ihm geheißen. Und als er zurückblickte, war die schöne Dame vom grünen Wald verschwunden. Er erblickte nur Hufspuren von gewaltiger Größe, die nach Norden wiesen.
„Unter was für einen Zauber stehst du?“ fragte der Mann in Weiß. Da erzählte ihm Einion alles, was zwischen ihm und der schönen Dame vom Grünen Wald geschehen war. „Faß mit deiner Hand diesen
Stab hier“, sagte der Mann in Weiß, „und wünsche dir, wonach es dich am dringlichsten verlangt.“ Einion faßte den Stab, und das erste, was er sich wünschte, war, die schöne Dame vom Grünen Wald
wiederzusehen, denn er war immer noch nicht völlig vom Zauber befreit.
Ein abstoßendes Wesen zeigte sich ihm, widerlichster als die schrecklichsten Dinge auf dieser Welt. Einion stieß einen Schreckensschrei aus. Der Mann in Weiß warf seinen Mantel über ihn und in soviel Zeit, wie es zu einem Augenzwinkern bedarf, stand Einion auf einem Hügel von Trefeilir, an seinem eigenen Haus, aber er erkannte es nicht, und jeder, der ihn sah, wußte nicht, wer er war. Unterdessen war der Gobelin, der Einion als Dame vom Grünen Wald erschienen war, nach Trefeilir gegangen und hatte sich dort den Leuten als ein ehrenwerter und mächtiger Edelmann vorgestellt, als jemand, der offensichtlich sehr reich war. Er hatte Angharad einen Brief übergeben, in dem stand, Einion sei vor mehr als zehn Jahren in Norwegen gestorben. Er warf einen Zauber über sie, und sie hörte auf seine schmeichlerischen Liebesworte. Als sie sah, daß sie eine edle Dame werden konnte, höher gestellt als jede andere Dame von Wales, setzte sie einen Tag fest für die Hochzeit. Man traf große Vorbereitungen. Speisen und Getränke in Hülle und Fülle wurden herbeigeschafft. Musiker wurden bestellt, und man dachte sich Unterhaltungen aus, die einem jeden gefallen.
Nun gab es in Angharads Halle eine besonders schöne Harfe. Der Gobelin zeigte sich den Leuten als Edelmann. Aber als er die versammelten Harfenspieler – die besten Musiker aus ganz Wales waren dabei – aufforderte zu spielen, gelang es keinem, die Harfe zu stimmen. Gerade in diesem Augenblick betrat Einion das Haus, und Angharad sah ihn als einen alten, hinfälligen Mann mit Runzeln im Gesicht und mit weißem Haar, in Lumpen gehüllt. Nachdem all die anderen Harfner die Harfe nicht hatte stimmen können, nahm er das Instrument in die Hand und stimmte im Nu. Da wunderten sich alle sehr und fragten, wer er denn sei: „Ich bin Einion, Sohn des Gwalchmei“, sagte er, „dieses Gold ist der Beweis.“ Und er gab Angharad die Hälfte des zerbrochenen Ringes wieder.
Aber sie konnte sich nicht mehr darn erinnern, daß jeder beim Abschied eine Hälfte an sich genommen hatte. Da drückte Einion seinem Weib den Stab in die Hand, den der Mann in Weiß ihm gegeben hatte. Sofort stellte der stattliche und ehrenwerte Edelmann, sich in seiner wirklichen Gestalt dar – als ein fürchterliches Ungetüm. Angharad wurde ohnmächtig. Einion aber stützte sie und hielt sie in seinen Armen, bis sie wieder zu sich kam. Als sie nun die Augen aufschlug, sah sie weder den Gobelin noch irgendeinen der Gäste, nicht die Musiker und nicht die Mundschenken, nicht die Fleischvorschneider und nicht die Diener. Sie sah nur die Harfe, die gestimmt war, Einion und das Essen, das auf dem Tisch stand und köstlich duftete.
Da setzten sie sich, aßen, tranken und liebten sich, und groß war ihre Freude, daß nun der Bann des Gobelin, der sie verzaubert hatte, für immer gebrochen war.
Märchen aus Wales des Mabinogion
Wo König Arthur schläft

Es war einmal ein junger Mann im Westen von Wales, der war der Siebente von sieben Söhnen. Von solchen Menschen sagt man, daß auf dem 49. Teil ihrer selbst der Segen der Feen ruhe.
Nun geschah es eines Tages, daß er sich mit seinem Vater stritt, sein Heim verließ und sein Glück in England suchte. Als er durch Wales wanderte, traf er einen reichen Farmer, der ihn einstellte, um eine Viehherde nach London zu bringen.
»In meinen Augen«, sagte der Mann, »bist du ein rechter Kerl, und Glück hast du bestimmt im Leben auch. Mit einem Hund hinter dir und einern Stab in der Hand wärest du der Prinz, unter den
Rindertreibern. Nun, hier ist ein Hund, aber wo in aller Welt bekommen wir einen Stab für dich her?«
»Überlaß das nur mir« , sagte unser Mann aus Wales, ging zu einem steinigen Hügel und schnitt sich dort den schönsten Haselstecken, den er finden konnte. Der war so lang, daß er ihm bis zur Schulter reichte, biegsam wie eine Forelle und zugleich so hart, daß;, als die Stecken seiner Gefährten schon wie zerschlissenes Stroh aussahen, der seine weder einen Riß noch einen Sprung aufwies.
Er zog durch England und lieferte seine Herde in London ab. Etwas später stand er an der London Bridge und fragte sich, was er nun tun solle, als ein Fremder bei ihm stehenblieb und sich erkundigte, woher er komme.
»Aus meinem eigenen Land« , erwiderte er, denn ein Waliser in England ist vorsichtig.
»Und wie heißt du?« fragte der Fremde.
»Ich trage den Namen, den mir mein Vater gab.«
» Und wo stammt dieser Stecken her, Freund ?« » Wohl von einem Baum.«
»Du bist gewiß nicht auf den Kopf gefallen«, sagte der Fremde, »aber was würdest du wohl sagen, wenn ich behauptete, daß du mit diesem Stecken in deiner Hand Gold und Silber machen kannst?«
»Ich würde sagen, Ihr seid ein weiser Mann.«
»In großen Buchstaben geschrieben«, sagte der Fremde, und er erklärte, daß der Haselstecken über einem Platz gewachsen sei, an dem ein großer Schatz verborgen liege, »wenn du dich nur noch daran erinnern kannst, wo du diesen Stecken geschnitten hast und mich dorthin führst, ist dieser Schatz dein. «
»Das kann schon geschehen«, sagte der junge Mann, »denn um mein Glück zu machen, bin ich ja hier .« Ohne weitere Worte brachen sie zusammen nach Wales auf und erreichten schließlich den Felsen der Festung (Craig-y-Dinas ), wo der junge Mann dem Weisen (denn das war dieser Mann wirklich) genau die Stelle zeigte, an der er den Stock abgeschnitten hatte. Er war aus dem Wurzelwerk eines alten Haselnußbusches gewachsen, und man konnte noch die Schnittfläche sehen, gelb wie Gold und breit wie eine breite Bohne. Dort gruben sie nach und stießen bald auf einen großen flachen Stein, und als sie den Stein aufhoben, sahen sie einen Gang, in dem irgend etwas in der Ferne leuchtete.
»Du gehst voran«, sagte der weise Mann, denn ein Engländer in Wales tut auch gut daran, vorsichtig zu sein. Also krochen sie in den Gang hinein, immer dem Leuchten nach.
Von der Decke des Ganges hing eine bronzene Glocke herab, die hatte die Form eines Bienenkorbes, und der weise Mann sagte dem Waliser, daran dürfe er um Himmels willen nicht stoßen, sonst gebe es ein Unglück. Bald erreichten sie den Hauptteil der Höhle. Es war ein sehr großer Raum, aber mehr noch erstaunte sie, was sie dort sahen. Er war angefüllt mit Kriegern in strahlender Rüstung, die alle auf dem Boden lagen und schliefen. Es gab einen äußeren Ring von tausend Männern und einen inneren von hundert, die Köpfe ruhten zur Wand hin, und ihre Füße waren gegen die Mitte hin ausgestreckt, jeder trug ein Schwert, einen Schild, eine Streitaxt und einen Speer , und ganz außen lagen ihre Pferde. Weshalb sie das alles so deutlich erkennen konnten, wird man fragen. Nun, die Waffen und die Rüstungen glitzerten wie Sonnen, und die Hufe der Pferde strahlten ein Licht aus wie der Mond im Herbst. Und ganz in der Mitte lag ein König und Kaiser, den man an der juwelenbesetzten Krone in seiner Hand und an seiner ganzen Erscheinung erkannte. Dann sah der junge Bursche, daß in der Höhle auch zwei große Haufen Gold und Silber lagen. Gierig wollte er sich darauf stürzen, aber der weise Mann riet ihm, einen Augenblick zu warten.
»Nimm von einem Haufen oder vom anderen«, warnte er , »aber hüte dich, von beiden zu nehmen.«
Der Waliser lud sich so viel Gold auf, bis er auch nicht eine Münze mehr hätte tragen können. Zu seinem Erstaunen nahm der weise Mann nichts. »Gold und Silber machen nicht weise« , sagte er. Das erschien dem Waliser mehr angeberisch als klug, aber er sagte nichts, als sie wieder zum Eingang der Höhle zurückkehrten. Wieder warnte ihn der weise Mann, nur nicht an die Glocke zu stoßen.
»Es könnte für uns schlimm ausgehen, wenn einer oder mehrere der Krieger aufwachten und ihren Kopf höben und dann fragten: Ist es Tag? Sollte das geschehen, so mußt du auf der Stelle antworten: Nein, schlaft nur weiter, dann werden sie hoffentlich den Kopf wieder senken, und das bedeutet, wir können entkommen.«
Und so geschah es. Der Waliser hatte sich die Taschen so mit Gold vollgestopft, daß er sich nicht an der Glocke vorbeizwängen konnte, ohne mit dem Arm daranzustoßen. Sofort weckte der Klang einen der Krieger. Er hob seinen Kopf und fragte :
»Ist es Tag?«
»Nein«, antwortete der junge Mann, »schlaf nur weiter. «
Und prompt senkte der Krieger seinen Kopf wieder und schlief ein. Nicht ohne sich noch einmal nach hinten umzuschauen, erreichten die beiden Männer das Tageslicht und brachten den Stein wieder in seine alte Lage. Der weise Mann verabschiedete sich von dem jungen Burschen und sprach :
»Nütze deinen Reichtum gut, dann wird er für den Rest deines Lebens hinreichen. Wenn du aber noch einmal kommst und noch mehr holen willst, was ich vermute, dann bediene dich von dem Haufen mit Silber. Stoß nicht an die Glocke, aber wenn ein Krieger von ihrem Ton erwacht, wird er fragen: Ist der Cymry in Gefahr? Dann mußt du antworten: Noch nicht, schlaf weiter! Aber auf keinen Fall darfst du ein drittes Mal in die Höhle zurückkehren.«
» Wer sind diese Krieger?« fragte der junge Mann aus Wales, »und wer ist der schlafende König?«
» Es ist König Arthur, und die um ihn sind die Männer von der Insel der Mächtigen. Sie schlafen mit ihren Stuten und Waffen, weil ein Tag kommen wird, an dem Land und Himmel widerhallen vom Lärm einer Heerschar, und die Glocke wird läuten. Dann werden die Krieger ausreiten, Arthur allen voran, um den Feind ins Meer zurückzuwerfen, und von da an wird Friede und Gerechtigkeit unter den Menschen sein, solange die Welt dauert.«
» Vielleicht kommt es dahin«, sagte der junge Mann, »unterdessen habe ich mein Gold.«
Aber bald war es soweit, daß er alles Gold ausgegeben hatte. Zum zweiten Mal betrat er die Höhle, und diesmal nahm er eine große Ladung Silber mit. Ein zweites Mal stieß er mit dem Ellbogen an die Glocke. Drei Krieger hoben ihre Köpfe. »Ist der Cymry in Gefahr?« Die Stimme des einen klang leicht, wie die eines Vogels, die Stimme des zweiten dunkel wie die eines Ochsen, und die Stimme des dritten so drohend, daß man kaum zu antworten wagte .
»Noch nicht«, sagte der junge Mann, »schlaft nur weiter.« Langsam, unter Seufzen und Murmeln, senkten sie ihre Köpfe, ihre Pferde wieherten und scharrten mit den Hufen, dann war es wieder still in der Höhle.
Für lange Zeit gab sich der junge Mann damit zufrieden, daß er sich sagte: Ein drittes Mal darfst du die Höhle nicht betreten. Aber nach ein, zwei Jahren war das Silber den Weg des Goldes gegangen, fast gegen seinen Willen stand der junge Mann abermals unter dem Haselbusch, eine Hacke in der Hand. Ein drittes Mal betrat er die Höhle, und diesmal nahm er eine große Ladung Gold und Silber mit sich. Ein drittes Mal stieß er mit dem Ellbogen an die Glocke.
Als sie läutete, sprangen alle Krieger auf und die Pferde mit ihnen, und nie hatte man einen solchen Aufruhr erlebt. Dann erklang Arthurs Stimme, und Cei, der einhändige Bewyr, Owein, Trystan und Gwalchmei gingen unter der Mannschaft umher und beruhigten die Pferde.
» Noch ist es nicht Zeit« , sagte Arthur. Er deutete auf den jungen Mann, der mit Gold und Silber beladen war . »Oder wollt ihr etwa wegen dem da ausmarschieren ?«
Cei wollte den Eindringling fassen und ihn gegen die Wand schleudern, aber Arthur verbot ihm dies und hieß ihn, den Fremden nur hinauszubefördern. Wie ein Kaninchenfell flog der Bursche durch den Gang und der Verschlußstein hinter ihm drein. Ohne einen Pfennig, bleich vor Schrecken und voller Schrammen kam er wieder ans Tageslicht.
Es dauerte lange, bis man ihn dazu bringen konnte, seine Geschichte zu erzählen, und noch länger dauerte es, bis es ihm wieder besser ging.
Eines Tages aber kehrte er zusammen mit einem Freund nach Craig-y-Dinas zurück.
» Wo ist der Haselstrauch hin ?« fragten sie sich, denn er war nirgends zu sehen. »Und wo ist der Stein?« Auch der Stein war nicht mehr zu finden. Als der junge Mann darauf beharrte, seine Erlebnisse in der Höhle seien wahr, wurde er ausgelacht, und als er trotzdem die Geschichte weitererzählte, wurde er mit Schlägen zum Schweigen gebracht. Voller Zorn und Schande ging er außer Landes. Und seit diesem Tag hat niemand, und sei er auch der Siebente unter sieben Söhnen, Arthur mit seinem Hofstaat schlafen gesehen. Und niemand wird ihn auch sehen, bis zu dem Tag, da England und Wales in höchster Gefahr sind.
Märchen aus Wales
Die verheiratete Meermaid

An einem schönen Sommerabend ging ein Einwohner von Unst auf dem sandigen Rande einer Voe spazieren. Der Mond hatte sich erhoben, und er sah bei dessen Licht eine Menge Unterirdischer, die eifrig auf dem weichen Sande tanzten. - Neben ihnen lagen mehrere Seehundfelle auf der Erde.
Als sich der Mann den Tänzern näherte, hörten sie alle plötzlich auf, und eilten schnell wie der Blitz ihre Gewänder in Sicherheit zu bringen; dann sich ankleidend, sprangen sie als Seehunde in
die See. Da nun der Shetländer die Stelle betrat, wo sie gewesen waren, und die Augen auf den Boden richtete, bemerkte er, dass sie eins von den Fellen, das gerade vor seinen Füßen lag,
zurückgelassen hatten. - Er ergriff es, trug es schnell fort und brachte es in Sicherheit.
Als er an's Ufer zurückkehrte, sah er das schönste Mädchen von der Welt; es ging auf und nieder, und beklagte in den traurigsten Tönen den Verlust seines Seehundgewandes, ohne welches es nie hoffen konnte, wieder zu seinen Verwandten und Freunden unter dem Wasser zurückzukehren, sondern wider Willen auf der Oberwelt bleiben musste.
Der Mann näherte sich der Jungfrau, und versuchte sie zu trösten; umsonst, sie wollte nicht getröstet sein. Sie bat ihn in den rührendsten Ausdrücken, ihr das Gewand zurückzugeben; aber der Anblick ihres holdseligen Gesichtes, dass die Tränen noch verschönten, hatten sein Herz verhärtet. - Er stellte ihr die Unmöglichkeit ihrer Rückkehr vor, dass ihre Freunde und Verwandten sie endlich aufgeben würden, und schloss damit, dass er ihr sein Herz und seine Hand antrug.
Da sie fand, dass ihr nichts anderes übrig blieb, willigte sie zuletzt ein, seine Frau zu werden. Sie wurden verehelicht und lebten manches Jahr mit einander, während welcher Zeit sie mehrere Kinder zeugten, die außer einer dünnen Haut zwischen den Fingern und einer Beugung der Hand, wodurch diese Ähnlichkeit mit der Vorderpfote eines Seehundes bekam, keine weiteren Spuren ihrer seeischen Abkunft an sich trugen; jene Merkmale charakterisieren aber noch heutigen Tages die Abkömmlinge dieser Familie.
Des Shetländers Liebe zu seinem schönen Weibe war unbegrenzt; sie erwiderte hingegen seine Neigung nur sehr kalt. Oft schlich sie sich allein fort, und eilte zum einsamen Strande, wo auf ein gegebenes Zeichen ein sehr großer Seehund erschien, mit dem sie sich ganze Stunden unterhielt; gewöhnlich kehrte sie dann nachdenkend und traurig nach Hause zurück.
Jahre verstrichen, und ihre Hoffnung die Oberwelt verlassen zu können, war fast gänzlich erloschen, als die Kinder zufällig eines Tages ein Seehundfell hinter einem Haufen Getreide fanden. Erfreut über diese Beute, liefen sie eifrig zu ihrer Mutter, ihr dasselbe zu zeigen. - Mit Entzücken betrachtete jene das Fell; denn sie erkannte ihr Gewand, dessen Verlust sie so betrübt hatte. Jetzt glaubte sie sich von allen Banden befreit, und war in Gedanken schon bei ihren Freunden unter den Wellen. - Eins nur gab es, das ihrer Wonne Fesseln anlegte. Sie liebte ihre Kinder zärtlich und sollte sie jetzt für immer verlassen. -
Doch wogen diese die Lust, die ihrer wartete, nicht auf; deshalb umarmte und küsste sie sie, ergriff das Fell und eilte an den Strand.
Gleich nachher kam ihr Gatte heim und die Kinder erzählten ihm, was sich zugetragen hatte. Er erriet augenblicklich das Wahre, und eilte, von Angst und Liebe getrieben, ihr nach. - Doch kam er nur an, um zu sehen, wie sie in der Gestalt eines Seehundes, herab vom Felsen in die Flut sprang. -
Der große Seehund, mit dem sie sich für gewöhnlich zu unterhalten pflegte, gesellte sich alsbald zu ihr, wünschte ihr Glück zu ihrer Flucht, und beide verließen zusammen das Ufer. - Ehe sie aber
schied, wandte sie sich zu ihrem Gatten, der in stummer Verzweiflung auf dem Felsen stand, und dessen Trauer ihr Mitleid erregte. Lebe wohl! rief sie ihm zu, alles Glück mit Dir. - Ich habe Dich
wahrhaft geliebt, so lange ich bei Dir war, aber meinen ersten Gatten liebe ich stärker.
Märchen der Shetlands-Inseln
Deidre von den Schmerzen
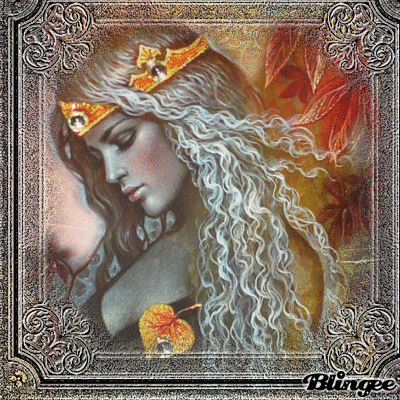
Die Edlen von Ulster feierten im Hause des Felmy, Sohn des Dall, der da Sänger bei König Conor war. Da war das Weib des Felmy hochschwanger, aber sie ließ es sich nicht nehmen, ihre Gäste zu bedienen. Die Becher kreisten, und die Wände des guten Hauses warfen das Echo von viel Gelächter zurück. Plötzlich schrie das Kind im Leib der Mutter, und die Frau überkamen die bitteren Schmerzen der Geburt.
Da erhob sich Cathbad, der Druide, und prophezeite: „Unter deinem Gürtel, o Weib, in deinem hochgewölbten Leib schreit ein weibliches Kind. Zu einem blondhaarigen, helläugigen, schönen Mädchen wird es heranwachsen. Viel Leid wird es bringen über Ulster. Tödlich wird sein Blick sein für die Männer, die es begehren, ein Kind des Unglücks und der großen Schmerzen für Erin wird geboren werden, und sein Name wird sein Deidre.“ Alle waren starr vor Schrecken, und keiner sprach ein Wort, bis das Kind geboren war und hereingebracht wurde, und wirklich, es war ein Mädchen mit hellgrünen Augen. Die Edlen von Ulster riefen wie mit einer Stimme: „Dieses Kind soll nicht leben!“ Aber Conor nahm Felmy das Kind ab und befahl, daß es in seiner Familie aufgezogen werde, und als es gesäugt worden war, ließ er es in ein einsames Fort bringen, wo es nie einen Mann zu Gesicht bekommen sollte, bis es der König selbst zum Weib machen würde.
In der Wildnis lebte Deidre, bis sie zu dem schönsten Mädchen in ganz Irland herangewachsen war. Nie sah sie ein männliches Wesen, außer ihrem alten häßlichen Wächter. Aber an einem Tag im Winter, als der Alte ein Hirschkalb erlegt hatte, erblickte sie einen Raben, der das Blut, das in den Schnee geflossen war, trank. Da sprach sie zu der Amme: „Liebe, wo ist der Mann mit den Farben: einem Leib wie Schnee, Wangen wie geronnenes Blut, Haaren schwarz wie die Flügel der Raben. Ach, Lewara, sag mir, gibt es einen solchen Mann draußen in der Welt? Ich will ihn lieben und er soll mich lieben.“ „Es gibt ihrer viele“, sprach Lewara, die Amme „aber der Schönste von allen wohnt in des Königs Haus. Es ist Naisi, der Sohn des Usnach.“ „Ach“, rief Deidre, „wenn ich den Mann nicht zu sehen bekomme, will ich sterben.“
Da überlegte die Amme, wie sie Naisi und Deidre zusammenbringen könne. Und alles Unglück begann. An einem bestimmten Tag geschah es, daß Naisi in der Mitte der Ebene von Eman saß und Harfe spielte. Süß war die Musik der Söhne von Usnach. Die Rinder hörten zu, und wenn diese Musik erklang, gaben sie zweidrittel soviel Milch mehr wie sonst, und von Mann und Weib fielen alle Pein und jeglicher Schmerz ab, sobald sie diese Musik vernahmen. Groß war auch die stärke der Söhne von Usnach. Wenn sie sich Rücken an Rücken stellten im Kampf, vermochten alle Männer aus Conors Reich sie nicht zu überwinden. Sie waren flink wie die Hunde bei der Jagd, und sie übertrafen die Rehe an Geschwindigkeit.
Als nun Naisi auf der Ebene von Eman sang, sah er, wie sich ein Mädchen ihm näherte. Sie hielt ihren Kopf gesenkt. Er sah nur ihr Haar, das gelb war wie Weizen. Sie kam nahe heran, ging vorbei, ohne ein Wort zu sagen, aber der Sternblick aus ihren hellgrünen Augen brannte auf seiner Stirn. „Lieblich ist diese junge Dame, die an mir vorbeiging“, sprach Naisi. Da sah ihn das Mädchen an und erwiderte: „Was nützt einem Mädchen all seine Schönheit, wenn es nie die Hand eines jungen Mannes spürt.“ Da wußte Naisi, daß es Deidre war, denn kein anderes Mädchen hätte es gewagt, so zu reden, und große Furcht überfiel ihn. „Der Provinzkönig ist dein Verlobter, meine Schöne“, sagte er. „Ich liebe ihn nicht“, antwortete sie, „er ist ein alter Mann. Viel lieber würde ich einen zum Manne nehmen, der so jung ist wie du.“ „Sprich nicht so“, sagte Naisi „besser ist es, den König als Ehegemahl zu haben, als nur dessen Diener. „Welch eine Torheit“, antwortete Deidre, „wenn einer in sich immer nur Vernunft zu Wort kommen läßt.“
Dann brach sie eine Rose von einem wilden Rosenstrauch, warf die Blume Naisi vor die Füße und sagte: „Für immer sollst du entehrt sein, wenn du mich zurückweist.“ „Versuche mich nicht, ich bitte dich“, sprach Naisi. Ich will dich“, erwiderte Deidre, „wenn du mich nicht zum Weibe nimmst, nachdem was zwischen uns gesagt worden ist, wirst du vor allen Männern dieses Landes entehrt sein. Das weiß ich von meiner Amme Lewara. Da wußte Naisi nichts mehr zu sagen und Deidre nahm seine Harfe, setzte sich zu ihm und spielte eine süße Musik. Die Männer von Ulster überfiel ein Zauber, als sie diese Klänge hörten. Aber die Söhne von Usnach kamen herbeigelaufen und sprachen zu ihrem Bruder: „Ach, was hast du getan? Ist dies nicht das Mädchen, von dem gesagt ist, sie werde großes Leid über Ulster bringen?“ „Was konnte ich tun“, antwortete Naisi, „wer kann gegen die Liebe kämpfen. Wenn ich sie nicht zum Weibe nehme, nachdem, was zwischen uns geschehen ist, bin ich entehrt von allen Männern in Irland.“ „Unglück wird über uns kommen“, sagten die Brüder. „Das kümmert mich nicht“, antwortete Naisi, „besser ist’s Unglück auf sich zu ziehen, als ehrlos zu sein. Wir wollen in ein anderes Land fliehen.“
Sie berieten sich, und da sie Naisi über alles liebten, beschlossen seine Brüder, ihm zu folgen, wo er hingehen würde. Schon am nächsten Morgen brachen sie auf und nahmen mit dreimal fünfzig Männer und dreimal fünfzig Weiber und dreimal fünfzig Windhunde und dreimal fünfzig Diener. In der Nacht vor diesem Morgen schlief Naisi bei Deidre. Conor, der König, wutentbrannt über die Entführung des schönen Mädchens, das er bestimmt hatte, seine Frau zu werden, setzte ihnen nach. Und sie wanderten hierhin und dorthin über ganz Irland und kamen endlich in das Reich Alba. Da schlugen sie ihre Lager auf, mitten in der Wildnis. Wenn sie in den Wäldern des Gebirges kein Jagdglück hatten, stahlen sie Vieh von den Männern in Alba. Bei diesen Überfällen, bewiesen sie große Kühnheit, und als dies dem König von Alba zu Ohren kam, ließ er sie an seinen Hof holen und nahm sie freundlich auf, denn kühne Männer sieht jeder gern in seiner Nähe.
Eines Morgens aber, als der Hofmarschall des Königs einen Rundgang durch die Gärten des Palastes machte, schaute er in ein Zelt und erblickte dort Naisi und Deidre. Da sprach der Hofmarschall zu seinem König: „O mein König, wir haben endlich ein passendes Weib für dich gefunden. Dem Sohn des Usnach und es ist eine Frau, wie sie einem Herrscher der westlichen Welt wohl anstehen würde. Laß Naisi erschlagen und nimm dir diese zur Frau.“ Nein“, sprach der König, „wir wollen anders vorgehen. Finde heraus, ob sie mir zu Willen sein würde.“ So geschah es. Als der Hofmarschall sie zur Untreue verlocken wollte, erzählte Deidre alles sogleich Naisi, der Ihr am liebsten war unter allen Männern, und sprach: „Wir müssen wieder fort. Wenn wir nicht noch in dieser Nacht davonschleichen, wird man euch Männer morgen alle erschlagen.“ Da verließen die Söhne von Usnach den Palast des Königs von Alba und fuhren zu einer entfernten Insel.
An einem bestimmten Tag feierte König Conor mit seinen Edlen in dem guten Haus Emania. Liebliche Musik wurde gespielt, und nachdem der Barde die hundert Vorfahren des Königs gerühmt hatte, erhob der König selbst seine Stimme und sprach: „Ich möchte von euch wissen, ihr Prinzen und Edelleute, ob ihr je ein prächtigeres Fest erlebt habt, oder ob ihr je ein besseres Haus gesehen habt als dieses Haus Emania?“ „Nein, o König“, antworteten sie wie aus einem Mund. Und abermals frage ich euch“, fuhr Conor fort, „ob es irgend etwas gibt, was hier fehlt?“ „Es wird die Höflichkeit sein, die euch dazu verleitet, die Unwahrheit zu sagen“, sprach Conor. „Ich weiß wohl, daß ihr alle vergebens Ausschau gehalten habt, als ihr in dieses Haus kamt. Ich meine die drei jungen Männer, die Kriegsleuchten von Gael, die drei edlen Söhne von Usnach –Naisi, Aini und Ardan. Ach, daß sie so fern von uns sein müssen, nur wegen dieses Weibes.
Hart bestraft sind sie gewiß, ausgestoßen hausen sie auf einer Insel im Ozean und schlagen sich mit barbarischen Horden des Königs von Alba herum. Wie beruhigt könnten wir sein, säßen sie mit an diesem Tisch und unter diesem Dach, stets dazu bereit, das Reich Ulster verteidigen zu helfen. Ich wünschte, sie wären bei uns.“ Darauf erwiderten die Edelleute: „Hätten wir es gewagt, unsere Gedanken auszusprechen, unsere Reden hätten dieselben Worte enthalten wie die deine. Wahrlich, es ist schade, daß die drei besten Männer in ganz Erin nicht unter uns sind.“ Conor nahm wieder das Wort: „Laßt uns Boten schicken nach Alba, zu der Insel von Loch Etive und die Söhne von Usnach bitten, nach Erin zurückzukehren.“ „Aber wer ist in der Lage, sie zu überzeugen, daß ihnen in deinem Königreich kein Leid geschehen wird?“ fragten die anderen. „Es gibt nur drei unter uns allen“, sagte Conor, „deren Wort dafür bürgen kann, daß ich mich nicht von meinem Zorn fortreißen lasse; es sind dies Fergus, Cuchullan und Conell Carnach. Einen von ihnen wollen wir als Botschafter bestimmen.“
Darauf nahm der König Conell Carnach beiseite und fragte ihn, was er tun würde, falls die Söhne von Usnach zurückkehren unter dem Versprechen freien Geleits. „Wer immer ihnen ein Leid zufügen würde“, antwortete Conell Carnach, dem würde ich’s mit bitterer Todespein vergelten.“ „Daraus entnehme ich“, sagte Conor, „daß ich dir nicht lieb und wichtig bin über alles.“ Dieselbe Frage wie Carnach legte Conor Cuchullan vor, und von ihm erhielt er eine ähnliche Antwort. „Gibt es denn niemanden auf der Welt“, sprach Conor, bei sich, stiller Trauer, „der weiß, wie bitter die Einsamkeit schmeckt?“ Darauf rief er Fergus, den Sohn des Roy, befragte ihn auf die gleiche Art, und Fergus antwortete: „Dein Blut, mein König, würde ich nie vergießen, aber wer sonst Männern, denen man freies Geleit verspricht, ein Haar krümmen würde, der bliebe nicht am Leben.“ „Daraus ersehe ich“, sagte Conor, „daß du mich über alles lieb und wert hälst. Geh zu dem Clan Usnach und führe ihn her. Kehre heim auf dem Weg über Dun Barach, aber laß die Söhne von Usnach nirgends rasten, bis sie hier auf meinem Fest sind. Versprich mir, daß du dich an diesen Befehl genau hälst.“ Da band sich Fergus mit einem heiligen Eid, worauf der König und er auf das Fest zurückkehrten und mit den anderen Edlen die ganze Nacht hindurch ausgelassen feierten.
Der König ließ aber Barach an einen anderen Ort rufen und fragte ihn dort, ob er in seinem Haus ein Fest vorbereitet habe. „Ich habe ein Fest ausgerichtet in Dun Barach“, sagte der Mann, „auf dem bist du und deine Edlen stets willkommen.“ „Laß Fergus nicht aus dem Haus“, sagte Conor, „ehe er bei dir gefeiert hat, wenn er aus Alba zurückkommt. Dadurch kannst du mir einen großen Dienst erweisen.“ „Er soll drei Tage bei mir feiern“, sagte Baruch, „wir gehören beide dem Kampfbund des Roten Zweigs an. Sein Eid zwingt ihn, meine Gastfreundschaft anzunehmen.“ Am nächsten Morgen brach Barach mit seinen beiden Söhnen Buini Borb und Illan Finn und mit Cailon, seinem Schildträger von Emania nach Alba auf. Sie segelten über die See und kamen nach Loch Etive zu der Insel, auf der die Söhne von Usnach wohnten.
Deidre und Naisi saßen zusammen in ihrem Zelt. Conors poliertes Schachbrett zwischen sich. Sie spielten Schach. Als nun Fergus in den Hafen eingelaufen war, stieß er einen Schrei aus, den Jagdruf eines kräftigen Mannes, und Naisi, der den Schrei hörte, sprach: „Ich höre den Ruf eines Mannes aus Erin.“ „Das war nicht der Ruf eines Mannes aus Erin“, erwiderte Deidre, „es war der Ruf eines Mannes aus Alba.“ Da rief Fergus zum zweitenmal. „Es war doch der Ruf eines Mannes aus Erin“, sagte Naisi. „Nicht doch“, erwiderte Deidre, „laß uns weiterspielen.“ Da rief Fergus zum drittenmal. Naisi aber wußte, daß nur der Fergus so rief, und er sprach: „Wenn dies nicht der Sohn des Roy ist, will ich nicht Naisi heißen. Geh, Ardan, mein Bruder und begrüße unsere Verwandten.
„Ich wußte gleich, daß es Fergus ist, der so ruft“, sagte Deidre leise. „Warum hast du denn versucht, es vor uns zu verbergen, Königin?“ fragte Naisi. Da erzählte Deidre: „In der letzten Nacht hatte ich einen Traum. Drei Vögel kamen zu uns geflogen von den Ebenen von Emania her. Sie hatten einen Tropfen Honig an ihrem Schnabel. Aber als sie wieder davonflogen, war der Tropfen Honig zu einem Tropfen Blut geworden.“ „Und was meinst du, Prinzessin, hat dieser Traum zu bedeuten?“ fragte Naisi. „Daß Fergus mit falscher Botschaft hergesandt worden ist von Conor, denn süß wie Honig ist die Botschaft des Friedens. Aber das Blut ist unser Blut, das vergossen werden wird.“ „Nein, das kann ich nicht glauben“, sagte Naisi, und zu seinem Bruder sprach er: „Fergus wird längst an Land gegangen sein. Geh, Ardan, zeig ihm den Weg zu unserem Zelt.“
Da lief Ardan hinunter zum Hafen, hieß Fergus willkommen, umarmte ihn und seine Söhne und verlangte zu wissen, was für Nachricht er aus Erin bringe. „Gute Nachricht“, antwortete Fergus, „Conor verspricht euch freies Geleit, wenn ihr nur heimkehrt nach Emania.“ „Das muß nicht sein“,sagte Deidre, „denn größer ist unser Einfluß in Alba denn Conors Einfluß in Erin.“ „In dem Land seiner Geburt zu leben“, erwiderte Fergus, „ist besser als alles andere. Wenig wert sind Macht und Reichtum für den, der nicht jeden Tag die Erde betrachten kann, die ihn hervorgebracht hat.“ „Das ist wahr“, sagte Naisi, „Erin ist meinem Herzen weit näher, selbst wenn ich in Alba sicherer und bequemer lebe.“ „Habt Vertrauen zu mir, „sagte Fergus, „ich verbürge mich für eure Sicherheit.“ „So laßt uns gehen“, sprach Naisi, „wenn sich Fergus für unser freies Geleit verbürgt, wer wollte da zweifeln!“
Als sie nun in den Hafen von Duan Barach einliefen, war Barach selbst am Kai. Er begrüßte die Söhne Usnachs und Deidre mit tückischer Herzlichkeit. Fergus aber nahm er bald auf die Seite und sprach zu ihm: „Verweile, und nimm an meinem Fest teil, denn ich lasse dich nicht abreisen, eh drei Tage vergangen sind beim Eid der Brüderlichkeit und der Gastfreundschaft, den du im Kampfbund des Roten Zweigs geschworen hast.“ Als Fergus dies hörte, wurde er purpurrot im Gesicht und sagte dies: „Du tust Böses, Barach; Wie kannst du mich zu deinem Fest bitten, da du doch weißt, daß ich zu Conors unterwegs bin und die Söhne von Usnach nicht aus den Augen lassen soll, da denen der König freies Geleit gelobt hat.“ „Das kümmert mich nicht“, erwiderte Barach, „wenn du meine Gastfreundschaft zurückweist, spreche ich den Bann über dich.“ Da beriet sich Fergus mit Naisi, was er tun solle, und Deidre antwortete: „Du mußt entweder Barach im Stich lassen oder die Söhne von Usnach. Mir scheint es eine geringe Verfehlung, die Einladung zu einem Fest auszuschlagen, als Freunde allein zu lassen, die deinem Schutz anvertraut sind, doch kann ich nicht für dich entscheiden.“
„Ich sehe einen Ausweg“, antwortete Fergus, „ich werde bei Barach bleiben, doch meine Söhne Illan Finn und der rote Buini Borb werden euch begleiten und an meiner Statt für eure Sicherheit sorgen.“ „Wir brauchen deinen Geleitschutz nicht“, sagte Naisi zornig, „unsere starken Arme sind immer noch die beste Garantie für unsere Sicherheit gewesen.“ Ardan und Ainli, Deidre und die zwei Söhne des Fergus folgten ihm nach. Fergus aber blieb zurück, traurig und voll düstere Gedanken. Dann sprach Deidre: „Ich rate, wir sollten auf die Insel Rathlin ziehen und dort warten, bis Fergus uns begleiten kann, denn von jetzt an, meine ich, können wir uns auf die Zusicherung freien Geleits nicht länger verlassen.“ Aber Naisi und die Söhne des Fergus wollten nicht auf sie hören, und es wurde beschlossen, nach Emania weiterzureisen. „Ach“, klagte Deidre, „hätte ich nur nie Alba, das Land mit dem langen Gras verlassen.“
Als sie nun zu dem Wachtturm Fincairn im Gebirge von Fuadag kamen, bemerkte Naisi, daß Deidre nicht mehr bei ihnen war. Er kehrte um und fand sie in tiefen Schlaf versunken, und als er sie weckte, war sie voller Kummer und Angst. „Ich fürchte Verrat“, sagte sie, „ich hatte einen Traum. Ich sah Illan Finn für uns kämpfen, aber am Ende war sein Leib ohne Kopf. „Deine Lippen sind lieblich, aber deine Träume sind immer nur mit Bösem angefüllt“, sagte Naisi, „ich fürchte keinen Verrat. Laß uns weiterziehen. “Und so reisten sie weiter, bis sie nach Ardsallagh kamen. Dort sprach Deidre zu Naisi: „Ich sehe eine Wolke über Emania, und es ist eine Wolke vollgesogen von Blut. Ich rate euch, ihr Söhne von Usnach, geht nicht nach Emania ohne Fergus, lasst uns nach Dundalgan reisen zu unserem Nefffen Cuchullan, bis Fergus sich seiner Verpflichtung entledigt hat.“ „Ich fürchte niemanden und nichts“, sprach Naisi, „wir ziehen weiter.“
Da schrie Deidre auf: „O Naisi, siehst du denn nicht die Wolke über Emania, eine Wolke aus Blut, Eitertropfen sickern aus ihren roten Rändern. Weh mir, geh nicht nach Emania, heute abend.“ „Ich fürchte mich nicht“, antwortete Naisi, „ich will auf deinen Rat nicht hören. Ziehen wir also weiter.“ „Enkel des Roy“, erwiderte Deidre, „selten genug hat es zwischen dir und mir Meinungsverschiedenheiten gegeben. Immer waren wir ein Herz und ein Gedanke, seit dem Tag, an dem mich Lewara zu dem Platz in der Ebene von Emania schickte, wo du Musik machtest.“ „Ich habe keine Furcht“, sagte Naisi wieder. „Söhne von Usnach“, sprach Deidre abermals „es gibt einen Anhaltspunkt dafür, ob Conor Verrat gegen uns im Sinn führt oder nicht. Wenn man uns in die Häuser von Emania geleitet, brauchen wir nichts zu befürchten, weist man uns aber als Quartier das Haus des Kampfbundes vom Roten Zweig an, dann seid auf das Schlimmste gefaßt.“ Während sie dies sagte, kamen sie an den Toren von Emania an. Naisi klopfte, und der Türhüter fragte, wer da sei. „Der Clan von Usnach und Deidre“, war die Antwort.
Da geleitet man sie zum Haus des Kampfbundes vom Roten Zweig auf Conors Befehl. „Besser, ihr würdet wenigstens jetzt meinen Rat bedenken“, sprach Deidre, „denn nun wird uns gewiß Böses widerfahren.“ „Ach was“, sprach Illan Finn, der Sohn des Fergus, „Feigheit haben die Söhne meines Vaters nie gekannt. Ich und Buini Borb werden mit euch gehen zum Haus des Roten Zweigs.“ Als sie nun dort eintrafen, brachte ihnen der Diener reichlich Fleisch und süßen Wein, bis sie alle zufrieden waren und lustig, nur Deidre und die Söhne von Usnach blieben vorsichtig und genosssen nur wenig von den Speisen und dem Wein, aus Furcht um ihr Leben. Dann sagte Naisi: „Bringt das Schachbrett her!“ „Und er spielte mit Deidre Schach auf dem polierten Brett.
Da nun Conor Deidre im Haus des Roten Zweigs wußte, hielt er es nicht mehr ruhig auf dem Fest aus. Zu seinen Gästen sagte er: „Wer geht für mich hinüber zum Haus des Roten Zweigs, um zu schauen ob Deidre immer noch von so großer Schönheit ist. Wenn ihr Gesicht und ihr Körper sich nicht verändert haben, gibt es keine schönere Frau auf der Welt als sie.“ Da sprach Lewara, die Amme: „Das will ich für dich tun, König“, denn sie liebte Naisi und Deidre, die sie zusammengebracht hatte. sehr, und dies war die einzige Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen. Als sie nun in das Haus des Roten Zweigs kam, traf sie Naisi und Deidre am Schachbrett an, und sie küßte und umarmte beide und sprach: „Meine lieben Kinder, wie könnt ihr eure Zeit mit Spielen und Vergnügen vertun, während Conor auf Verrat sinnt. Ach weh mir, dies wird eine böse Nacht für den Clan, wenn ihr nicht eure Türen und Fenster verrammelt und tapfer zu kämpfen wisst. Dir aber, Sohn des Fergus, rate ich, tu deine Pflicht, bis dein Vater selbst zur Stelle ist.“ Dann vergoß sie bittere Tränen und kehrte ins Haus Emania zurück.
Conor fragte sie, was sie zu berichten habe. „Gute und böse Nachricht bringe ich, meine gute Nachricht ist, daß die Söhne von Usnach immer noch die drei tapfersten Kämpfer sind, die ihr in Erin finden werdet. Die schlechte Nachricht aber besteht darin, daß die, welche die herrlichste unter den Weibern von Erin war, als sie von hier floh, nun nicht länger lieblich anzusehen ist.“ Da stieg in Conor Zorn und Eifersucht auf. Er trank weiter auf seinem Fest, doch nach einer Weile konnte er nicht mehr an sich halten und sprach: „Wer ist hier, der bereit wäre, mir wahre Nachricht aus dem Haus des Roten Zweigs zu bringen?“ Niemand von den Edlen gab Antwort, denn alle fürchteten, der König könne sein Versprechen brechen, das er Fergus gegeben hatte.
Da sprach Conor zu einem von seinen Leuten: „Erinnerst du dich, Trendorn, wer deinen Vater erschlagen hat?“ „Naisi Mac Usnach hat meinen Vater erschlagen und meine drei Brüder auch.“ „Dann geh und erkunde du für mich, wie Deidre in Wahrheit aussieht. Ich mag es einfach nicht glauben, daß ihre Schönheit vergangen ist wie der Schnee im Frühling.“ Da lief Trendorn hinüber zum Haus des Roten Zweigs, und er fand, daß ein Fenster offenstand, und sah Naisi und Deidre drinnen vor dem Schachbrett sitzen und spielen. Deidre sagte zu Naisi: „Ich sehe. Da ist jemand am Fenster, der beobachtet uns.“ Da warf Naisi die Schachfigur nach Trendorn und er verlor ein Auge. Darauf rannte er klagend zu Conor, und dieser hatte nun einen Vorwand zum Kampf gefunden.
Laut tat er seine Entrüstung kund: „Dieser Mann Naisi war einst mein Vasall. Jetzt will er selbst König sein.“ Leise aber fragte er nach Deidre. „Sie ist noch immer so schön“, antwortete Trendorn, „daß kein Weib auf der Welt sich mit ihr an Schönheit messen könnte.“ Als Conor das hörte, lohten die Flammen des Zornes und der Eifersucht in ihm. So hell brannte dieses Feuer, daß es jeder in der Halle sah. Er sprang auf den Tisch und schrie den Männern, die am Fest teilnahmen, zu: „Auf denn, lauft hinüber, und bringt mir die Übeltäter her, damit ich sie bestrafe.“ Die Krieger von Ulster umstellten also das Haus, stießen ein furchtbares Gebrüll aus und legten Feuer an Fenster und Türen.
Als die Söhne von Usnach die Rufe hörten, fragten sie, wer da draußen lärme. Und die Antwort kam: „Conor und Ulster!“ „Verräter“, rief Illan Finn, „wollt ihr das Wort brechen, das der König meinem Vater gegeben hat?“ „Räudige Hunde und Schurken“, brüllte Conor zurück, „wollt ihr den Verführer meines Weibes schützen?“ „Weh mir“, klagte Deidre, „wir sind betrogen worden, und Fergus war ein Verräter.“ „Wenn Fergus euch betrogen haben sollte", sprach Buini Borb, „so will ich doch zu euch halten“, und er stieß die Tore auf und machte einen Ausfall mit seinen Männern. Er erschlug fünfzig gute Krieger unter den Ulster Männern und richtete eine große Verwirrung unter den Truppen des Conor an.
Als der König davon hörte, verlangte er zu hören, wer seine besten Männer erschlagen habe.“ „Das war der rote Buini Borb, Sohn des Fergus.“ „Halt ein“, rief Conor zu dem Fergus Sohn hinüber“, ich will dir das Land in Slive Fuadh geben.“ „Und was noch?“ „Ich will dich zu meinem Kanzler machen“, versprach Conor. Da ließ Buini Borb ab und ging seines Weges. Aber das Land, das ihm der König versprochen hatte, verwandelte sich über Nacht in eine Wüste; es wird seither Dalwhiuny genannt und ist ein düsteres Moor im Gebirge Fuadh.
Als Deidre sah, daß sie auch von Buini Borb im Stich gelassen worden waren, rief sie aus: „Verräter der Vater, Verräter der Sohn, hab ich nicht gesagt, daß Fergus ein Verräter sei.“ „Wenn Fergus ein Verräter ist“, sprach Illan Finn, „so werde ich euch doch nie verraten. Solange dieses kleine gerade Schwert in meiner Hand ist.“ Dann stürmte Illan Finn mit seinen Männern vor. Er lieferte den Belagerern drei heftige Gefechte und erschlug dreimal hundert Männer. Darauf kam er ins Haus, wo Naisi und sein Bruder Ainli Schach spielten, denn die Söhne von Usnach wollten nicht zeigen, daß ihre Herzen von dem Lärm erschreckt worden seien. Mit Fackeln, die er seinen Männern in die Hand gab, machte Illan Finn abermals einen Ausfall und vertrieb jene Feinde, die Feuer an das Haus des Roten Zweigs gelegt hatten.
Da war es Connor, der rief: „Wo ist mein Sohn Fiara Finn?“ „Hier bin ich, mein König!“ „So wahr es ist, daß Illan Finn und du in derselben Nacht das Licht der Welt erblickt haben, geh hin und kämpfe mit ihm. Und da er die Farben seines Vaters zeigt, trage du meine Farben und meine Rüstung. Nimm Ozean, Flucht und Sieg, meinen Schild, meinen Speer und mein Doppelschwert, und kämpfe gut für deinen Vater mit dem Sohn Fergus.“ Da zog Fiara die gute Rüstung seines Vaters an und ging in das Haus des Roten Zweigs, um mit Illan Finn zu kämpfen. Sie lieferten sich einen fairen Kampf, männlich, bitter, blutig, bis Illan Finn Fiara zu Boden schlug und ihn zwang, unter seinem Schild Schutz zu suchen.
Da begannen die Wellen am blauen Rand des Ozeans zu grollen, denn es war eine Besonderheit des Schilds, daß in ihm das Geräusch der sturmgepeitschten See widerklang, wenn der, welches es trug, in Gefahr war. Und die drei Meere um Erin brüllten mit ihren Wellen zum Gesang des Ozeans. Die Wellen von Tuath und die Wellen von Cliona, die Wellen von Inver-Roy, sie alle donnerten laut und kündeten Fiara Bedrängnis. Colonel Carnach saß auf dem Felsen von Sanseverich und hörten den Lärm von Loch Rory und von der See. Da griff er nach seinen Waffen, rief seine Männer zusammen und führte sie gen Emania, da er wußte, daß sein König in Gefahr war. Dort auf dem offenen Feld vor dem festen Haus des Roten Zweigs fanden sie Fiara Finn arg bedroht von seinem Widersacher. Sie stürmten gegen Illan Finn von hinten an und schleuderten ihre Speere auf ihn, die ihn ins Herz trafen, ihn, der nicht wußte wie ihm geschah, da er die Männer nicht hatte kommen sehen.
„Wer hat mich von hinten durchbohrt?“, schrie er, „warum haben diese Schurken nicht den Kampf Auge in Auge gesucht?“ „Sag lieber, wer du bist?“ rief Conel. „Ich bin Illan, der Sohn des Fergus!“ „Und ich bin Colnel Carnach!“ „Weh dir. Bös ist die Tat, zu der du dich hergegeben hast, Conel. Gemein und hündisch ist es von dir, mich von hinten zu durchbohren, da ich den Clan von Usnach verteidige, der zurückgekehrt ist aus Alba und dem man freies Gesuch zugesichert hat.“ „Bei meiner linken Hand“, rief Conel, „diese Beleidigung soll nicht ungerächt bleiben“, und mit einem gewaltigen Schlag trennte er Fiaras Haupt vom Leib und ging dann davon in großem Zorn und tiefer Sorge. Die Schwachheit des Todes überkam Illan, und er warf seine Waffen in das feste Haus und forderte Naisi auf, nun namentlich zu kämpfen.
Und wieder rannten die Mannen gegen das Haus des Roten Zweigs an und versuchten, es in Brand zu stecken. Hervor kamen Ardar und seine Männer, um das Feuer auszutreten. Naisi selbst griff in den Kampf ein und im letzten Drittel der Nacht, und beim Morgengrauen hatte er alle Truppen aus der Umgebung des Hauses vertrieben. Doch Conor warf neue Krieger ins Gefecht, und der Kampf tobte in der Ebene mit unerhörter Verbissenheit, bis es heller Tag war. Und das Schlachtenunglück wandte sich gegen die Männer von Ulster, und bis die Sandkörner am Meer, die Blätter im Wald, die Tautropfen auf den Wiesen und die Sterne am Himmel nicht gezählt worden sind, wird man nicht auf die große Zahl kommen, von Naisis Hand und durch die Hände seiner Brüder, die auf der Ebene lagen. Dann kam Naisi noch einmal in das Haus des Roten Zweigs zurück, machte Deidre Mut und sprach: „Wir werden entkommen, kämpfe tapfer und fürchte dich nicht.“ Da bildeten die Söhne von Usnach eine Schutzmauer mit ihren Schilden, stürzten sich wie drei Adler auf die Streitmacht Conors, und viele guten Männer ließen wiederum ihr Leben.
Als nun Cachbad sah, daß die Söhne von Usnach selbst den König bedrohten, nahm er Zuflucht zur Magie und verzauberte sie, so daß ihre Waffen ihnen aus der Hand fielen und sie von den Männern von Ulster ergriffen werden konnten, denn ihre Glieder waren gelähmt von dem Zauber. Es war aber kein Mann in der Streitmacht von Ulster zu finden, der den Söhnen von Usnach den Tod geben wollte, so beliebt waren sie beim Volk und bei den Edlen. Doch war da im Haus der Edlen ein Mann, der hieß Maini, die rauhe Hand, Sohn des Königs von Lochlin, und Naisi hatte seinen Vater und seine Brüder erschlagen. Dieser Mann gab ihnen den Tod. So waren die Söhne von Usnach erschlagen, und als die Männer von Ulster vom Tod der Recken hörten, stießen sie drei laute Schreie des Kummers und der Klage aus. Deidre warf sich über die Leichen und küßte ihre toten Leiber. Dann beutelte sie ihr eigenes Haar und zerriß die Kleider. Das Grab wurde geschaufelt, und Deidre stand da mit ihrem aufgelösten Haar, vergoß viele Tränen und sang ihr Trauerlied:
Die Löwen von den Hügeln sind dahin.
Ich bin allein, ich bin allein.
Grabt tief das Grab und breit.
Denn ich bin krank und sehne mich nach Schlaf.
Die Falken aus den Wäldern sind dahin.
Ich bin allein, ich bin allein.
Grabt tief das Grab und breit,
Und lasst mich ruhn an ihrer Seite.
Die Drachen von den Felsen schlafen nun.
Und Schlaf ist’s, den kein Klagelied mehr weckt.
Schaufelt das Grab, macht es bereit.
Und lasst mich ruh’n an meines Liebsten Seite.
Märchen aus Irland
Jack Hannaford
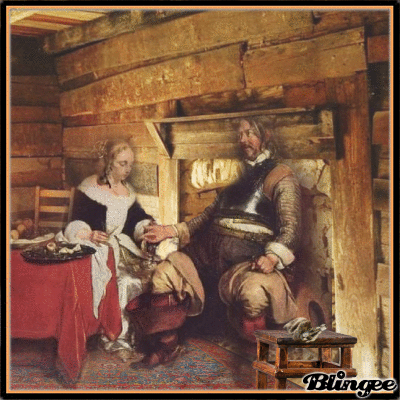
Es war ein alter Soldat, der hatte viele Kriege mitgemacht, so daß er ganz heruntergekommen war und nicht wußte, wo er einen Lebensunterhalt finden sollte. So wanderte er über Heidehügel und durch Schluchten, bis er schließlich an einen Bauernhof kam, den der gute Bauer verlassen hatte, um zum Markt zu gehen.
Die Frau des Bauern war ein törichtes Weib; sie war Witwe, als er sie heiratete. Der Bauer aber war auch reichlich dumm, und es ist schwer zu sagen, wer von beiden der Dümmere war. Wenn ihr meine Geschichte gehört habt, mögt ihr’s entscheiden.
Bevor also der Bauer zum Markt ging, sagte er zu seinem Weib: „Hier sind 10 Pfund ganz in Gold. Gib acht darauf, bis ich zurückkomme.“ Wäre der Mann nicht ein Narr gewesen, er hätte niemals seiner Frau das Geld zum Verwahren gegeben. Gut, er fuhr also mit seinem Wagen zum Markt, und die Frau sagte zu sich: „Ich werde die 10 Pfund ganz sicher vor den Dieben aufbewahren.“ Sie wickelte sie in einen Lumpen und legte den auf den Kamin in der Stube. „Hier wird kein Dieb es jemals finden“, sagte sie, „das ist ganz gewiß.“
Da kam Jack Hannaford, der alte Soldat, und pochte an die Tür. „Wer ist da draußen?“ fragte das Weib. „Jack Hannaford.“ „Woher kommst du denn?“ “Aus dem Paradies.” „Allmächtiger! Und womöglich hast du dort meinen guten Alten gesehen?“ Sie meinte damit ihren ersten Mann. „Ja, gewiß!“ „Und wie ging es ihm?“ fragte die Biedere. „Sehr mittelmäßig. Er flickt alte Schuhe und hat nichts als Kohl zu essen.“ „Herrje!“ rief die Frau aus. „Hat er mir nichts bestellen lassen?“ „Ja, natürlich“, erwiderte Jack Hannaford. „Er sagte, das Leder wäre ihm ausgegangen, und seine Taschen wären leer; da solltest du ihm ein paar Schillinge schicken, dann kann er wieder neuen Ledervorrat kaufen.“ „Die soll er haben um seiner armen Seele willen!“
Und fort eilte die Frau zu dem Kamin, nahm den Lumpen mit den 10 Pfund herunter und gab die ganze Summe dem Soldaten. Sie sagte ihm, ihr Alter sollte davon gebrauchen, soviel er wünschte, und den Rest zurückschicken. Jack hielt sich nicht mehr lange auf, als er das Geld empfangen hatte; er ging davon, so schnell er konnte. Gleich darauf kam der Bauer heim und fragte nach seinem Geld. Die Frau erzählte ihm, durch einen Soldaten hätte sie es ihm ins Paradies geschickt, damit er sich Leder kaufen könnte; denn er müsse ja die Schuhe der Heiligen und Engel im Himmel flicken. Der Bauer war sehr ärgerlich und schwor, er sei niemals einem solchen Narren wie seinem Weibe begegnet. Die Frau aber sagte, er wäre der größere Narr, da er ihr das Geld gegeben hätte.
Doch es blieb keine Zeit, Worte zu verschwenden. Der Bauer bestieg sein Pferd und trabte hinter Jack Hannaford her. Der alte Krieger hörte das Hufgetrappel hinter sich auf der Straße und wußte sofort, dass es der Bauer war, der ihn verfolgte. Er legte sich auf den Boden und schaute in den Himmel hinauf. Dabei hielt er sich eine Hand vor die Augen und wies mit der anderen ins Blaue. „Was hast du denn vor?“ fragte der Bauer und hielt an. „Gott zum Gruß!“ rief Jack. „Ich habe aber was Seltsames gesehen!“ „Ja, was denn?“ „Einen Mann, der ging geradewegs in den Himmel, als zöge er auf einer Landstraße dahin.“ „Kannst du ihn immer noch sehen?“ „Ja!“ „Wo denn?“ „Steig von deinem Gaul und leg dich auf die Erde!“ „Wenn du das Pferd derweilen halten willst!“ Jack tat es bereitwilligst.
„Ich kann ihn aber nicht sehen!“ sagte der Bauer. „Halte die Hand vor die Augen, und du wirst dann gleich einen Mann von dir wegeilen sehen.“ Und so war es; denn Jack sprang auf das Pferd und ritt mit ihm über alle Berge. Der Bauer ging zu Fuß und ohne sein Pferd heim. „Du bist der größere Narr“, sagte die Frau, „denn ich habe nur eine Dummheit gemacht, du aber zwei!“
Märchen aus England
Füchslein Rotrock
In einem kleinen Haus mitten im Wald wohnte das Füchslein Rotrock.
Eines Tages ging das Füchslein spazieren und traf auf der Straße Hühnchen und Hähnchen.
"Guten Tag, Hühnchen, guten Tag Hähnchen. Wollt ihr mich nicht mal besuchen kommen. Ich habe ein kleines Haus im Wald." "Ja gerne, wir kommen morgen", antwortete das Pärchen.
Füchslein Rotrock freute sich und rannte zurück in den Wald.
Morgen würde er Hähnchen und Hühnchen fressen.
Am nächsten Morgen spannte das Hähnchen acht Mäuse vor seinen kleinen Wagen. Hähnchen und Hühnchen stiegen ein und los ging die Fahrt. Unterwegs begegneten sie der Katze. "Miau, ich bin noch nie
mit einem Wagen gefahren. Darf ich nicht mitkommen?" "Gern", sagte Hähnchen, "setz dich zu uns." Ein Stück weiter trafen sie die Ente: "Quak, ich bin noch nie auf einem Wagen gefahren. Bitte
nehmt mich mit!" "Gern", sagte Hühnchen, "komm, steig auf!"
Sie nahmen, obwohl es langsam eng wurde, noch einen Stein und eine Nähnadel mit.
Vor dem Haus des Füchsleins hielten die Mäuse an und alle stiegen aus. Hähnchen klopfte an die Tür. Niemand öffnete.
Das Füchslein war in den Wald nach Reisig gegangen. "Wer wohnt in diesem Haus", fragte die Katze. "Das Füchslein Rotrock. Wir sind heute seine Gäste", antwortete das Hähnchen.
Der Stein fiel um vor Schreck, die Nähnadel hüpfte, die Katze miaute, die Ente quakte. "Das Füchslein", riefen sie, "hat euch bestimmt nur eingeladen, weil es euch fressen will.
Aber keine Angst. Ihr habt uns auf dem Wagen mitgenommen. Wir helfen euch dafür." Die Katze und die Ente versteckten den Wagen hinter einem Busch. Hähnchen und Hühnchen und die acht Mäuse
versteckten sich hinter dem Haus.
Der Stein sprang auf das Dach. Die Katze kroch hinter den Herd. Die Ente versteckte sich im Wassereimer. Die Nähnadel schlüpfte ins Handtuch.
Bald kam das Füchslein heim. "Meine Gäste werden da sein", sagte es und wollte Feuer im Herd machen.
Als es an den Herd herantrat, blies die Katze ihm Asche in die Augen. Der Fuchs lief zum Wassereimer und wollte sich waschen, da klatschte die Ente mit den Flügeln und spritzte das Füchslein von
oben bis unten naß.
Als es sich am Handtuch abtrocknen wollte, zerkratzte die Nadel ihm das Gesicht.
Das Füchslein lief aus dem Haus, da fiel ihm der Stein fast auf den Kopf.
"Hilfe mein Haus ist verhext", rief es, lief in den Wald und kam niemals wieder zurück.
Hähnchen, Hühnchen, Katze, Ente, Stein und Nähnadel aber fanden Gefallen am Haus und blieben dort wohnen.
Quelle: (Englisches Märchen)
